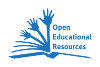Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Fabeln: Unterschied zwischen den Versionen
(→FR, 01/02) |
(→MI, 06/02) |
||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
'''SV/UG:''' Auswertung der (überarbeiteten) HA | '''SV/UG:''' Auswertung der (überarbeiteten) HA | ||
| − | ''' | + | '''LV/UG:''' ZITIEREN - Bitte kopiert euch die folgenden Hinweise und sichert die Datei! |
| + | |||
| + | HINWEISE ZUR VERWENDUNG VON ZITATEN IN DER ANALYSE LITERARISCHER TEXTE | ||
| + | |||
| + | Zitate sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Textanalyse. Nur eine Deutung, die schlüssig aus dem Text hergeleitet wird, ist für den Leser nachvollziehbar. In der schriftlichen Interpretation sind Zitate gleichsam das „Material“, an dem interpretiert wird. Somit dienen Zitate nicht der „Illustration“ der Darstellung oder dem bloßen Verweis auf den zu interpretierenden Text. Vielmehr haben Zitate die zentrale Funktion, Deutungen zu ermöglichen und für den Leser überzeugend zu belegen. Im Folgenden werden die wichtigsten Regeln zur Zitierweise, zur Verwendung von Zitaten und zur Auswertung von Zitaten vorgestellt. | ||
| + | |||
| + | I. ZITIERWEISE | ||
| + | |||
| + | Grundsätze zum korrekten Umgang mit dem Text | ||
| + | |||
| + | 1. Grundsatz: Zitate müssen korrekt sein! | ||
| + | |||
| + | a) Zitate müssen den korrekten Wortlaut des Textes wiedergeben. Alle wörtlichen Zitate sind in Anführungszeichen zu setzen. | ||
| + | Auslassungen, Änderungen und Hinzufügungen sind durch eckige Klammern zu kennzeichnen. | ||
| + | b) Auslassungen sind nur dann zulässig, wenn es sich dabei um Textelemente handelt, die für die nachfolgende Ausdeutung unerheblich sind. | ||
| + | In der Regel werden nur Auslassungen innerhalb eines Zitats gekennzeichnet, während ausgelassene Satzanfänge und Satzenden nicht gekennzeichnet werden. | ||
| + | c) Zitatänderungen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn sie aus syntaktischen Gründen unvermeidbar sind. Solche Änderungen dürfen den Sinn des Textes nicht entstellen. | ||
| + | Damit der originale Text erkennbar bleibt, sollten syntaktisch verzichtbare Änderungen vermieden werden. | ||
| + | d) Hinzufügungen des Verfassers sind nur dann sinnvoll, wenn sie für das Verständnis des Zusammenhangs zwingend erforderlich sind. | ||
| + | e) Wird ein ganzer Satz zitiert, dann entfällt der Punkt als Satzzeichen innerhalb des Zitats. Ausrufezeichen und Fragezeichen müssen jedoch in das Zitat eingeschlossen werden. | ||
| + | |||
| + | TEXTBEISPIEL: Lessing (1729-1781): Der Besitzer des Bogens | ||
| + | |||
| + | Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebenholz, mit dem er sehr weit und sehr sicher schoss, und den er ungemein wert hielt. Einst aber, als er ihn aufmerksam betrachtete, sprach er: „Ein wenig zu plump bist du doch! Alle deine Zierde ist die Glätte. Schade!“ - Doch dem ist abzuhelfen, fiel ihm ein. Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnitzen lassen. - Er ging hin; und der Künstler schnitzte eine ganze Jagd auf den Bogen; und was hätte sich besser auf einen Bogen geschickt, als eine Jagd? Der Mann war voller Freuden. „Du verdienest diese Zieraten, mein lieber Bogen!“ - Indem will er ihn versuchen; er spannt, und der Bogen - zerbricht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | UMSETZUNGEN | ||
| + | |||
| + | Zu 1a) | ||
| + | Durch den Hinweis, der Bogen sei „von Ebenholz" (Z. 1), wird die wertvolle Substanz des Besitztums bereits zu Beginn des Textes betont. | ||
| + | Zu 1b) | ||
| + | Der große praktische Nutzen für seinen Besitzer kommt zum Ausdruck, insofern gesagt wird, es handle sich um einen „trefflichen Bogen […], mit dem er sehr weit und sehr sicher" (Z. 1) zu schießen vermag. | ||
| + | Zu 1c) | ||
| + | Wenn der Besitzer in der Eingangsformulierung als „[e]in Mann"(Z. 1) bezeichnet wird, verweist die Verwendung des unbestimmten Artikels auf den parabolischen Charakter der Darstellung. | ||
| + | Zu 1d) | ||
| + | Dass dem Besitzer der praktische Nutzen doch nicht ausreicht, kommt zum Ausdruck, wenn er konstatiert: „Alle deine [gemeint ist der Bogen] Zierde ist die Glätte“ (Z. 2 f.). | ||
| + | Zu 1e) | ||
| + | Sein Missvergnügen an dieser Situation bringt der Besitzer zur Geltung durch den abschließenden Ausruf „Schade!" (Z. 3) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Grundsatz: Zitate müssen korrekt nachgewiesen werden! | ||
| + | |||
| + | a) Zitate werden in der Regel durch Angabe der Seite und/oder Zeile (je nach Textvorlage) in runden Klammern hinter dem Zitat nachgewiesen. | ||
| + | b) Endet ein Satz mit dem Zitatnachweis, dann steht der Satzpunkt hinter dem Zitatnachweis. | ||
| + | c) In seltenen Fällen kann ein Zitatnachweis auch in der Zitateinleitung geliefert werden, nämlich dann, wenn es der Zusammenhang erfordert oder wenn die Formulierung variiert werden soll. | ||
| + | d) Neben wörtlichen Zitaten sind (in sehr begrenztem Maße) auch indirekte Zitate möglich. | ||
| + | Der indirekte Bezug auf eine Textstelle wird durch (vgl. ...) belegt. Indirekte Zitate verweisen lediglich auf den Text und haben deshalb nur schwachen Belegcharakter. Sie können jedoch sinnvoll sein, um eine Interpretation zu bekräftigen, die an der Auswertung wörtlicher Zitate gewonnen wurde. | ||
| + | |||
| + | UMSETZUNG | ||
| + | |||
| + | Zu 2d) | ||
| + | Bemerkenswert erscheint, dass die wörtliche Rede mit diesem Befund endet (vgl. Z. 3). Der anschließende Gedankenstrich verweist auf einen Bruch in der Darstellung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | II. ZUR VERWENDUNG VON ZITATEN | ||
| + | Grundsätze zur Auswahl, Integration und Platzierung von Zitaten | ||
| + | |||
| + | 1. Grundsatz: Zitate müssen angemessen ausgewählt und platziert worden! | ||
| + | |||
| + | a) Als Zitate sind aussagekräftige Textstellen zu verwenden, die eine schlüssige Interpretation im Zusammenhang des Gesamttextes ermöglichen. | ||
| + | Zitate dokumentieren die Detailwahrnehmung des Texten im | ||
| + | Sinne einer hermeneutischen Literaturbetrachtung. Die Unterscheidung zwischen zentralen und weniger zentralen Textphänomenen ist natürlich nicht immer leicht. Wer sich dabei von dem hermeneutischen Grundsatz leiten läset, das Einzelne aus dem Allgemeinen und das Allgemeine aus dem Einzelnen zu verstehen, wird den richtigen Weg finden. | ||
| + | |||
| + | b) Da Zitate - wie oben erwähnt - die Detailbetrachtung des Textes dokumentieren, gehören sie in den Hauptteil, nicht in die Einleitung. | ||
| + | |||
| + | c) Eine Interpretation kann nur durch eine angemessene Anzahl von Zitaten überzeugend wirken. Eine Faustregel ist hier kaum anzugeben. „Verdächtig“ wird eine Darstellung jedoch spätestens dann, wenn innerhalb einer Spalte (des Hauptteils) gar nicht zitiert wird. Ein 40-zeiliger Text kann ohne 20 Zitate kaum angemessen interpretiert werden. | ||
| + | |||
| + | UMSETZUNG | ||
| + | Zu 1a) | ||
| + | Die Tatsache, dass er „den besten Künstler" (Z. 3) mit der Verzierung beauftragt, bezeugt die hohe Anspruchshaltung des Besitzers. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Grundsatz: Zitate müssen korrekt an die Darstellung angebunden werden! | ||
| + | |||
| + | a) Zitate müssen syntaktisch und semantisch korrekt mit der Darstellung verknüpft werden. Unvermitteltes „Einstreuen“ von Zitaten ist unbedingt zu vermeiden. | ||
| + | |||
| + | b) Satzglieder, die zitiert werden sollen, müssen korrekt in die Syntax der Darstellung eingefügt werden. Die Satzgliedbezeichnung ist zu benennen. | ||
| + | |||
| + | c) Werden einzelne Wörter zitiert, so ist in der Regel deren Wortart und/oder deren rhetorische Funktion zu benennen. | ||
| + | |||
| + | d) Verben und Adjektive müssen im Allgemeinen in der Grundform zitiert werden. | ||
| + | |||
| + | e) Neben der unmittelbaren Integration in die Syntax des Satzes können Zitate in bestimmten Fällen durch einen Doppelpunkt vom eigenen Text abgetrennt werden. Dies ist vor allem beim Zitieren wörtlicher Rede möglich, außerdem auch beim Zitieren von Aufzählungen und Beschreibungen. Auch diesen Zitaten muss jedoch eine syntaktisch korrekte Einleitung vorausgehen. | ||
| + | |||
| + | UMSETZUNGEN | ||
| + | Zu 2a) | ||
| + | Dass der Künstler "eine ganze Jagd" (Z. 4) als Zierat für den Bogen vorsieht, hebt die Vermessenheit dieser Handlung hervor. | ||
| + | Zu 2b) | ||
| + | Nach der Vollendung der künstlerischen Arbeiten wendet der Besitzer sich „voller Freuden" (Z. 5) seinem Bogen zu. Das Modaladverbial bringt einerseits das Vergnügen an der Erfüllung seiner Erwartungshaltung, im Kontext der weiteren Darstellung aber auch eine Verkennung der Realität zum Ausdruck. | ||
| + | Zu 2c) | ||
| + | Die spezifische Art der Personifikation in der Anrede des Bogens durch das Possessivpronomen „mein" (Z.8) und das Adjektiv "lieb" (ebd.) bezeugt, dass der Mann über den Bogen als über seinen Besitz willkürlich verfügen zu können glaubt. | ||
| + | Wenn der Besitzer nunmehr bemerkt, der Bogen verdiene die "Zieraten" (Z. 5), so verweist das hier verwendete Nomen auf die vermeintlich gesteigerte Wertigkeit des Besitztums. | ||
| + | Zu 2d) | ||
| + | Die Verwendung der Verben „versuchen" (Z.6), „spannen" und „zerbrechen" (ebd.) im Kontext der Darstellung der Zerstörung des Bogens desavouiert diese Einschätzung als Irrtum. | ||
| + | |||
| + | III. AUSWERTUNG VON ZITATEN | ||
| + | |||
| + | 1. Die Paraphrasierung eines Zitats ist in der Regel völlig überflüssig. Paraphrasierungen wirken zumeist stilistisch unschön und unbeholfen. Keinesfalls kann eine inhaltliche Wiedergabe die Deutung eines Zitats ersetzen. | ||
| + | |||
| + | 2. Jedes Zitat muss gedeutet werden. Dabei ist das hermeneutische Prinzip unbedingt zu beachten. Die Auslegung jeder einzelnen Textstelle muss mit dem Zusammenhang korrespondieren und mit der erfassten Gesamtintention übereinstimmen. | ||
| + | |||
| + | 3. Die Deutung von Zitaten zielt auf das, was der Text gleichsam unter der Oberfläche der jeweiligen Aussagen und Formulierungen zeigt. Bei der Deutung sind grundsätzlich inhaltliche, formale und sprachliche Aspekte zu berücksichtigen. Die Gewichtung dieser Aspekte richtet sich jedoch nach der jeweiligen Textstelle. | ||
| + | |||
| + | 5. Die Auslegung eines Zitats erfordert in aller Regel mehr Raum als das Zitat selbst. Auf zusammenhängende, präzise, schlüssige und nachvollziehbare Darstellung muss geachtet werden. | ||
| + | |||
| + | 6. Nur eine klare und entschiedene Deutung kann überzeugend sein. Vage Formulierungen, Vermutungen und Spekulationen sind zu vermeiden. Lässt ein Zitat mehrere Auslegungen zu, dann ist in der Regel der kontextuell überzeugenderen Deutung Vorrang einzuräumen. Eine Ausnahme bilden solche Textstellen, die intentional auf Mehrdeutigkeit angelegt sind. Ist dies der Fall, dann geht es in der Deutung darum, die in der Textstelle angelegte Spannung unterschiedlicher, möglicherweise gegensätzlicher Interpretationsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Auch dabei darf jedoch der Bezug zur Gesamtintention nicht verloren gehen. | ||
Version vom 3. Februar 2019, 08:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
FR, 18/01
Wilhelm Busch, Ein dicker Sack
1 Ein dicker Sack - den Bauer Bolte,
2 der ihn zur Mühle tragen wollte,
3 um auszuruhn, mal hingestellt
4 dicht an ein reifes Ährenfeld -
5 legt sich in würdevolle Falten
6 und fängt ’ne Rede an zu halten.
7 "Ich", sprach er, "bin der volle Sack.
8 Ihr Ähren seid nur dünnes Pack.
9 Ich bins, der euch auf dieser Welt
10 in Einigkeit zusammenhält.
11 Ich bins, der hoch von Nöten ist,
12 dass euch das Federvieh nicht frisst;
13 ich, dessen hohe Fassungskraft
14 euch schließlich in die Mühle schafft.
15 Verneigt euch tief, denn ich bin der!
16 Was wäret ihr, wenn ich nicht wär?"
17 Sanft rauschen die Ähren:
18 "Du wärst ein leerer Schlauch,
19 wenn wir nicht wären."
LV/UG: Text
EA/PA: Bearbeite den Text!
SV/UG: Auswertung
MO, 21/01
AM MITTWOCH HOLEN WIR (in den D-Stunden) DIE BEIDEN KR-STUNDEN NACH
EA/PA: Versuche die Analyse der Fabel zu schreiben, und lade sie hoch auf diese Seite.
PA: Gib deinem Nachbarn ein Feedback, indem du Fehler in seinem Text fett markierst und auf die Kriterien einer Analyse einer Fabel eingehst. Schreibe dein FB unter seinen/ihren Text.
EA: Überarbeite deine Analyse mit Hilfe des FB.
DO, 24/01
EA/PA: Überarbeite(t) die Analyse!
PA: Gib deinem Nachbarn ein Feedback, indem du Fehler in seinem Text fett markierst und auf die Kriterien einer Analyse einer Fabel eingehst. Schreibe dein FB unter seinen/ihren Text.
EA: Überarbeite deine Analyse mit Hilfe des FB.
FR, 25/01
BJSP? - Pseudonyme - FST-Liste (Alina)
SV: W. Busch, Ein dicker Sack
SV/UG: Auswertung der Analysen
EA: Überarbeitung
HA: -
MI, 30/01
Pseudonyme - 4 und 5 haben ihre HA direkt am Freitag erledigt: prima! - 10 und 15: Fehlerstatistik nachtragen! - 11: Greenscreen?
SV: W. Busch, Ein dicker Sack
SV/UG: Besprechung der mögl. Lösung (1)
SV/UG: Auswertung der (überarbeiteten) Analysen
SV: Babrius: Grille und Ameise
Babrius: Grille und Ameise
1 Im Winter schleppt' aus ihrem Loch die Ameise
2 die Körner, die sie eingesammelt im Sommer.
3 Die Grille, halb verhungert, bat sie um Hilfe,
4 ihr etwas Nahrung abzugeben zum Leben.
5 Die fragte: „Wie hast du verbracht denn den Sommer?“
6 „Ich war nicht müßig, denn die ganze Zeit sang ich“.
7 Da lachte jene, während sie ihr Korn wegschloss:
8 „Im Sommer sangst du? Nun, im Winter jetzt tanze!“
EA: Bearbeite den Text!
UG: Erste Eindrücke
HA: Analysiere die Fabel mit Hilfe der dir bekannten Gesichtspunkte, und laden deinen Text hoch auf diese Seite!
FR, 01/02
Elternbrief - SV: Babrius, Grille und Ameise
SV/UG: Auswertung der HA
PA: Gib deinem Nachbarn ein schriftliches FB, indem du Fehler in seinem Text fett markierst sowie mit Hilfe der Kriterien zur Analyse einer Fabel einen detaillierten und konkreten Kommentar anfügst!
HA: Überarbeitung mit Hilfe des FB
MI, 06/02
SV: Babrius, Grille und Ameise
SV/UG: Auswertung der (überarbeiteten) HA
LV/UG: ZITIEREN - Bitte kopiert euch die folgenden Hinweise und sichert die Datei!
HINWEISE ZUR VERWENDUNG VON ZITATEN IN DER ANALYSE LITERARISCHER TEXTE
Zitate sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Textanalyse. Nur eine Deutung, die schlüssig aus dem Text hergeleitet wird, ist für den Leser nachvollziehbar. In der schriftlichen Interpretation sind Zitate gleichsam das „Material“, an dem interpretiert wird. Somit dienen Zitate nicht der „Illustration“ der Darstellung oder dem bloßen Verweis auf den zu interpretierenden Text. Vielmehr haben Zitate die zentrale Funktion, Deutungen zu ermöglichen und für den Leser überzeugend zu belegen. Im Folgenden werden die wichtigsten Regeln zur Zitierweise, zur Verwendung von Zitaten und zur Auswertung von Zitaten vorgestellt.
I. ZITIERWEISE
Grundsätze zum korrekten Umgang mit dem Text
1. Grundsatz: Zitate müssen korrekt sein!
a) Zitate müssen den korrekten Wortlaut des Textes wiedergeben. Alle wörtlichen Zitate sind in Anführungszeichen zu setzen. Auslassungen, Änderungen und Hinzufügungen sind durch eckige Klammern zu kennzeichnen. b) Auslassungen sind nur dann zulässig, wenn es sich dabei um Textelemente handelt, die für die nachfolgende Ausdeutung unerheblich sind. In der Regel werden nur Auslassungen innerhalb eines Zitats gekennzeichnet, während ausgelassene Satzanfänge und Satzenden nicht gekennzeichnet werden. c) Zitatänderungen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn sie aus syntaktischen Gründen unvermeidbar sind. Solche Änderungen dürfen den Sinn des Textes nicht entstellen. Damit der originale Text erkennbar bleibt, sollten syntaktisch verzichtbare Änderungen vermieden werden. d) Hinzufügungen des Verfassers sind nur dann sinnvoll, wenn sie für das Verständnis des Zusammenhangs zwingend erforderlich sind. e) Wird ein ganzer Satz zitiert, dann entfällt der Punkt als Satzzeichen innerhalb des Zitats. Ausrufezeichen und Fragezeichen müssen jedoch in das Zitat eingeschlossen werden.
TEXTBEISPIEL: Lessing (1729-1781): Der Besitzer des Bogens
Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebenholz, mit dem er sehr weit und sehr sicher schoss, und den er ungemein wert hielt. Einst aber, als er ihn aufmerksam betrachtete, sprach er: „Ein wenig zu plump bist du doch! Alle deine Zierde ist die Glätte. Schade!“ - Doch dem ist abzuhelfen, fiel ihm ein. Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnitzen lassen. - Er ging hin; und der Künstler schnitzte eine ganze Jagd auf den Bogen; und was hätte sich besser auf einen Bogen geschickt, als eine Jagd? Der Mann war voller Freuden. „Du verdienest diese Zieraten, mein lieber Bogen!“ - Indem will er ihn versuchen; er spannt, und der Bogen - zerbricht.
UMSETZUNGEN
Zu 1a) Durch den Hinweis, der Bogen sei „von Ebenholz" (Z. 1), wird die wertvolle Substanz des Besitztums bereits zu Beginn des Textes betont. Zu 1b) Der große praktische Nutzen für seinen Besitzer kommt zum Ausdruck, insofern gesagt wird, es handle sich um einen „trefflichen Bogen […], mit dem er sehr weit und sehr sicher" (Z. 1) zu schießen vermag. Zu 1c) Wenn der Besitzer in der Eingangsformulierung als „[e]in Mann"(Z. 1) bezeichnet wird, verweist die Verwendung des unbestimmten Artikels auf den parabolischen Charakter der Darstellung. Zu 1d) Dass dem Besitzer der praktische Nutzen doch nicht ausreicht, kommt zum Ausdruck, wenn er konstatiert: „Alle deine [gemeint ist der Bogen] Zierde ist die Glätte“ (Z. 2 f.). Zu 1e) Sein Missvergnügen an dieser Situation bringt der Besitzer zur Geltung durch den abschließenden Ausruf „Schade!" (Z. 3)
2. Grundsatz: Zitate müssen korrekt nachgewiesen werden!
a) Zitate werden in der Regel durch Angabe der Seite und/oder Zeile (je nach Textvorlage) in runden Klammern hinter dem Zitat nachgewiesen. b) Endet ein Satz mit dem Zitatnachweis, dann steht der Satzpunkt hinter dem Zitatnachweis. c) In seltenen Fällen kann ein Zitatnachweis auch in der Zitateinleitung geliefert werden, nämlich dann, wenn es der Zusammenhang erfordert oder wenn die Formulierung variiert werden soll. d) Neben wörtlichen Zitaten sind (in sehr begrenztem Maße) auch indirekte Zitate möglich. Der indirekte Bezug auf eine Textstelle wird durch (vgl. ...) belegt. Indirekte Zitate verweisen lediglich auf den Text und haben deshalb nur schwachen Belegcharakter. Sie können jedoch sinnvoll sein, um eine Interpretation zu bekräftigen, die an der Auswertung wörtlicher Zitate gewonnen wurde.
UMSETZUNG
Zu 2d) Bemerkenswert erscheint, dass die wörtliche Rede mit diesem Befund endet (vgl. Z. 3). Der anschließende Gedankenstrich verweist auf einen Bruch in der Darstellung.
II. ZUR VERWENDUNG VON ZITATEN Grundsätze zur Auswahl, Integration und Platzierung von Zitaten
1. Grundsatz: Zitate müssen angemessen ausgewählt und platziert worden!
a) Als Zitate sind aussagekräftige Textstellen zu verwenden, die eine schlüssige Interpretation im Zusammenhang des Gesamttextes ermöglichen. Zitate dokumentieren die Detailwahrnehmung des Texten im Sinne einer hermeneutischen Literaturbetrachtung. Die Unterscheidung zwischen zentralen und weniger zentralen Textphänomenen ist natürlich nicht immer leicht. Wer sich dabei von dem hermeneutischen Grundsatz leiten läset, das Einzelne aus dem Allgemeinen und das Allgemeine aus dem Einzelnen zu verstehen, wird den richtigen Weg finden.
b) Da Zitate - wie oben erwähnt - die Detailbetrachtung des Textes dokumentieren, gehören sie in den Hauptteil, nicht in die Einleitung.
c) Eine Interpretation kann nur durch eine angemessene Anzahl von Zitaten überzeugend wirken. Eine Faustregel ist hier kaum anzugeben. „Verdächtig“ wird eine Darstellung jedoch spätestens dann, wenn innerhalb einer Spalte (des Hauptteils) gar nicht zitiert wird. Ein 40-zeiliger Text kann ohne 20 Zitate kaum angemessen interpretiert werden.
UMSETZUNG Zu 1a) Die Tatsache, dass er „den besten Künstler" (Z. 3) mit der Verzierung beauftragt, bezeugt die hohe Anspruchshaltung des Besitzers.
2. Grundsatz: Zitate müssen korrekt an die Darstellung angebunden werden!
a) Zitate müssen syntaktisch und semantisch korrekt mit der Darstellung verknüpft werden. Unvermitteltes „Einstreuen“ von Zitaten ist unbedingt zu vermeiden.
b) Satzglieder, die zitiert werden sollen, müssen korrekt in die Syntax der Darstellung eingefügt werden. Die Satzgliedbezeichnung ist zu benennen.
c) Werden einzelne Wörter zitiert, so ist in der Regel deren Wortart und/oder deren rhetorische Funktion zu benennen.
d) Verben und Adjektive müssen im Allgemeinen in der Grundform zitiert werden.
e) Neben der unmittelbaren Integration in die Syntax des Satzes können Zitate in bestimmten Fällen durch einen Doppelpunkt vom eigenen Text abgetrennt werden. Dies ist vor allem beim Zitieren wörtlicher Rede möglich, außerdem auch beim Zitieren von Aufzählungen und Beschreibungen. Auch diesen Zitaten muss jedoch eine syntaktisch korrekte Einleitung vorausgehen.
UMSETZUNGEN Zu 2a) Dass der Künstler "eine ganze Jagd" (Z. 4) als Zierat für den Bogen vorsieht, hebt die Vermessenheit dieser Handlung hervor. Zu 2b) Nach der Vollendung der künstlerischen Arbeiten wendet der Besitzer sich „voller Freuden" (Z. 5) seinem Bogen zu. Das Modaladverbial bringt einerseits das Vergnügen an der Erfüllung seiner Erwartungshaltung, im Kontext der weiteren Darstellung aber auch eine Verkennung der Realität zum Ausdruck. Zu 2c) Die spezifische Art der Personifikation in der Anrede des Bogens durch das Possessivpronomen „mein" (Z.8) und das Adjektiv "lieb" (ebd.) bezeugt, dass der Mann über den Bogen als über seinen Besitz willkürlich verfügen zu können glaubt. Wenn der Besitzer nunmehr bemerkt, der Bogen verdiene die "Zieraten" (Z. 5), so verweist das hier verwendete Nomen auf die vermeintlich gesteigerte Wertigkeit des Besitztums. Zu 2d) Die Verwendung der Verben „versuchen" (Z.6), „spannen" und „zerbrechen" (ebd.) im Kontext der Darstellung der Zerstörung des Bogens desavouiert diese Einschätzung als Irrtum.
III. AUSWERTUNG VON ZITATEN
1. Die Paraphrasierung eines Zitats ist in der Regel völlig überflüssig. Paraphrasierungen wirken zumeist stilistisch unschön und unbeholfen. Keinesfalls kann eine inhaltliche Wiedergabe die Deutung eines Zitats ersetzen.
2. Jedes Zitat muss gedeutet werden. Dabei ist das hermeneutische Prinzip unbedingt zu beachten. Die Auslegung jeder einzelnen Textstelle muss mit dem Zusammenhang korrespondieren und mit der erfassten Gesamtintention übereinstimmen.
3. Die Deutung von Zitaten zielt auf das, was der Text gleichsam unter der Oberfläche der jeweiligen Aussagen und Formulierungen zeigt. Bei der Deutung sind grundsätzlich inhaltliche, formale und sprachliche Aspekte zu berücksichtigen. Die Gewichtung dieser Aspekte richtet sich jedoch nach der jeweiligen Textstelle.
5. Die Auslegung eines Zitats erfordert in aller Regel mehr Raum als das Zitat selbst. Auf zusammenhängende, präzise, schlüssige und nachvollziehbare Darstellung muss geachtet werden.
6. Nur eine klare und entschiedene Deutung kann überzeugend sein. Vage Formulierungen, Vermutungen und Spekulationen sind zu vermeiden. Lässt ein Zitat mehrere Auslegungen zu, dann ist in der Regel der kontextuell überzeugenderen Deutung Vorrang einzuräumen. Eine Ausnahme bilden solche Textstellen, die intentional auf Mehrdeutigkeit angelegt sind. Ist dies der Fall, dann geht es in der Deutung darum, die in der Textstelle angelegte Spannung unterschiedlicher, möglicherweise gegensätzlicher Interpretationsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Auch dabei darf jedoch der Bezug zur Gesamtintention nicht verloren gehen.