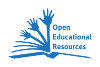Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Benutzer:LDümmer: Unterschied zwischen den Versionen
(→August Stramm: Untreu) |
(→Lyrik) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== ''Inhaltsangabe Faust'' === | === ''Inhaltsangabe Faust'' === | ||
| − | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Faust“ handelt es sich um den ersten Teil der gleichnamigen Tragödie, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahre 1808. Die Handlung setzt mit einer Wette zwischen Gott und dem Teufel, der hier als Mephistopheles bezeichnet wird, ein. Die Wette besteht darin, dass Mephistopheles versuchen will Faust, einen Doktor der immer auf dem rechten Weg gewandert ist und sein Leben der Wissenschaft verschrieben hat, von diesem Weg abzubringen. Gott ist sich seines Sieges bewusst und lässt ihn daher gewähren. Heinrich Faust ist ein verzweifelter Wissenschaftler, der zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er nicht alles Wissen kann. Während eines Spaziergangs begegnet er einem Hund, den er mit nach Hause nimmt. Der Hund jedoch gibt sich bald als Mephistopheles zu erkennen und schließt mit Faust einen Pakt: Wenn er es schafft Faust vollends glücklich zu machen erhält er dessen Seele. Zunächst versucht Mephistopheles Faust, der den Pakt eingegangen ist, Freude zu bereiten, doch bereits beim ersten Versuch scheitert er. Als nächstes ermutigt er Faust einen Trank zu nehmen, der ihn jünger macht. Infolge dessen begegnet Faust Gretchen, in die er sich verliebt. Mit der Hilfe Mephistopheles gelangt er in ihr Schlafzimmer und schenkt ihr Schmuck. Gretchen, die ihrer Nachbarin davon berichtet, zeigt ebenfalls Interesse an Faust. Während des Gespräches erscheint Mephistopheles bei der Nachbarin, um ihr mitzuteilen dass ihr Mann verstorben ist. Diese wiederum lädt Mephistopheles und Faust für den Abend ein, damit Gretchen sich mit Faust unterhalten kann. Gretchen und Faust verlieben sich ineinander und es kommt zum ersten Kuss. Faust verführt Gretchen dazu ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Gretchens Mutter stirbt jedoch an dem Trank. In der darauf folgenden Nacht kehrt Gretchens Bruder Valentin nach Hause zurück und fordert Faust zu einem Duell heraus. Faust gewinnt das Duell und tötet Valentin. Daraufhin muss dieser fliehen und lässt Gretchen zurück. Auf der Flucht versucht Mephistopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust hat unterdessen eine Erscheinung, dass Gretchen in Gefahr ist und kehrt zurück um sie zu retten. Er findet sie im Kerker, wo sie ihm gesteht, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die Tragödie endet damit, dass Gott Gretchen im Himmel aufnimmt | + | Bei dem vorliegenden [[Benutzer:LDümmer/neu|Text]] mit dem Titel „Faust“ handelt es sich um den ersten Teil der gleichnamigen Tragödie, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahre 1808. Die Handlung setzt mit einer Wette zwischen Gott und dem Teufel, der hier als Mephistopheles bezeichnet wird, ein. Die Wette besteht darin, dass Mephistopheles versuchen will Faust, einen Doktor der immer auf dem rechten Weg gewandert ist und sein Leben der Wissenschaft verschrieben hat, von diesem Weg abzubringen. Gott ist sich seines Sieges bewusst und lässt ihn daher gewähren. Heinrich Faust ist ein verzweifelter Wissenschaftler, der zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er nicht alles Wissen kann. Während eines Spaziergangs begegnet er einem Hund, den er mit nach Hause nimmt. Der Hund jedoch gibt sich bald als Mephistopheles zu erkennen und schließt mit Faust einen Pakt: Wenn er es schafft Faust vollends glücklich zu machen erhält er dessen Seele. Zunächst versucht Mephistopheles Faust, der den Pakt eingegangen ist, Freude zu bereiten, doch bereits beim ersten Versuch scheitert er. Als nächstes ermutigt er Faust einen Trank zu nehmen, der ihn jünger macht. Infolge dessen begegnet Faust Gretchen, in die er sich verliebt. Mit der Hilfe Mephistopheles gelangt er in ihr Schlafzimmer und schenkt ihr Schmuck. Gretchen, die ihrer Nachbarin davon berichtet, zeigt ebenfalls Interesse an Faust. Während des Gespräches erscheint Mephistopheles bei der Nachbarin, um ihr mitzuteilen dass ihr Mann verstorben ist. Diese wiederum lädt Mephistopheles und Faust für den Abend ein, damit Gretchen sich mit Faust unterhalten kann. Gretchen und Faust verlieben sich ineinander und es kommt zum ersten Kuss. Faust verführt Gretchen dazu ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Gretchens Mutter stirbt jedoch an dem Trank. In der darauf folgenden Nacht kehrt Gretchens Bruder Valentin nach Hause zurück und fordert Faust zu einem Duell heraus. Faust gewinnt das Duell und tötet Valentin. Daraufhin muss dieser fliehen und lässt Gretchen zurück. Auf der Flucht versucht Mephistopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust hat unterdessen eine Erscheinung, dass Gretchen in Gefahr ist und kehrt zurück um sie zu retten. Er findet sie im Kerker, wo sie ihm gesteht, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die Tragödie endet damit, dass Gott Gretchen im Himmel aufnimmt. |
| − | + | ||
=== ''Faust: "Nacht" V.353-385'' === | === ''Faust: "Nacht" V.353-385'' === | ||
| − | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Faust“ handelt es sich um einen Auszug aus dem ersten Teil der gleichnamigen Tragödie, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahre 1808. Thematisiert wird das Streben nach dem Unerreichbaren. Protagonist der Handlung ist der Wissenschaftler Heinrich Faust, der zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er nicht alles Wissen kann. Wenig später begegnet Faust dem Teufel Mephistopholes und lässt sich mit diesem auf einen Pakt ein: Wenn er es schafft Faust vollends glücklich zu machen erhält er dessen Seele. Während Mephistopheles versucht seinen Teil der Abmachung zu erfüllen verliebt sich Faust in Gretchen. Gretchen, die ebenfalls Interesse an Faust zeigt, lässt sich von diesem verführen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Die Mutter jedoch stirbt an dem Trank und Gretchens Bruder wird von Faust im Duell getötet, woraufhin dieser fliehen muss und Gretchen zurücklässt. Auf der Flucht versucht Mephistopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust jedoch kehrt zu Gretchen zurück und findet diese im Kerker, wo sie ihm gestehet, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. | + | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Faust“ handelt es sich um einen Auszug aus dem ersten Teil der gleichnamigen Tragödie, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahre 1808. Thematisiert wird das Streben nach dem Unerreichbaren. |
| − | Die zu analysierende Textstelle setzt ein mit dem Ausruf Fausts: „Habe nun, ach! Philosophie,/ Juristerei und Medizin“ (V.354 f.). Die Anzahl der Studienfächer kennzeichnet Faust als eine gelehrte Person. Auffällig ist jedoch die Interjektion „ach!“ (ebd.), welche trotz des hohen Wissensstandes eine gewisse Unzufriedenheit in Bezug auf die Studienfächer verdeutlicht. Faust ergänzt die Studienfächer um ein weiteres mit der Aussage: „Und leider auch Theologie“ (V.365). Das Adverb „leider“ (ebd.) in Bezug auf das Studium der Theologie verdeutlicht die Unzufriedenheit Fausts. Die Theologie steht generell im Kontrast zu den anderen Studienfächern, da es sich bei diesen um faktenbasierte Wissenschaften handelt und diese nicht, wie die Theologie unlösbare Fragen aufwerfen. Faust selbst berichtet, er habe „mit heißem Bemühen [studiert]“ (V. 357). Der Ausdruck „mit heißem Bemühen“ (ebd.) ist eine unreine Synästhesie, welche verdeutlichen soll wie intensiv und ehrgeizig Faust in seinem Studium vorgegangen ist. Im weiteren Verlauf erklärt Faust: „Da steh ich nun, ich armer Tor!/ Und bin so klug als wie zuvor“ (V. 358 f.). Die beiden Aussagen stehen im Gegensatz zu einander, da Faust sich in der ersten Aussage als „armer Tor“ (V.358) beschreibt und in der zweiten Aussage erläutert, er sei „so klug als wie zuvor“ (V.359). Zuvor hat Faust ganze vier Fächer studiert und bezeichnet sich dennoch als einen armen Narren. Diese Aussagen sind ebenfalls als Unzufriedenheit Fausts zu interpretieren. Als nächstes berichtet er, er„heiße Magister“ (V.360) und er „heiße Doktor“ (ebd.), damit sind die akademischen Titel gemeint, die er während seines intensiven Studiums errungen hat und die seinen Erfolg als Wissenschaftler verdeutlichen sollen. In den folgenden Versen wird erläutert, dass Faust bereits seit mehreren Jahren Lehrer ist und seine Schüler „an der Nase herum[führt]“ (V. 363), was bedeutet, dass er seinen Schülern aus seiner Sicht nichts Sinnvolles beibringt und im Zusammenhang mit der Unzufriedenheit am Anfang der Textstelle steht. In den Jahren als Lehrer ist er ebenfalls zu der Erkenntnis gekommen, „dass wir nichts wissen können“ (V. 364). Diese Erkenntnis vertrat ursprünglich der griechische Philosoph Sokrates, welcher versuchte damit zu verdeutlichen, dass wir Menschen so bedeutungslos im Universum sind, sodass wir nichts wissen können. Nach dieser Erkenntnis ist Faust so verzweifelt, dass es ihm „schier das Herz verbrenn[t]“ (V. 365). Faust bezeichnet sich selbst als „gescheiter als alle die Laffen,/ Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen“ (V.366 f.), was eine gewisse Arroganz verdeutlicht, da er sich selbst über Gelehrte und Priester stellt. Untermauert wird dies ebenfalls durch die Aussagen: „Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel“ (V. 368) und „Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel“ (V.369), wobei letzteres ebenso eine Vorrausdeutung für die zukünftige Handlung ist. Seine Verzweiflung wird ebenfalls darin bestätigt, dass ihm „alle Freud entrissen [wurde]“ (V.370). Die folgende Anapher: „Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,/ Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren“ (V. 371 f.) steht im Kontrast zu den vorherigen Aussagen, da Faust dort erwähnte, dass er sehr gebildet ist und seit Jahren Schüler unterrichtet. Er habe zudem „weder Gut noch Geld, Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt“ (V. 374), was veranschaulicht, dass er seiner Ansicht nach nichts Weiteres als unnützes Wissen besitzt. Aus diesem Grund habe er sich, seiner Aussage nach „der Magie ergeben“ (V. 377), damit ihm „durch Geistes Kraft und Mund/ Nicht manch Geheimnis würde kund“ (V. 378 f.) und er „nicht mehr, mit saurem Schweiß,/ Zu sagen brauche was [er] nicht weiß“ (V. 380 f.). Faust, dem es missfällt nicht alles wissen zu können, versucht nun in der Magie nach antworten zu suchen. Die Metapher „saure[r] Schweiß“ (V. 380) verdeutlicht ebenfalls die Unzufriedenheit Fausts. Auffällig ist, dass die Magie im Gegensatz zu den Studienfächern zu Beginn der Textstelle nicht in irgendeiner Form belegbar ist und es Faust somit nicht möglich wäre sein Wissen, welches er durch die Magie erlangt, in wissenschaftlicher Form zu erklären oder anderen glaubhaft zu vermitteln. Im weiteren Verlauf wird Fausts Wunsch, „dass [er] erkenn[t], was die Welt/ Im Innersten zusammenhält“ (V. 382 f.). Die Textstelle endet mit der Aussage: „Schau alle Wirkenskraft und Samen,/ Und tu nicht mehr in Worten kramen“ (V. 384 f.). Er legt dar, dass er erkennen möchte was die Welt antreibt, anstatt zu versuchen es irgendwie zu erklären, was an der Metapher „alle Wirkenskraft und Samen“ (V. 384) veranschaulicht wird. | + | |
| − | Zum Schluss ist zusammenzufassen, dass Faust aufgrund seiner Erkenntnis, nicht alles wissen zu können, verzweifelt und unzufrieden ist. Diese Tatsache impliziert in ihm den Wunsch zu sehen wie die Welt funktioniert, dies ist ihm jedoch mit gewöhnlichen Methoden nicht möglich, weshalb er sich der Magie zuwendet. | + | Protagonist der Handlung ist der Wissenschaftler Heinrich Faust, der zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er nicht alles Wissen kann. Wenig später begegnet Faust dem Teufel Mephistopholes und lässt sich mit diesem auf einen Pakt ein: Wenn er es schafft Faust vollends glücklich zu machen erhält er dessen Seele. Während Mephistopheles versucht seinen Teil der Abmachung zu erfüllen verliebt sich Faust in Gretchen. Gretchen, die ebenfalls Interesse an Faust zeigt, lässt sich von diesem verführen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Die Mutter jedoch stirbt an dem Trank und Gretchens Bruder wird von Faust im Duell getötet, woraufhin dieser fliehen muss und Gretchen zurücklässt. Auf der Flucht versucht Mephistopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust jedoch kehrt zu Gretchen zurück und findet diese im Kerker, wo sie ihm gestehet, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. |
| − | + | ||
| + | Die zu analysierende Textstelle setzt ein mit dem Ausruf Fausts: „Habe nun, ach! Philosophie,/ Juristerei und Medizin“ (V.354 f.). Die Anzahl der Studienfächer kennzeichnet Faust als eine gelehrte Person. Auffällig ist jedoch die Interjektion „ach!“ (ebd.), welche trotz des hohen Wissensstandes eine gewisse Unzufriedenheit in Bezug auf die Studienfächer verdeutlicht. Faust ergänzt die Studienfächer um ein weiteres mit der Aussage: „Und leider auch Theologie“ (V.365). Das Adverb „leider“ (ebd.) in Bezug auf das Studium der Theologie verdeutlicht die Unzufriedenheit Fausts. Die Theologie steht generell im Kontrast zu den anderen Studienfächern, da es sich bei diesen um faktenbasierte Wissenschaften handelt und diese nicht, wie die Theologie unlösbare Fragen aufwerfen. Faust selbst berichtet, er habe „mit heißem Bemühen [studiert]“ (V. 357). Der Ausdruck „mit heißem Bemühen“ (ebd.) ist eine unreine Synästhesie, welche verdeutlichen soll wie intensiv und ehrgeizig Faust in seinem Studium vorgegangen ist. Im weiteren Verlauf erklärt Faust: „Da steh ich nun, ich armer Tor!/ Und bin so klug als wie zuvor“ (V. 358 f.). Die beiden Aussagen stehen im Gegensatz zu einander, da Faust sich in der ersten Aussage als „armer Tor“ (V.358) beschreibt und in der zweiten Aussage erläutert, er sei „so klug als wie zuvor“ (V.359). Zuvor hat Faust ganze vier Fächer studiert und bezeichnet sich dennoch als einen armen Narren. Diese Aussagen sind ebenfalls als Unzufriedenheit Fausts zu interpretieren. Als nächstes berichtet er, er„heiße Magister“ (V.360) und er „heiße Doktor“ (ebd.), damit sind die akademischen Titel gemeint, die er während seines intensiven Studiums errungen hat und die seinen Erfolg als Wissenschaftler verdeutlichen sollen. In den folgenden Versen wird erläutert, dass Faust bereits seit mehreren Jahren Lehrer ist und seine Schüler „an der Nase herum[führt]“ (V. 363), was bedeutet, dass er seinen Schülern aus seiner Sicht nichts Sinnvolles beibringt und im Zusammenhang mit der Unzufriedenheit am Anfang der Textstelle steht. In den Jahren als Lehrer ist er ebenfalls zu der Erkenntnis gekommen, „dass wir nichts wissen können“ (V. 364). Diese Erkenntnis vertrat ursprünglich der griechische Philosoph Sokrates, welcher versuchte damit zu verdeutlichen, dass wir Menschen so bedeutungslos im Universum sind, sodass wir nichts wissen können. Nach dieser Erkenntnis ist Faust so verzweifelt, dass es ihm „schier das Herz verbrenn[t]“ (V. 365). Faust bezeichnet sich selbst als „gescheiter als alle die Laffen,/ Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen“ (V.366 f.), was eine gewisse Arroganz verdeutlicht, da er sich selbst über Gelehrte und Priester stellt. Untermauert wird dies ebenfalls durch die Aussagen: „Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel“ (V. 368) und „Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel“ (V.369), wobei letzteres ebenso eine Vorrausdeutung für die zukünftige Handlung ist. Seine Verzweiflung wird ebenfalls darin bestätigt, dass ihm „alle Freud entrissen [wurde]“ (V.370). Die folgende Anapher: „Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,/ Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren“ (V. 371 f.) steht im Kontrast zu den vorherigen Aussagen, da Faust dort erwähnte, dass er sehr gebildet ist und seit Jahren Schüler unterrichtet. Er habe zudem „weder Gut noch Geld, Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt“ (V. 374), was veranschaulicht, dass er seiner Ansicht nach nichts Weiteres als unnützes Wissen besitzt. Aus diesem Grund habe er sich, seiner Aussage nach „der Magie ergeben“ (V. 377), damit ihm „durch Geistes Kraft und Mund/ Nicht manch Geheimnis würde kund“ (V. 378 f.) und er „nicht mehr, mit saurem Schweiß,/ Zu sagen brauche was [er] nicht weiß“ (V. 380 f.). Faust, dem es missfällt nicht alles wissen zu können, versucht nun in der Magie nach antworten zu suchen. Die Metapher „saure[r] Schweiß“ (V. 380) verdeutlicht ebenfalls die Unzufriedenheit Fausts. Auffällig ist, dass die Magie im Gegensatz zu den Studienfächern zu Beginn der Textstelle nicht in irgendeiner Form belegbar ist und es Faust somit nicht möglich wäre sein Wissen, welches er durch die Magie erlangt, in wissenschaftlicher Form zu erklären oder anderen glaubhaft zu vermitteln. Im weiteren Verlauf wird Fausts Wunsch, „dass [er] erkenn[t], was die Welt/ Im Innersten zusammenhält“ (V. 382 f.). Die Textstelle endet mit der Aussage: „Schau alle Wirkenskraft und Samen,/ Und tu nicht mehr in Worten kramen“ (V. 384 f.). Er legt dar, dass er erkennen möchte was die Welt antreibt, anstatt zu versuchen es irgendwie zu erklären, was an der Metapher „alle Wirkenskraft und Samen“ (V. 384) veranschaulicht wird. | ||
| + | |||
| + | Zum Schluss ist zusammenzufassen, dass Faust aufgrund seiner Erkenntnis, nicht alles wissen zu können, verzweifelt und unzufrieden ist. Diese Tatsache impliziert in ihm den Wunsch zu sehen wie die Welt funktioniert, dies ist ihm jedoch mit gewöhnlichen Methoden nicht möglich, weshalb er sich der Magie zuwendet. | ||
=== ''Faust: "Gretchens Stube" V.3374-3413'' === | === ''Faust: "Gretchens Stube" V.3374-3413'' === | ||
| − | Bei dem vorliegenden Text, handelt es sich um die Szene „Gretchens Stube“ aus dem ersten Teil der Tragödie „Faust“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahr 1808. Thematisiert wird die Frage des Menschen hinsichtlich der Lebensbezüge. | + | Bei dem vorliegenden Text, handelt es sich um die Szene „Gretchens Stube“ aus dem ersten Teil der Tragödie „Faust“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahr 1808. Thematisiert wird die Frage des Menschen hinsichtlich der Lebensbezüge. |
| + | |||
Die Szene „Gretchens Stube“ beschreibt die Gefühle Gretchens für Faust. Faust, der zu Beginn der Tragödie erkannt hat, dass er nicht in der Lage ist alles zu wissen und aus diesem Grund einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles eingegangen ist, welcher ihm versprach ihn für den Preis seiner Seele vollends glücklich zu machen. Mephistopheles ist mit seinen Versuchen Faust glücklich zu machen gescheitert bis dieser Gretchen traf. Gretchen lässt sich von Faust verführen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Die Mutter jedoch stirbt an dem Trank und Gretchens Bruder wird von Faust im Duell getötet, woraufhin dieser fliehen muss und Gretchen zurücklässt. Auf der Flucht versucht Mephisopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust jedoch kehrt zu Gretchen zurück und findet diese im Kerker, wo sie ihm gesteht, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die Szene ist insofern für die Handlung wichtig, als dass das Interesse Gretchens, auf welchem die Liebesgeschichte zwischen ihr und Faust beruht, verdeutlicht wird. | Die Szene „Gretchens Stube“ beschreibt die Gefühle Gretchens für Faust. Faust, der zu Beginn der Tragödie erkannt hat, dass er nicht in der Lage ist alles zu wissen und aus diesem Grund einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles eingegangen ist, welcher ihm versprach ihn für den Preis seiner Seele vollends glücklich zu machen. Mephistopheles ist mit seinen Versuchen Faust glücklich zu machen gescheitert bis dieser Gretchen traf. Gretchen lässt sich von Faust verführen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Die Mutter jedoch stirbt an dem Trank und Gretchens Bruder wird von Faust im Duell getötet, woraufhin dieser fliehen muss und Gretchen zurücklässt. Auf der Flucht versucht Mephisopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust jedoch kehrt zu Gretchen zurück und findet diese im Kerker, wo sie ihm gesteht, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die Szene ist insofern für die Handlung wichtig, als dass das Interesse Gretchens, auf welchem die Liebesgeschichte zwischen ihr und Faust beruht, verdeutlicht wird. | ||
| − | Der Monolog Gretchens, welcher in Form eines Liedes verfasst ist, lässt sich in drei Sinnabschnitte gliedern, die formal durch den Refrain voneinander getrennt sind. Das Lied setzt mit dem Refrain ein, somit bilden die Strophen zwei und drei einen Sinnabschnitt, in dem Gretchen ihre eigenen Gefühle beschreibt. Der darauf folgende zweite Sinnabschnitt erstreckt sich über die Strophen fünf, sechs und sieben, da die vierte Strophe wieder den Refrain beinhaltet. Thematisiert wird diesmal allerdings Faust und die Abhängigkeit Gretchens von diesem. Der letzte Sinnabschnitt ist nach dem Refrain in der achten Strophe zu verorten und legt Gretchens Wünsche und Sehnsüchte dar. Insgesamt umfasst das Lied zehn Strophen zu je vier Versen. Das Metrum wird durch zwei- und dreihebige Jamben gekennzeichnet. Als Reimschema liegen hauptsächlich unterbrochene Kreuzreime vor, aber auch vollständige Kreuzreime und Paarreime sind zu finden. | + | |
| − | Die zu analysierende Textstelle setzt mit der Aussage Gretchens: „Meine Ruh ist hin“ (V.3374) ein. Diese Aussage ist auf die vorherigen Ereignisse, wie dem Tod der Mutter und die erste Begegnung mit Faust, zu beziehen. Da all diese Ereignisse mit Menschen in Verbindung stehen, die Gretchen viel bedeuten und ihre Familie bildeten, ist diese nun innerlich erschüttert und auf sich selbst gestellt. Ebenfalls klagt sie „[ihr] Herz ist schwer“ (V. 3375), was veranschaulicht, dass sie sehr unter der Trennung von Faust leidet. Die darauf folgende Äußerung: „Ich finde sie nimmer / und nimmermehr“ (V. 3376 f.) verdeutlicht in Bezug auf ihre innere Unruhe und die Trennung von Faust, dass sie sich der Endgültigkeit ihrer Gefühle Faust betreffend sicher ist. Dies wird ebenfalls zu Beginn der zweiten Strophe aufgegriffen, in der sie behauptet: „Wo ich ihn nicht hab, / Ist mir das Grab“ (V. 3379 f.). Gretchen sieht demnach keinerlei Sinn ohne Faust weiter zu leben, ihr Leben ist dementsprechend abhängig von ihm. Der Ausdruck: „Die ganze Welt / ist mir vergällt“ (V. 3380 f.) ist ebenfalls auf diesen Umstand zu beziehen und bestätigt, dass ihr ohne die Anwesenheit des Geliebten die Lebensfreude fehlt. Auffällig in der zweiten Strophe ist ebenfalls, dass diese die einzige Strophe des Liedes ist in der Paarreime eingesetzt wurden. Die Paarreime sollen daher abermalig die Beziehung zu Faust aufgreifen. Die dritte Strophe schließt sich thematisch unmittelbar der zweiten an, da Bezeichnungen, wie „Mein armer Kopf / ist mir verrückt“ (V. 3382 f.) und „Meiner armer Sinn / Ist mir zerstückt“ (V.3384 f.) die Bedeutung Fausts für Gretchen ein weiteres Mal unterstreichen. Zudem bilden beide Bezeichnungen einen Parallelismus, der die Endgültigkeit entsprechend Gretchens Ansicht ihre Gefühle betreffend aufzeigt. Im Gegensatz zur zweiten Strophe ist die dritte gekennzeichnet durch unterbrochene Kreuzreime, welche an die innere Unruhe Gretchens zu Beginn anknüpfen und somit die Überleitung zum Refrain,der diese Unruhe erläutert. Die fünfte Strophe setzt ein mit der Aussage: „Nach ihm nur schau ich / Zum Fenster hinaus“ (V. 3390 f.), welche darlegen soll, dass sie ihre Umwelt gar nicht mehr wahrnimmt, sondern nur Faust noch für sie von Bedeutung ist. Diese Strophe ist ebenso wie die dritte mit einem Parallelismus versehen, der die Verse gegenseitig in Verbindung setzt. Die Strophe endet daher mit der Aussage: „Nach ihm nur geh ich / Aus dem Haus“ (V. 3392 f.). Der Parallelismus ist ebenfalls wie in der dritten Strophe mit der Endgültigkeit bezüglich Gretchens Gefühlen zu deuten. In der sechsten und siebten Strophe wird Faust näher beschrieben. Sie erwähnt „Sein[en] holde[n] Gang, / Sein[e] edle Gestalt, / Seines Mundes Lächeln [und] / Seiner Augen Gewalt“ (V. 3394 ff.). Insgesamt ist diesen Beschreibungen die Tatsache zu entnehmen, dass ihre Gefühle für Faust sehr stark sind. Weiterhin beschreibt Gretchen Fausts Rede als „Zauberfluss“ (V. 3399) und schwärmt von „Sein[em] Händedruck“ (V. 3400) und „sein[em] Kuss“ (V. 3401). Die beiden Strophen bilden einen zusammenhängenden Satz, der mit einem Ausrufezeichen endet und somit die Bedeutung Fausts für Gretchen in Form der Schwärmereien verdeutlicht. In der achten Strophe folgt ein drittes Mal der Refrain des Liedes. Die letzten beiden Strophen sind ebenfalls durch einen zusammenhängenden Satz verbunden. Dem Beginn der neunten Strophe ist zu entnehmen, dass die letzten beiden Strophen Gretchens Sehnsüchte und Wünsche darstellen. Die Strophe setzt ein mit dem Ausdruck: „Mein Busen drängt / Sich nach ihm hin“ (V. 3406 f.), welcher im Gegensatz zu Gretchens vorherigem tugendhaften Verhalten steht. Dies wird ebenfalls im weiteren Verlauf der Strophe: „Ach dürft ich fassen / Und halten ihn“ (V. 3408 f.) deutlich. Auffällig ist hierbei jedoch auch der Moduswechsel von Indikativ zu Konjunktiv. Der Konjunktiv führt wiederholt die Sehnsucht nach Faust und die starken Gefühlte Gretchens vor Augen. Der Moduswechsel besteht bis zum Ende des Gedichtes und gibt, da es sich beim Konjunktiv um die Möglichkeitsform handelt, eine Vorausdeutung auf den weiteren Verlauf der Handlung. Das Lied endet mit dem Wunsch Gretchens: „Und küssen ihn, / So wie ich wollt, / An seinen Küssen / Vergehen sollt!“ (V. 3410 ff.). Das Enjambement, welches die letzten beiden Verse verbindet, deutet auf die Abhängigkeit Gretchens von Faust hin. | + | Der Monolog Gretchens, welcher in Form eines Liedes verfasst ist, lässt sich in drei Sinnabschnitte gliedern, die formal durch den Refrain voneinander getrennt sind. Das Lied setzt mit dem Refrain ein, somit bilden die Strophen zwei und drei einen Sinnabschnitt, in dem Gretchen ihre eigenen Gefühle beschreibt. Der darauf folgende zweite Sinnabschnitt erstreckt sich über die Strophen fünf, sechs und sieben, da die vierte Strophe wieder den Refrain beinhaltet. Thematisiert wird diesmal allerdings Faust und die Abhängigkeit Gretchens von diesem. Der letzte Sinnabschnitt ist nach dem Refrain in der achten Strophe zu verorten und legt Gretchens Wünsche und Sehnsüchte dar. Insgesamt umfasst das Lied zehn Strophen zu je vier Versen. Das Metrum wird durch zwei- und dreihebige Jamben gekennzeichnet. Als Reimschema liegen hauptsächlich unterbrochene Kreuzreime vor, aber auch vollständige Kreuzreime und Paarreime sind zu finden. |
| − | Zum Schluss ist festzuhalten, dass Gretchen durch ihre starken Gefühle für Faust eine Abhängigkeit von diesem entwickelt hat. Sie ist bereit selbst ihr Leben für ihn zu geben. Während seiner Abwesenheit verfällt sie einer inneren Unruhe, die teilweise das Gegenteil ihrer sonst tugendhaften Charakterzüge hervorbringt | + | |
| − | + | Die zu analysierende Textstelle setzt mit der Aussage Gretchens: „Meine Ruh ist hin“ (V.3374) ein. Diese Aussage ist auf die vorherigen Ereignisse, wie dem Tod der Mutter und die erste Begegnung mit Faust, zu beziehen. Da all diese Ereignisse mit Menschen in Verbindung stehen, die Gretchen viel bedeuten und ihre Familie bildeten, ist diese nun innerlich erschüttert und auf sich selbst gestellt. Ebenfalls klagt sie „[ihr] Herz ist schwer“ (V. 3375), was veranschaulicht, dass sie sehr unter der Trennung von Faust leidet. Die darauf folgende Äußerung: „Ich finde sie nimmer / und nimmermehr“ (V. 3376 f.) verdeutlicht in Bezug auf ihre innere Unruhe und die Trennung von Faust, dass sie sich der Endgültigkeit ihrer Gefühle Faust betreffend sicher ist. Dies wird ebenfalls zu Beginn der zweiten Strophe aufgegriffen, in der sie behauptet: „Wo ich ihn nicht hab, / Ist mir das Grab“ (V. 3379 f.). Gretchen sieht demnach keinerlei Sinn ohne Faust weiter zu leben, ihr Leben ist dementsprechend abhängig von ihm. Der Ausdruck: „Die ganze Welt / ist mir vergällt“ (V. 3380 f.) ist ebenfalls auf diesen Umstand zu beziehen und bestätigt, dass ihr ohne die Anwesenheit des Geliebten die Lebensfreude fehlt. Auffällig in der zweiten Strophe ist ebenfalls, dass diese die einzige Strophe des Liedes ist in der Paarreime eingesetzt wurden. Die Paarreime sollen daher abermalig die Beziehung zu Faust aufgreifen. Die dritte Strophe schließt sich thematisch unmittelbar der zweiten an, da Bezeichnungen, wie „Mein armer Kopf / ist mir verrückt“ (V. 3382 f.) und „Meiner armer Sinn / Ist mir zerstückt“ (V.3384 f.) die Bedeutung Fausts für Gretchen ein weiteres Mal unterstreichen. Zudem bilden beide Bezeichnungen einen Parallelismus, der die Endgültigkeit entsprechend Gretchens Ansicht ihre Gefühle betreffend aufzeigt. Im Gegensatz zur zweiten Strophe ist die dritte gekennzeichnet durch unterbrochene Kreuzreime, welche an die innere Unruhe Gretchens zu Beginn anknüpfen und somit die Überleitung zum Refrain,der diese Unruhe erläutert. Die fünfte Strophe setzt ein mit der Aussage: „Nach ihm nur schau ich / Zum Fenster hinaus“ (V. 3390 f.), welche darlegen soll, dass sie ihre Umwelt gar nicht mehr wahrnimmt, sondern nur Faust noch für sie von Bedeutung ist. Diese Strophe ist ebenso wie die dritte mit einem Parallelismus versehen, der die Verse gegenseitig in Verbindung setzt. Die Strophe endet daher mit der Aussage: „Nach ihm nur geh ich / Aus dem Haus“ (V. 3392 f.). Der Parallelismus ist ebenfalls wie in der dritten Strophe mit der Endgültigkeit bezüglich Gretchens Gefühlen zu deuten. In der sechsten und siebten Strophe wird Faust näher beschrieben. Sie erwähnt „Sein[en] holde[n] Gang, / Sein[e] edle Gestalt, / Seines Mundes Lächeln [und] / Seiner Augen Gewalt“ (V. 3394 ff.). Insgesamt ist diesen Beschreibungen die Tatsache zu entnehmen, dass ihre Gefühle für Faust sehr stark sind. Weiterhin beschreibt Gretchen Fausts Rede als „Zauberfluss“ (V. 3399) und schwärmt von „Sein[em] Händedruck“ (V. 3400) und „sein[em] Kuss“ (V. 3401). Die beiden Strophen bilden einen zusammenhängenden Satz, der mit einem Ausrufezeichen endet und somit die Bedeutung Fausts für Gretchen in Form der Schwärmereien verdeutlicht. In der achten Strophe folgt ein drittes Mal der Refrain des Liedes. Die letzten beiden Strophen sind ebenfalls durch einen zusammenhängenden Satz verbunden. Dem Beginn der neunten Strophe ist zu entnehmen, dass die letzten beiden Strophen Gretchens Sehnsüchte und Wünsche darstellen. Die Strophe setzt ein mit dem Ausdruck: „Mein Busen drängt / Sich nach ihm hin“ (V. 3406 f.), welcher im Gegensatz zu Gretchens vorherigem tugendhaften Verhalten steht. Dies wird ebenfalls im weiteren Verlauf der Strophe: „Ach dürft ich fassen / Und halten ihn“ (V. 3408 f.) deutlich. Auffällig ist hierbei jedoch auch der Moduswechsel von Indikativ zu Konjunktiv. Der Konjunktiv führt wiederholt die Sehnsucht nach Faust und die starken Gefühlte Gretchens vor Augen. Der Moduswechsel besteht bis zum Ende des Gedichtes und gibt, da es sich beim Konjunktiv um die Möglichkeitsform handelt, eine Vorausdeutung auf den weiteren Verlauf der Handlung. Das Lied endet mit dem Wunsch Gretchens: „Und küssen ihn, / So wie ich wollt, / An seinen Küssen / Vergehen sollt!“ (V. 3410 ff.). Das Enjambement, welches die letzten beiden Verse verbindet, deutet auf die Abhängigkeit Gretchens von Faust hin. | |
| + | |||
| + | Zum Schluss ist festzuhalten, dass Gretchen durch ihre starken Gefühle für Faust eine Abhängigkeit von diesem entwickelt hat. Sie ist bereit selbst ihr Leben für ihn zu geben. Während seiner Abwesenheit verfällt sie einer inneren Unruhe, die teilweise das Gegenteil ihrer sonst tugendhaften Charakterzüge hervorbringt. | ||
=== ''Faust: "Kerker" V.4580-4595'' === | === ''Faust: "Kerker" V.4580-4595'' === | ||
| − | Bei dem vorliegenden Textauszug handelt es sich um einen Teil der Szene „Kerker“ aus der Tragödie „Faust – Der Tragödie Erster Teil“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe und veröffentlicht im Jahr 1808. Die Tragödie thematisiert die Suche nach dem Sinn des Lebens. Inhaltlich handelt der Textauszug von der bevorstehenden Hinrichtung Margaretes. Die Handlung veranschaulicht zudem den Wahnsinn, dem Margarete verfallen ist, nachdem Faust sie verlassen, ihre ganze Familie tot ist und sie ihr eigenes Kind ertränkt hat, sowie ihre Akzeptanz der Todesstrafe. Der Textauszug umfasst 15 Verse. Es liegen unterschiedliche Reimschemen vor, es gibt zwei umarmende Reime, ein Kreuzreim, sowie ein Paarreim und auch zwei reimlose Verse. Das Metrum wird durch drei- bis sechshebige Trochäen gekennzeichnet. Am Ende des Verses liegen sowohl klingende als auch stumme Kadenzen vor. | + | Bei dem vorliegenden Textauszug handelt es sich um einen Teil der Szene „Kerker“ aus der Tragödie „Faust – Der Tragödie Erster Teil“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe und veröffentlicht im Jahr 1808. Die Tragödie thematisiert die Suche nach dem Sinn des Lebens. Inhaltlich handelt der Textauszug von der bevorstehenden Hinrichtung Margaretes. |
| + | |||
| + | Die Handlung veranschaulicht zudem den Wahnsinn, dem Margarete verfallen ist, nachdem Faust sie verlassen, ihre ganze Familie tot ist und sie ihr eigenes Kind ertränkt hat, sowie ihre Akzeptanz der Todesstrafe. Der Textauszug umfasst 15 Verse. Es liegen unterschiedliche Reimschemen vor, es gibt zwei umarmende Reime, ein Kreuzreim, sowie ein Paarreim und auch zwei reimlose Verse. Das Metrum wird durch drei- bis sechshebige Trochäen gekennzeichnet. Am Ende des Verses liegen sowohl klingende als auch stumme Kadenzen vor. | ||
| + | |||
Der zu analysierende Text setzt ein mit „Tag! Ja es wird Tag! Der letzte Tag dringt herein“ (V. 4580). Die Textpassage ist in einem Trikolon aufgebaut, welches die Akzeptanz ihres Todes von Seiten Gretchens veranschaulicht, da sie am nächsten Tag dem Henker vorgeführt wird. Im weiteren Verlauf erklärt sie „Mein Hochzeitstag sollt es sein“ (V. 4581), was im Kontrast zur Realität steht, da der Hochzeitstag eigentlich der glücklichste Tag im Leben sein sollte und nicht der Tag der Hinrichtung. Dies ist daher auf den Wahnsinn, dem Gretchen verfallen ist zu beziehen. Gretchen fährt fort mit dem Ausruf „Weh meinem Kranze“ (V. 4583). Gemeint ist hierbei der Hochzeitskranz, welcher traditionell am Haus des Hochzeitspaares angebracht wurde um diesem Glück zubringen. Der Hochzeitskranz bildet somit ebenfalls eine Antithese zur Hinrichtung. Mit der Aussage „Es ist eben geschehen“ (V. 4584) wechselt Gretchen vom Hochzeitstag zum Todestag, was die Endgültigkeit dieses Tages und den Wahnsinn dem Gretchen verfallen ist wiederholt vor Augen führt. Im weiteren Verlauf verspricht sie Faust „Wir werden uns wiedersehen“ (V. 4585), womit sie ihm die Möglichkeit auf ein Treffen nach dem Tod in Aussicht stellt und sich somit vorläufig von ihm verabschiedet. Im Kontrast dazu steht der Zusatz „Aber nicht beim Tanze“ (V.4586). Der vorhin erwähnte Tanz ist in diesem Zusammenhang der Hochzeitstanz, der von dem frisch verheirateten Paar getanzt wird. Gretchen erklärt Faust somit indirekt, dass sie ihn nicht heiraten wird, zum einen nicht, weil sie am kommenden Tag getötet wird und zum anderen will sie ihn nicht heiraten oder generell mit ihm zusammen sein, da alles Schreckliche was ihr in der letzten Zeit geschehen ist mit Faust zusammenhängt. Im weiteren Verlauf beschreibt Gretchen „Die Menge drängt sich, man hört sie nicht“ (V.4587), womit sie nun final ihre Hinrichtung thematisiert. Die stumme Menge (vgl. V.4587) steht hier für das Publikum, das damals bei der Hinrichtung zugegen war. Selbst „Der Platz [und] die Gassen / Können sie nicht fassen“ (V. 4588 f.) veranschaulicht, dass zahlreiche Menschen bei einer Hinrichtung erscheinen und Gretchen dies nicht angenehm ist, da es normalerweise nicht ihrem Charakter entspricht sich auffällig in der Gesellschaft zu verhalten. Ihre Erzählung fährt fort mit „Die Glocke ruft, dass Stäbchen bricht“ (V. 4590). Bei einer Hinrichtung wurde in der Regel das Armesünderglöcklein geläutet und über dem Haupt des Hinzurichtenden zerbrach der Richter als Zeichen der endgültigen Verurteilung ein weißes Stäbchen, das er ihm dann vor die Füße warf. Gretchens Wahnsinn lässt sich nicht nur am stetigen Wechsel zwischen Hochzeits- und Todestag belegen sondern auch an der Textpassage „Wie sie mich binden und packen“ (V. 4591), da sie nach wie vor mit Faust im Kerker steht und niemand sie fesselt oder nach ihr greift. Sie berichtet zudem „Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt“ (V.4592). Der „Blutstuhl“ (ebd.) ist eine Metapher für den Stuhl der bei der Hinrichtung verwendet wird, was zusätzlich die wenigen Stunden verdeutlicht, die noch bis zum Todeszeitpunkt vergehen werden. Dies wird ebenso an der Aussage Gretchens „So zuckt nach jedem Nacken / Die Schärfe, die nach meinem zückt“ (V. 4593 f.) ausgedrückt. Die „Schärfe“ (ebd.) steht metaphorisch für die Hinrichtung oder eben die Waffe, die dafür verwendet wird. Der Umstand, dass die Schärfe „nach jedem Nacken [zuckt]“ (V. 4593), verdeutlicht, dass jeder an Gretchens Stelle stehen könnte und sich alle Anwesenden dessen bewusst sind. Die Textstelle endet mit dem Vergleich „Stumm liegt die Welt wie das Grab“ (V. 4595) welcher verdeutlicht, dass Gretchen ihre Hinrichtung vollends akzeptiert hat und sich nicht wiedersetzt. Zudem hebt sich dieser Vers auch formal von den übrigen ab, da dieser über kein Reimschema verfügt und somit die Endgültigkeit Gretchens Hinrichtung vor Augen führt. Die wechselnden Reimschemen, die unterschiedlich langen Trochäen und die verschiedenen Kadenzen verdeutlichen wiederholt den Wahnsinn dem Gretchen verfallen ist. | Der zu analysierende Text setzt ein mit „Tag! Ja es wird Tag! Der letzte Tag dringt herein“ (V. 4580). Die Textpassage ist in einem Trikolon aufgebaut, welches die Akzeptanz ihres Todes von Seiten Gretchens veranschaulicht, da sie am nächsten Tag dem Henker vorgeführt wird. Im weiteren Verlauf erklärt sie „Mein Hochzeitstag sollt es sein“ (V. 4581), was im Kontrast zur Realität steht, da der Hochzeitstag eigentlich der glücklichste Tag im Leben sein sollte und nicht der Tag der Hinrichtung. Dies ist daher auf den Wahnsinn, dem Gretchen verfallen ist zu beziehen. Gretchen fährt fort mit dem Ausruf „Weh meinem Kranze“ (V. 4583). Gemeint ist hierbei der Hochzeitskranz, welcher traditionell am Haus des Hochzeitspaares angebracht wurde um diesem Glück zubringen. Der Hochzeitskranz bildet somit ebenfalls eine Antithese zur Hinrichtung. Mit der Aussage „Es ist eben geschehen“ (V. 4584) wechselt Gretchen vom Hochzeitstag zum Todestag, was die Endgültigkeit dieses Tages und den Wahnsinn dem Gretchen verfallen ist wiederholt vor Augen führt. Im weiteren Verlauf verspricht sie Faust „Wir werden uns wiedersehen“ (V. 4585), womit sie ihm die Möglichkeit auf ein Treffen nach dem Tod in Aussicht stellt und sich somit vorläufig von ihm verabschiedet. Im Kontrast dazu steht der Zusatz „Aber nicht beim Tanze“ (V.4586). Der vorhin erwähnte Tanz ist in diesem Zusammenhang der Hochzeitstanz, der von dem frisch verheirateten Paar getanzt wird. Gretchen erklärt Faust somit indirekt, dass sie ihn nicht heiraten wird, zum einen nicht, weil sie am kommenden Tag getötet wird und zum anderen will sie ihn nicht heiraten oder generell mit ihm zusammen sein, da alles Schreckliche was ihr in der letzten Zeit geschehen ist mit Faust zusammenhängt. Im weiteren Verlauf beschreibt Gretchen „Die Menge drängt sich, man hört sie nicht“ (V.4587), womit sie nun final ihre Hinrichtung thematisiert. Die stumme Menge (vgl. V.4587) steht hier für das Publikum, das damals bei der Hinrichtung zugegen war. Selbst „Der Platz [und] die Gassen / Können sie nicht fassen“ (V. 4588 f.) veranschaulicht, dass zahlreiche Menschen bei einer Hinrichtung erscheinen und Gretchen dies nicht angenehm ist, da es normalerweise nicht ihrem Charakter entspricht sich auffällig in der Gesellschaft zu verhalten. Ihre Erzählung fährt fort mit „Die Glocke ruft, dass Stäbchen bricht“ (V. 4590). Bei einer Hinrichtung wurde in der Regel das Armesünderglöcklein geläutet und über dem Haupt des Hinzurichtenden zerbrach der Richter als Zeichen der endgültigen Verurteilung ein weißes Stäbchen, das er ihm dann vor die Füße warf. Gretchens Wahnsinn lässt sich nicht nur am stetigen Wechsel zwischen Hochzeits- und Todestag belegen sondern auch an der Textpassage „Wie sie mich binden und packen“ (V. 4591), da sie nach wie vor mit Faust im Kerker steht und niemand sie fesselt oder nach ihr greift. Sie berichtet zudem „Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt“ (V.4592). Der „Blutstuhl“ (ebd.) ist eine Metapher für den Stuhl der bei der Hinrichtung verwendet wird, was zusätzlich die wenigen Stunden verdeutlicht, die noch bis zum Todeszeitpunkt vergehen werden. Dies wird ebenso an der Aussage Gretchens „So zuckt nach jedem Nacken / Die Schärfe, die nach meinem zückt“ (V. 4593 f.) ausgedrückt. Die „Schärfe“ (ebd.) steht metaphorisch für die Hinrichtung oder eben die Waffe, die dafür verwendet wird. Der Umstand, dass die Schärfe „nach jedem Nacken [zuckt]“ (V. 4593), verdeutlicht, dass jeder an Gretchens Stelle stehen könnte und sich alle Anwesenden dessen bewusst sind. Die Textstelle endet mit dem Vergleich „Stumm liegt die Welt wie das Grab“ (V. 4595) welcher verdeutlicht, dass Gretchen ihre Hinrichtung vollends akzeptiert hat und sich nicht wiedersetzt. Zudem hebt sich dieser Vers auch formal von den übrigen ab, da dieser über kein Reimschema verfügt und somit die Endgültigkeit Gretchens Hinrichtung vor Augen führt. Die wechselnden Reimschemen, die unterschiedlich langen Trochäen und die verschiedenen Kadenzen verdeutlichen wiederholt den Wahnsinn dem Gretchen verfallen ist. | ||
| + | |||
Zum Schluss ist festzuhalten, dass Gretchen, nach allem was vorgefallen ist, wahnsinnig geworden ist und ihre Hinrichtung akzeptiert hat, obwohl noch die Möglichkeit besteht mit Faust aus dem Kerker zu fliehen. Zentrale Sprachliche Mittel sind das Trikolon zu Beginn der Textstelle, welches die bevorstehende Hinrichtung ankündigt und die zahlreichen Metaphern und Traditionen, die in Bezug zur Hinrichtung stehen. | Zum Schluss ist festzuhalten, dass Gretchen, nach allem was vorgefallen ist, wahnsinnig geworden ist und ihre Hinrichtung akzeptiert hat, obwohl noch die Möglichkeit besteht mit Faust aus dem Kerker zu fliehen. Zentrale Sprachliche Mittel sind das Trikolon zu Beginn der Textstelle, welches die bevorstehende Hinrichtung ankündigt und die zahlreichen Metaphern und Traditionen, die in Bezug zur Hinrichtung stehen. | ||
Faust | Faust | ||
| Zeile 36: | Zeile 45: | ||
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Faust Gott sehr viel verdankt und dies in seinem Monolog auch zum Ausdruck bringt. Er ist sich der Schuld bewusst, in der er bei Gott steht, seitdem er Mephistopholes als Gefährten akzeptiert und bereut sein selbstsüchtiges Verhalten nach Vollkommenheit zutiefst. Zentrale Sprachliche Mittel des Textes sind die Interjektion zu Beginn des zweiten Abschnittes, welche den Wendepunkt in Fausts Entwicklung darstellt, und der Chiasmus am Abschluss des Textauszuges, der die Resignation Fausts zum Ende hin verdeutlicht. | Zusammenfassend ist zu sagen, dass Faust Gott sehr viel verdankt und dies in seinem Monolog auch zum Ausdruck bringt. Er ist sich der Schuld bewusst, in der er bei Gott steht, seitdem er Mephistopholes als Gefährten akzeptiert und bereut sein selbstsüchtiges Verhalten nach Vollkommenheit zutiefst. Zentrale Sprachliche Mittel des Textes sind die Interjektion zu Beginn des zweiten Abschnittes, welche den Wendepunkt in Fausts Entwicklung darstellt, und der Chiasmus am Abschluss des Textauszuges, der die Resignation Fausts zum Ende hin verdeutlicht. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=='''Woyzeck'''== | =='''Woyzeck'''== | ||
| Zeile 527: | Zeile 533: | ||
=== ''Gottfried Benn: Kleine Aster'' === | === ''Gottfried Benn: Kleine Aster'' === | ||
| − | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Kleine Aster“, verfasst von Gottfried Benn und veröffentlicht im Jahr 1912, handelt es sich um ein Gedicht aus der Zeit des Expressionismus. Thematisiert wird | + | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Kleine Aster“, verfasst von Gottfried Benn und veröffentlicht im Jahr 1912, handelt es sich um ein Gedicht aus der Zeit des Expressionismus. Thematisiert wird die Unbedeutsamkeit des Individuums in der Zeit des Expressionismus. |
Das Gedicht umfasst eine Strophe, bestehend aus 15 Versen. Es ist kein Reimschema auszumachen, zu finden sind ein einzelner Kreuzreim und ein Paarreim. Ebenso lässt sich das Gedicht durch einen freien Rhythmus kennzeichnen. | Das Gedicht umfasst eine Strophe, bestehend aus 15 Versen. Es ist kein Reimschema auszumachen, zu finden sind ein einzelner Kreuzreim und ein Paarreim. Ebenso lässt sich das Gedicht durch einen freien Rhythmus kennzeichnen. | ||
| − | Der zu analysierende Text setzt mit der Aussage „Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt“ (V. 1) ein. Die Einleitung durch den unbestimmten Artikel „[e]in“ (ebd.) in Bezug auf den ersoffenen Bierfahrer deutet auf eine emotionslose Atmosphäre hin. Diese wird durch die umgangssprachliche Bezeichnung „ersoffen[…]“ (V. 1) anstelle der formaleren und fachlichen Betitelung ertrinken. Weiterhin spielt auch der Umstand, dass die Leiche „auf den Tisch gestemmt“ (V. 1) wurde, was auf einen pietätlosen Umgang mit der Leiche hinweist, darauf an, dass die Atmosphäre, in der sich das lyrische Ich befindet sehr kalt und emotionslos ist. Im weiteren Verlauf beschreibt das lyrische Ich „Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhelllila Aster / zwischen die Zähne geklemmt“ (V. 2 f.). Parallel zum ersten Vers ist hier die Einleitung, in diesem Fall durch das Indefinitpronomen „Irgendeiner“ (V. 2), welches gleichermaßen, wie der unbestimmte Artikel, Unpersönlichkeit und somit Emotionslosigkeit verdeutlicht. Die bisher sehr sachliche Beschreibung des lyrischen Ichs wird durch das Paradoxon „dunkelhelllila“ (V. 2) in Bezug auf die Farbe der Aster unterbrochen. Das Paradoxon legt den Fokus des Lesers auf die Aster, welche einen Kontrast zu der Leiche bildet. Die Aster, die bereits im Titel des Textes erwähnt wird, | + | Der zu analysierende Text setzt mit der Aussage „Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt“ (V. 1) ein. Die Einleitung durch den unbestimmten Artikel „[e]in“ (ebd.) in Bezug auf den ersoffenen Bierfahrer deutet auf eine emotionslose Atmosphäre hin. Diese wird durch die umgangssprachliche Bezeichnung „ersoffen[…]“ (V. 1) anstelle der formaleren und fachlichen Betitelung ertrinken. Weiterhin spielt auch der Umstand, dass die Leiche „auf den Tisch gestemmt“ (V. 1) wurde, was auf einen pietätlosen Umgang mit der Leiche hinweist, darauf an, dass die Atmosphäre, in der sich das lyrische Ich befindet sehr kalt und emotionslos ist. Im weiteren Verlauf beschreibt das lyrische Ich „Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhelllila Aster / zwischen die Zähne geklemmt“ (V. 2 f.). Parallel zum ersten Vers ist hier die Einleitung, in diesem Fall durch das Indefinitpronomen „Irgendeiner“ (V. 2), welches gleichermaßen, wie der unbestimmte Artikel, Unpersönlichkeit und somit Emotionslosigkeit verdeutlicht. Die bisher sehr sachliche Beschreibung des lyrischen Ichs wird durch das Paradoxon „dunkelhelllila“ (V. 2) in Bezug auf die Farbe der Aster unterbrochen. Das Paradoxon legt den Fokus des Lesers auf die Aster, welche einen Kontrast zu der Leiche bildet. Die Aster, die bereits im Titel des Textes erwähnt wird, ist eine Blume die vorzugsweise im Herbst blüht. Dieser Umstand zeigt auf, dass es sich bei der Aster um ein Symbol für Vergänglichkeit handelt. Der Titel „Kleine Aster“ lässt sich daher wie folgt interpretieren. Die Verniedlichung der Aster durch das Adjektiv „[k]lein[…]“ steht im Kontrast zu den ersten Versen des Gedichts. Die Verniedlichung stellt eigentlich eine emotionale Atmosphäre da, die einen Gegensatz zu der abstrakten Beschreibung des Lyrischen Ich zu Beginn des Gedichtes. Der dritte Vers des Textes beendet die Aussage mit der Formulierung „zwischen die Zähne geklemmt“ (V. 3) in Bezug auf den Aufenthaltsort der Aster. Die gedankliche Vorstellung dieses Bildes wirkt paradox und geradezu unpassend in einem Obduktionsraum. Formal ist die Textstelle durch einen Kreuzreim mit dem ersten Vers verbunden. Das Reimschema ist eine formale Verbildlichung des Ausdrucks „geklemmt“ (ebd.) da der Vers, in welchem die Aster erwähnt wird zwischen den beiden sich reimenden Versen steht. Die ersten drei Verse bilden den ersten Sinnabschnitt des Gedichts. |
| + | Der zweite Sinnabschnitt (Z. 4 – 15) setzt ein mit der Beschreibung „Als ich von der Brust aus / unter der Haut / mit einem langen Messer / Zunge und Gaumen herausschnitt“ (V. 4 ff.) ein. Auffällig ist hier der Umbruch, welcher die Sinnabschnitte inhaltlich voneinander unterscheidet. Im ersten Abschnitt beschreibt das lyrische Ich die die Umgebung und die Leiche, während es im zweiten Sinnabschnitt selbst beginnt zu agieren. Darüberhinaus stammt das Wortfeld der Substantive „Brust“ (V. 4), „Haut“ (V. 5), „Zunge“ (V. 7) und „Gaumen“ (ebd.) aus der Anatomie des menschlichen Körpers. Ergänzt wird dies mit dem Substantiv „Messer“ (V. 6), das zu den Arbeitsinstrumenten des lyrischen Ichs zählt. Das Wortfeld, bzw. die gesamte Situation, sind sehr kalt und emotionslos beschrieben, weshalb der zweite Sinnabschnitt zunehmend bedrohlich wirkt. Dies lässt sich dadurch ergänzen, dass weder ein Rhythmus, noch ein Reimschema oder eine Interpunktion zwischen den vier Versen zu finden ist, was die Situation klimaxartig bedrohlicher wirkt. Im Anschluss daran gibt das lyrische Ich an es „muß […]sie angestoßen haben, denn sie glitt / in das nebenliegende Gehirn“ (V. 8 f.). Es bezieht sich hierbei auf die Aster, die sich im Mund der Leiche befindet. Die gesamte Situation wirkt skurril, da das Beschriebene anatomisch nicht möglich ist, was den paradoxen Kontext des Gedichtes untermauert. Im weiteren Verlauf erklärt das lyrische Ich „Ich packte sie ihm in die Brusthöhle“. Der Umstand, dass sich das lyrische Ich mehr mit der Blume befasst, verdeutlicht dass sein Verhältnis zu der Blume emotionaler ist als zu der Leiche. Dies wird ebenso durch die Tatsache, dass das lyrische Ich die Aster „zwischen die Holzwolle [legte], als man zunähte“ (V. 10 f.) ist mit dem Ablauf einer Beerdigung vergleichbar. Wird das Verhältnis zwischen dem lyrischen Ich und der Leiche analysiert, so ist dies kalt und distanziert, während das Verhältnis zur Aster eher als emotional bezeichnet werden kann. Als Pathologe hat das lyrische Ich täglich mit dem Tod zu tun und somit einen sehr belastenden Beruf. Es distanziert sich von der Leiche und konzentriert sich stattdessen auf die Aster, die es symbolisch für die Leiche beerdigt. Dies wird ebenso durch den gedanklichen Ausruf „Trink dich satt an deiner Vase!“ (V. 12) untermauert. Das lyrische Ich bezeichnet die Leiche als „Vase“ (ebd.), was einer leblosen Hülle, die auch dem Verständnis des lyrischen Ichs für eine Leiche, gleichkommt. Das Gedicht endet mit dem Abschied „Ruhe sanft, / kleine Aster!“ (V. 13 f.) womit das lyrische Ich einen Rückbezug zum Titel schafft und zeitgleich das Sinnbild der Beerdigung untermauert. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassen lässt sich festhalten, dass das lyrische Ich in seinem Beruf schweren psychischen Belastungen ausgesetzt wird und daher emotional kühl, kontrolliert und distanziert reagiert. Die Aster bildet einen Mittelpunkt auf den das lyrische Ich seine Emotionen zentriert. Dies wird durch die Interpunktion, das Wortfeld sowie durch die formale Gestaltung des Gedichts und die verwendeten stilistischen Mittel wie Metaphern, Ellipsen oder Paradoxons gestützt. | ||
===''August Stramm: Untreu''=== | ===''August Stramm: Untreu''=== | ||
| Zeile 544: | Zeile 553: | ||
Der zweite Sinnabschnitt setzt mit der Schilderung „Dein Blick versargt“ (V. 4) ein. Auffällig ist hier erneut ein Neologismus. Die Wortneuschöpfung „versargt“ (ebd.) stellt ein Verb zum Substantiv Sarg dar. Mit einem Sarg wird meist der Tod assoziiert, da die Leiche in einem Sarg in die Erde hinabgelassen wird. Die Verbindung zwischen einem Sarg und einem Blick wirkt paradox, doch es lässt sich so interpretieren, als dass die Partnerin des lyrischen Ichs ihm ihn anblickt nachdem er sie mit ihrer Untreue konfrontiert hat und er nichts weiter als dunkle Leere, ähnlich wie ein Grab für sie empfindet. Der fünfte Vers besteht aus der Konjunktion „Und“ (V. 5), welche den vierten und den sechsten Vers miteinander verbindet und zugleich einen Umbruch in der Struktur des Gedichtes deutlich macht. Der Umbruch erfolgte bereits im Vers zuvor und überspringt die Konfrontation des lyrischen Ichs gegenüber seiner Partnerin. | Der zweite Sinnabschnitt setzt mit der Schilderung „Dein Blick versargt“ (V. 4) ein. Auffällig ist hier erneut ein Neologismus. Die Wortneuschöpfung „versargt“ (ebd.) stellt ein Verb zum Substantiv Sarg dar. Mit einem Sarg wird meist der Tod assoziiert, da die Leiche in einem Sarg in die Erde hinabgelassen wird. Die Verbindung zwischen einem Sarg und einem Blick wirkt paradox, doch es lässt sich so interpretieren, als dass die Partnerin des lyrischen Ichs ihm ihn anblickt nachdem er sie mit ihrer Untreue konfrontiert hat und er nichts weiter als dunkle Leere, ähnlich wie ein Grab für sie empfindet. Der fünfte Vers besteht aus der Konjunktion „Und“ (V. 5), welche den vierten und den sechsten Vers miteinander verbindet und zugleich einen Umbruch in der Struktur des Gedichtes deutlich macht. Der Umbruch erfolgte bereits im Vers zuvor und überspringt die Konfrontation des lyrischen Ichs gegenüber seiner Partnerin. | ||
| + | |||
| + | ===''Joseph von Eichendorff: Die blaue Blume''=== | ||
| + | |||
| + | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Die blaue Blume“, verfasst von Joseph von Eichendorff und veröffentlicht im Jahr 1818, handelt es sich um ein Gedicht aus der Literaturepoche der Romantik. Thematisiert die Sehnsucht nach Glückseligkeit. | ||
| + | |||
| + | Das Gedicht ist in drei Strophen zu je vier Versen gegliedert. Es liegt zunächst ein unregelmäßiges Metrum vor, welches im dritten Vers von einem dreihebigen Jambus sowie betonte und unbetonte Kadenzen. Das Reimschema lässt sich durch unterbrochene Kreuzreime kennzeichnen. | ||
| + | |||
| + | Bereits der Titel des Gedichtes „Die blaue Blume“ greift das zentrale Symbol des Textes auf. Die Blume steht insbesondere durch die Farbsymbolik in Form der Farbe „blau[…]“ (V. 1) als Metapher für die Unendlichkeit oder in diesem Fall das geheimnisvolle Unerreichbare. Bereits im ersten Vers des Gedichtes heißt es „Ich suche die blaue Blume“ (V. 1). Der Umstand, dass der Vers mit dem Personalpronomen „Ich“ (V. 1) beginnt, veranschaulicht eine Betonung in Bezug auf die Person des lyrischen Ichs. Die vorangehenden Epochen waren von einem sogenannten Ich-Verlust gekennzeichnet, welcher jedoch in der Romantik umgekehrt wurde und somit ein charakteristisches Merkmal dieser Epoche darstellt. Die Tatsache, dass das lyrische Ich nach der blauen Blume sucht (vgl. V. 1), verdeutlicht, dass es sich nach dem Unerreichbaren sehnt. Dieses wird jedoch nicht genauer definiert und verbirgt sich hinter dem Mysterium der „blaue[n] Blume“ (V. 1). Die Anapher des Ausdrucks „Ich suche“ (V. 2) im folgenden Vers veranschaulicht durch die Wiederholung die Sehnsucht des lyrischen Ichs nach diesem Mysterium. Allerdings ergänzt es im Bezug dazu die Feststellung „und finde sie nie“ (V. 2). Diese Feststellung deutet darauf hin, dass das lyrische Ich sich durchaus bewusst ist, dass es das Geheimnis nie lüften wird, jedoch sehnt es sich dennoch danach. Am Ende der ersten Strophe erwähnt es „Mir träumt, dass in der Blume / Mein gutes Glück mir blüh“ (V. 3 f.). Das lyrische Ich hat im Traum eine Möglichkeit gefunden dem Geheimnis näher zu kommen, was die Sehnsucht nach der Vollkommenheit, die es seiner Ansicht nach durch die Lösung erfahren würde, verstärkt. Der Traum ist ebenfalls ein spezifisches Merkmal der Literaturepoche der Romantik. Viele Autoren fanden im Traum die Zuflucht, die ihnen in der Realität verwehrt war, weshalb der Traum als Motiv in vielen Gedichten zu finden ist. In diesem Fall kommt das lyrische Ich in seinen Träumen seiner Sehnsucht ein Stück näher. Auffällig ist ebenso der Pleonasmus „gutes Glück“ (V. 4) im letzten Vers der Strophe, der zugleich eine Alliteration darstellt. Das „gute[…] Glück“ (ebd.) verdeutlicht die Vollkommenheit, die das lyrische Ich vermutet mit der Lösung des Geheimnisses zu finden. Durch die Alliteration ist der Ausdruck, der für die Interpretation des Gedichtes von Bedeutung ist, leicht einprägsam, ebenso wie der Titel „blaue Blume“, welcher ebenfalls eine Alliteration ist. | ||
| + | |||
| + | Die zweite Strophe setzt ebenfalls mit dem Personalpronomen „Ich“ (V. 5) ein und legt erneut den Fokus auf die Person des lyrischen Ichs, welches die einzige handelnde Person im gesamten Gedicht darstellt. Die Strophe setzt ein mit der Beschreibung „Ich wandre mit meiner Harfe“ (V. 5). Das Verb „wand[ern]“ (ebd.) steht in Verbindung zu der in der ersten Strophe beschriebenen Suche. Der Umstand, dass das lyrische Ich mit seiner „Harfe“ (ebd.) auf die Suche geht demonstriert ein weiteres Merkmal der Epoche. Die Musik, hier dargestellt durch die „Harfe“ (V. 5), ist gleicherweise ein für die Romantik typisches Motiv, das einen Fluchtort für die Autoren repräsentiert. Die Aufzählung „Durch Länder, Städt und Au’n“ (V. 6) im folgenden Vers visualisiert insbesondere durch den Antiklimax die Sehnsucht von der das lyrische Ich getrieben wird, obwohl es sich bewusst ist, dass es das Geheimnis nie aufdecken wird. Dies wird im Folgenden erneut durch die Verwendung der Metapher der blauen Blume deutlich gemacht. Am Ende der Strophe wird hervorgebracht, dass es dem lyrischen Ich nicht Möglich ist „nirgends in der Runde / die Blum zu schaun“ (V. 7 f.). Das Adverb „nirgends“ (ebd.) greift die Aufzählung im vorangehenden Vers erneut auf und verstärkt die Bedeutung dessen. Das lyrische Ich ist sich, wie bereits in der ersten Strophe erwähnt, bewusst, dass es das Geheimnis nie aufdecken wird. | ||
| + | |||
| + | Mit dem Beginn der dritten Strophe erfolgt ein Umbruch in der Stimmung des lyrischen Ichs. Zuvor war es sich zwar bewusst, dass es das Geheimnis und somit die Vollkommenheit nie erreichen kann, doch es strebte dennoch danach. In der dritten Strophe wirkt der Gemütszustand des lyrischen Ichs resignativ. | ||
| + | |||
| + | ===''Abschrift 2. Klausur''=== | ||
| + | |||
| + | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Meine Zeit“, verfasst von Wilhelm Klemm und veröffentlicht im Jahr 1916 in der Gedichtsammlung „Verse und Bilder“, handelt es sich um ein Gedicht aus der Literaturepoche des Expressionismus. Thematisiert wird die apokalyptische Stimmung während des Ersten Weltkriegs. | ||
| + | |||
| + | Das Gedicht umfasst 14 Verse und ist in vier Strophen gegliedert, die in Form eines Sonetts (zwei Quartette, zwei Terzette) vorliegen. Es liegt durchgehend ein fünfhebiger Jambus vor. | ||
| + | |||
| + | Bereits der Titel des Gedichts „Meine Zeit“ deutet auf eine Beschreibung der vorliegenden Verhältnisse während der Entstehungszeit des Gedichtes hin. Das Gedicht wurde 1916 veröffentlicht, was nahelegt, dass es in der Zeit des Ersten Weltkriegs (1914 – 1918) entstanden ist. Das zu analysierende Gedicht setzt ein mit der Aufzählung „Gesang und Riesenstädte, Traumlawinen, / Verblaßte Länder, Pole ohne Ruhm“ (V. 1 f.). Bereits im Beginn der Aufzählung „Gesang und Riesenstädte“ (V. 1) ist ein charakteristisches Merkmal des historischen Hintergrunds der Literaturepoche des Expressionismus zu finden. Die erwähnten „Riesenstädte“ (ebd.) sind durch den Prozess der Verstädterung entstanden, der insbesondere durch den Ersten Weltkrieg vorangetrieben wurde, da in den Städten Nahrungsmittel und Kleidung zu erhalten waren. Mit dem Substantiv „Gesang“ (V. 1) werden meistens Gefühle wie Freude assoziiert. In diesem Fall lässt sich diese Freude als Enthusiasmus für den Krieg auslegen. Somit stellt der Beginn der Aufzählung die Zeit vor dem Krieg dar, da die Menschen noch freudig gestimmt waren. Ergänzt wird dies durch den Neologismus „Traumlawinen“ (V. 1). Die Wortneuschöpfung setzt sich aus den Substantiven „Traum“ und „Lawinen“ zusammen. Der Neologismus ist geprägt von der Antithetik dieser begriffe. Mit dem Substantiv „Traum“ wird meist eine friedliche und vollkommene Welt in Verbindung gebracht, während der Begriff „Lawinen“ Gefahr und Zerstörung zum Ausdruck bringt. Neologismen sind insofern kennzeichnend für die Literaturepoche des Expressionismus, als dass die Menschen sich Wortneuschöpfungen bedienen mussten, da ihr vorhandener Wortschatz nicht ausreichte um Gefühle, Gedanken oder Eindrücke zum Ausdruck zu bringen. Der Neologismus „Traumlawinen“ (V. 1) beschreibt somit die Zerstörung der zu Beginn des Krieges begeisterten Stimmung. Im nächsten Vers heißt es „Verblaßte Länder, Pole ohne Ruhm“ (V. 2), was bereits die Folgen der kriegerischen Auseinandersetzung beschreibt. Das Adjektiv „[v]erblaßt[…]“ (ebd.) in Bezug auf die Länder verdeutlicht die durch den Krieg schwindende Bevölkerung. Die Metapher „Pole ohne Ruhm“ (V. 2) deutet darauf hin, dass die Menschen sich nicht mehr bewusst sind, was richtig oder falsch ist. Hinter dem Begriff „Pole“ (ebd.) können sich unterschiedliche Wahrnehmungen verbergen, beispielsweise der Nord- und der Südpol oder das positiv bzw. negativ geladene Ende eines Magneten. Allerdings wird immer ein Gegensatz verdeutlicht, der in diesem Fall mit der moralischen Frage im Krieg, was ist richtig und was ist falsch, in Verbindung gebracht werden kann, da während des Krieges die Grenzen zwischen Richtig und Falsch verschwimmen und es nur wenige gibt, die ihre moralischen Ansichten aufrecht halten. Der Zusatz „ohne Ruhm“ (V. 2) verdeutlicht allerdings, dass ihre Ansichten keine Beachtung finden. Im weiteren Verlauf wird beschrieben, „Die sündigen Weiber, Not und Heldentum“ (V. 3). Unter dem Begriff „sündige[…] Weiber“ (ebd.) sind Frauen zu verstehen, die während des Krieges ihre Männer verloren haben und nun ihren Körper verkaufen um sich Geld zum Überleben zu sichern. Der zweiter Teil des Verses „Not und Heldentum“ (V. 3) verdeutlicht den zwiegespaltenen Alltag während des Krieges. Entweder die Soldaten oder die Bevölkerung sind in Not oder sie werden als Helden gefeiert. Das Quartett endet mit dem Vers „Gespensterbrauen, Sturm auf Eisenschienen“ (V. 4). Der Neologismus „Gespensterbrauen“ (ebd.) verdeutlicht insbesondere durch das Substantiv „Gespenst“ die apokalyptische Stimmung, die während des Krieges die Bevölkerung ergreift. Die Metapher „Sturm auf Eisenschienen“ (V. 4) macht insbesondere auf die Gefahr des Krieges, aber auch auf die Vergänglichkeit aufmerksam, da beides mit „Sturm“ (ebd.) assoziiert wird. Die Eisenbahnschienen stehen metaphorisch für die Eisenbahn, da diese das Haupttransportmittel zu dieser Zeit war und die Soldaten zur Front brachte. Allgemein ähnelt bereits die Gesamtform des Gedichtes dem Stil des Barock, was durch die Mittelzäsur, dem regelmäßigen Rhythmus, die Antithetik, das Reimschema (umarmender Reim) und de an das Reimschema angepassten Kadenzen deutlich gemacht wird. Die Mittelzäsur, die formal durch die Kommas hervorgehoben wird, unterstützt die Aufzählungen und macht die Antithetik, die in vielen Ausdrücken zu finden ist, deutlich. | ||
| + | |||
| + | Das zweite Quartett setzt ein mit der Aussage „In Wolkenfernen trommeln die Propeller“ (V. 5). Gemeint sind mit der Bezeichnung „Propeller“ (ebd.) die Kriegsflugzeuge, durch die meist Gefahr drohte. Untermauert wird dies ebenso durch das Verb „trommeln“ (V. 5) in Beug auf die Propeller. Insgesamt greift der Einstieg in das zweite Quartett die apokalyptische Stimmung vom Ende des ersten Quartettes wieder auf. Verdeutlicht wird dies ebenso durch den Ausdruck „Völker zerfließen“ (V. 6), der dazu benötigt wird, die Flucht der Menschen auf Grund des Krieges darzustellen. Weiterhin wird beschrieben „Bücher werden Hexen“ (V. 6), was eine Anspielung auf die Hexenverfolgung darstellt. Die „Bücher“ (ebd.) stehen metaphorisch für gebildete Menschen, die das Ausmaß des Krieges erkennen und versuchen ihre Sichtweise zu verbreiten. Allerdings werden sie dafür verfolgt. Es heißt weiterhin „Die Seele schrumpft zu winzigen Komplexen“ (V. 7), was eine Verbindung zum vorherigen Vers darstellt, da die gebildeten Menschen verfolgt werden und sich nicht mehr frei entfalten können. As lyrische Ich geht sogar so weit, dass es behauptet „Tot ist die Kunst“ (V. 8) als Metapher für die gebildeten Menschen, die verfolgt werden, weil sie an ihrer kritischen Haltung gegenüber dem Krieg festhalten. Das zweite Quartett endet mit der Aussage „Die Stunden kreisen schneller“ (V. 8), welche die Vergänglichkeit in Bezug auf den Krieg ausdrückt. Im zweiten Quartett wird die Form, die im ersten Quartett der des Barocks sehr nahe kam, unterbrochen. Anstelle von Kommas wurden im zweiten im zweiten Quartett Punkte verwendet, die Endgültigkeit ausdrücken. Das Reimschema wurde beibehalten, genauso wie die Mittelzäsur, doch die Kadenzen sind alle unbetont und unterstützen somit die Interpunktion und die damit in Verbindung gebrachte Endgültigkeit. | ||
| + | |||
| + | Es erfolgt sowohl formal als auch inhaltlich ein Umbruch mit dem Anfang des ersten Terzettes. Das Terzett setzt ein mit der Klage „O meine Zeit“ (V. 9). Der Umstand, dass es sich um eine Klage handelt, ist am Laut „O“ (ebd.) und an der Interpunktion in Form eines Ausrufezeichens festzumachen. Weiterhin beschreibt das lyrische Ich die Zeit, in der es lebt, als „So namenlos zerrissen, / So ohne Stern, so daseinsarm im Wissen“ (V. 9 f.). Der Umstand, dass das lyrische Ich die Zeit als „namenlos zerrissen“ (ebd.) bezeichnet, verdeutlicht, dass es die Zeit als unbedeutsam und gespalten empfindet. Dies wird ebenso durch den Ausdruck „ohne Stern“ (V. 10) untermauert, der verdeutlicht, dass den Menschen ein Orientierungspunkt zu einem geordneten Leben fehlt. Das Trikolon wird beendet mit der Beschreibung „daseinsarm im Wissen“ (V. 10). Das Terzett endet mit dem Vergleich „Wie du, will keine, keine mir erscheinen“ (V. 11). Die Wiederholung der Bezeichnung „keine“ (ebd.) veranschaulicht das Ausmaß, in dem das lyrische Ich spricht. Der Vergleich, der sich auf die Anapher „So“ (V. 9; V. 10) stützt, endet mit einem Punkt, der erneut die Endgültigkeit des Gesagten darstellt. | ||
| + | |||
| + | Das zweite Terzett setzt ein mit der Aussage „Noch hob ihr Haupt so hoch niemals die Sphinx“ (V. 12). Die Sphinx wurde in der griechischen Mythologie als Dämon des Unheils und der Zerstörung betrachtet. Somit passt deren Erwähnung in das Bild, das durch die apokalyptische Stimmung hervorgerufen wird. Der Umstand, dass diese ihr Haupt noch niemals so hoch hob (vgl. V. 12), veranschaulicht metaphorisch, dass es noch nie zuvor so viel Zerstörung gegeben hat. Im nächsten Vers spricht das lyrische Ich die Zeit in der es lebt, mit dem Personalpronomen „Du“ (V. 13) an und personalisiert diese somit. Das lyrische Ich beschreibt, die Zeit sieht „am Wege rechts und links / Furchtlos vor Qual des Wahnsinns Abgrund weinen“ (V. 13 f.). Mit dieser Metapher wird zum Ende des Gedichts erneut deutlich gemacht, von welcher Zerstörung und welchen Qualen die Zeit geprägt ist und deutet auch noch einmal auf die apokalyptische Stimmung hin, die im gesamten Gedicht zu finden ist. Die beiden Terzette sind formal wieder im Stil des Barock verfasst. Allgemein lässt sich die Verwendung der formalen Charakteristika aus der Epoche des Barock so deuten, dass das lyrische Ich sich nach der Zeit vor dem Krieg, in der Ordnung herrschte, zurücksehnt. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das lyrische Ich die Verhältnisse in der Zeit des Ersten Weltkriegs beschreibt und besonders die Situation der Menschen mit kritischer Haltung gegenüber dem Krieg hervorhebt. Dies wird besonders durch die verwendeten formalen Charakteristika aus der Literaturepoche des Barock (Sonett, Reimschema, Kadenzen), aber auch durch die Interpunktion hervorgehoben. | ||
| + | |||
| + | ''Aufgabe 2:'' | ||
| + | |||
| + | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Schluss des 1648sten Jahres“, verfasst von Andreas Gryphius und veröffentlicht im Jahr 1698 von Gryphius‘ Sohn, handelt es sich um ein Gedicht aus der Literaturepoche des Barock. Thematisiert wird das Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648. | ||
| + | |||
| + | Das vorliegende Gedicht soll im Folgenden analysiert und mit dem expressionistischen Gedicht „Meine Zeit“, verfasst von Wilhelm Klemm und veröffentlicht im Jahr 1916, verglichen werden. | ||
| + | |||
| + | Das vorliegende Gedicht umfasst 14 Verse und ist ebenso wie Klemms Gedicht in der Form eines Sonetts gegliedert. | ||
| + | |||
| + | Der zu analysierende Text setzt ein mit dem Ausruf „Zeuch hin, betrübtes Jahr!“ (V. 1). Im Jahr 1648 endete der Dreißigjährige Krieg und somit die Jahre der Angst und Zerstörung, was ebenso durch die Ausrufe „Zeuch hin mit meinen Schmerzen!“ (V. 1) und „Zeuch hin mit meiner Angst und überhäuften Weh!“ (V. 2) deutlcih wird. Die Ausrufe, die alle mit der Anapher „Zeuch hin“ (V. 1; V. 2) beginnen, sind Ausdruck der Freude über das Ende des Krieges. Dieser Umstand steht im Kontrast zu Klemms Gedicht, da dieses von der Euphorie vor und der schweren Zeit während des Krieges handelt. Eine Aufzählung in Form einer Anapher ist bei Kleimm in der dritten Strophe des Gedichtes zu finden, doch diese thematisiert die Bedeutungslosigkeit und die Vergänglichkeit der Zeit während die hier vorliegende Metapher die Euphorie über das Ende des Krieges darstellt. Im zweiten Teil des Quartettes heißt es „Zeuch so viel Leichen nach! Bedrängte Zeit vergeh / Und führe mit dir weg die Last von diesem Herzen“ (V. 3 f.). Insgesamt ist das lyrische Ich froh über das Ende des Krieges und wünscht sich die Zeit und die Erlebnisse zu vergessen. | ||
| + | |||
| + | Das zweite Quartett setzt ein mit der Ansprache „Herr“ (V. 5). Mit „Herr“ (ebd.) ist in diesem Fall Gott gemeint, zu dem das lyrische Ich spricht. Dieser Umstand ist ein weiterer Kontrast zu Klemms Gedicht, da dort keine religiösen Ansichten zu erkennen sind. Das lyrische Ich erläutert weiterhin, dass es der Ansicht ist, dass das Jahr 1648 vor Gott „als ein Geschwätz und Scherzen“ (V. 5) wirkt und spricht somit die Bedeutungslosigkeit dieses Jahres für Gott aus. Die Bedeutungslosigkeit der Zeit ist auch ein Motiv für Klemms Gedicht, beispielsweise wenn es heißt „Die Stunden reisen schneller“ (Meine Zeit, V. 8), was die Vergänglichkeit und Nichtigkeit er Zeit untermauert. Durch die rhetorische Frage „ Fällt meine Zeit nicht hin wie ein verschmelzter Schnee?“ (V. 6) wird allerdings deutlich, auf welche Zeit das lyrische Ich hindeutet. Während das lyrische Ich in Klemms Gedicht von der Zeit, in der das lyrische Ich lebt, spricht, spricht das lyrische Ich in Gryphius‘ Text von der eigenen Lebzeit. Mit der rhetorischen Frage und der Metapher „verschmelzter Schnee“ (V. 6)deutet das lyrische Ich auf die Vergänglichkeit seiner eigenen Lebzeit hin. Die rhetorische Frage und die Metapher werden im weiteren Verlauf der Strophe erneut aufgegriffen, wenn das lyrische Ich Gott bittet, „Laß doch, weil mir die Sonn gleich in der Mittagshöh, / Mich noch nicht untergehn gleich ausgebrenten Kerzen“ (V. 7 f.). Das lyrische Ich bezeichnet sich selbst und somit seine Lebzeit als „verschmelzter Schnee“ (V. 6). Es ergänzt in seiner Bitte, dass die Sonne gleich in der Mittagshöhe steht (vgl. V. 6), also die Stelle, an der sie am hellsten und wärmsten scheint, was Schnee in der Regel schneller schmelzen lässt. Zusammengefasst deutet das lyrische Ich somit auf das Ende seiner Lebzeit in Form des Todes hin. Der Tod wird hier metaphorisch als „ausgebrennte[…] Kerze[…]“ (V. 8) bezeichnet. Der Umstand, dass die Bitte eindringlich ist, ist an dem Ausrufezeichen am Versende zu erkennen. Auf formaler Ebene fällt im zweiten Quartett auf, dass das Reimschema unterbrochen wurde. Wie es bei einem umarmenden Reim üblich ist reinem sich der erste und vierte Endreim, jedoch reimen sich der zweite und dritte Endreim nicht, was den inhaltlichen Umbruch von Euphorie zu Todesstimmung formal untermauert. | ||
| + | |||
| + | Das erste Terzett knüpft unmittelbar an die Bitte vom vorherigen Quartett an und wird ebenso durch die Ansprache „Herr“ (V. 9) eingeleitet. Anschließend heißt es „es ist genung geschlagen“ (V. 9). Diese Aussage ist in Bezug zum vergangenen Krieg zu stellen, da das lyrische Ich die Schlachten und die Zerstörung erlebt und überlebt hat. Ergänzt wird dies durch den folgenden Vers „Angst und Ach genung getragen“ (V. 10), welcher verdeutlicht, dass das lyrische Ich in den vergangenen Jahren unter den Folgen des Krieges gelitten hat. Das Leid, das durch den Krieg entstanden ist, wird auch bei Klemm thematisiert. Insbesondere durch die Aussage „In Wolkenfernen trommeln die Propeller“ (Meine Zeit, V. 5) wird dargestellt, welcher Angst und welcher Gefahr die Bevölkerung ausgesetzt war. Das Terzett endet mit der Bitte des lyrischen Ichs an Gott „Gib doch nun etwas Frist, daß ich mich recht bedenke“ (V. 11). Der Umstand, dass das lyrische Ich über seine Person nachdenken will, ist dem Krieg geschuldet, da in dieser Zeit selten Ruhe zum Nachdenken einkehrte. | ||
| + | |||
| + | Das zweite Quartett ist mit dem ersten durch den Parallelismus „Gib, daß ich“ (V. 12) verbunden. Die Aussage wird fortgeführt mit „der Handvoll Jahre / Froh wird eins vor meiner Bahre“ (V. 12 f.). Das lyrische Ich ist sich bewusst, dass es nicht mehr lange zu leben hat und bittet Gott um ein wenig mehr Zeit sich selbst kennenzulernen. Das Gedicht endet mit der Aussage „Mißgönne mir doch nicht dein liebliches Geschenk!“ (V. 14), was den Wunsch des lyrischen Ichs insbesondere durch die Verschwendung des Ausrufezeichens bestärkt. | ||
| + | |||
| + | Die Form des Gedichtes orientiert sich an den für die Literaturepoche des Barock strengen Regeln, mit zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme, wie bereits in der Analyse erwähnt, ist die Unterbrechung des Reimschemas, und zum anderen die Verse 9, 10, 12 und 13, die nicht mit dem regelmäßigen Schriftbild übereinstimmen und somit auch nicht den Alexandriner aus den Quartetten fortsetzen, sondern durch vierhebige Jamben gekennzeichnet werden. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend ist zu sagen, dass das lyrische Ich dem Ende des Krieges gegenüber euphorisch gestimmt ist, es sich allerdings darüber bewusst ist, dass es nur noch wenig Zeit zum Leben hat und daher Gott bittet ihm noch ein wenig zu überlassen, um sich selbst kennenzulernen. Formal wird dies besonders durch die Interpunktion hervorgehoben und die sprachlichen Mittel, wie beispielsweise die Anapher oder der Parallelismus, der die Terzette verbindet. | ||
| + | |||
| + | Beide Gedichte gleichen sich in Form und Thematik, wobei die Ausgangssituationen unterschiedlich sin. In Klemms Gedicht werden die Folgen, die Ängste und die apokalyptische Sttimmung während des Ersten Weltkrieges dargestellt und die Vergänglichkeit der Zeit für das einzelne Individuum hervorgehoben, während in Gryphius‘ Gedicht das Ende des Dreißigjährigen Krieges und die dadurch für das Individuum verlorene Zeit beschrieben wird. | ||
| + | |||
| + | ===''Goethe: Rastlose Liebe vs. Rilke: Einsamkeit''=== | ||
| + | |||
| + | Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Rastlose Liebe“ handelt es sich um ein Gedicht, verfasst von Johann Wolfgang von Goethe und veröffentlicht im Jahr 1776 in der Literaturepoche des Sturm und Drang zum Thema Liebe. | ||
| + | |||
| + | Das Gedicht umfasst drei Strophen. Die erste und die dritte Strophe zählen sechs Verse, während die zweite Strophe durch acht Verse gekennzeichnet wird. Wie auch die Anzahl der Verse variiert das Reimschema strophenabhängig. In der ersten und in der dritten Strophe sind Paarreime zu erkennen. Als Reimschema in der zweiten Strophe liegen überwiegend Kreuzreime vor. Weiterhin ist ebenfalls kein eindeutiges Metrum zu erkennen. | ||
| + | |||
| + | Bereits der Titel des Gedichtes „Rastlose Liebe“ (T) lässt insofern auf den Inhalt vorausdeuten, als dass das Lyrische Ich versucht die Liebe oder eine geliebte Person zu finden, somit stellt die Liebe ein zentrales Element in der Handlung des Gedichts dar. | ||
| + | |||
| + | Das zu analysierende Gedicht setzt ein mit der Aufzählung „Dem Schnee, dem Regen, / dem Wind entgegen“ (V. 1 f.) und knüpft somit unmittelbar an die Vorausdeutung im Titel an. Diese Aufzählung ist in Form einer Antiklimax angeordnet und deutet auf einen Wiederstand hin, den das Lyrische Ich versucht zu überwinden. Untermauert wird dies ebenso durch die folgenden Verse „im Dampf der Klüfte, / durch Nebeldüfte“ (V. 3 f.). Die verwendeten Substantive stammen aus dem Wortfeld der Natur, allerdings aus der Richtung erschwerter Witterungsverhältnisse, die darauf hindeuten dass der Weg des Lyrischen Ichs zur Liebe eher erschwert ist und es zahlreichen Kämpfen ausgesetzt ist. Untermauert wird dies weiterhin durch die Ausrufe „immer zu! Immer zu! / Ohne Rast und Ruh!“ (V. 5 f.). Die Repetitio der Klage „Immer zu!“ (ebd.) veranschaulicht die Ruhelosigkeit die das Lyrische Ich erleidet. Intensiviert wird dies weiterhin durch den Ausdruck „Ohne Rast und Ruh“ (V. 6), der zugleich eine Alliteration ist und insbesondere durch das Substantiv „Rast“ (ebd.) wird eine Verbindung zum Titel hergestellt. | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2019, 20:43 Uhr
Faust
Inhaltsangabe Faust
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Faust“ handelt es sich um den ersten Teil der gleichnamigen Tragödie, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahre 1808. Die Handlung setzt mit einer Wette zwischen Gott und dem Teufel, der hier als Mephistopheles bezeichnet wird, ein. Die Wette besteht darin, dass Mephistopheles versuchen will Faust, einen Doktor der immer auf dem rechten Weg gewandert ist und sein Leben der Wissenschaft verschrieben hat, von diesem Weg abzubringen. Gott ist sich seines Sieges bewusst und lässt ihn daher gewähren. Heinrich Faust ist ein verzweifelter Wissenschaftler, der zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er nicht alles Wissen kann. Während eines Spaziergangs begegnet er einem Hund, den er mit nach Hause nimmt. Der Hund jedoch gibt sich bald als Mephistopheles zu erkennen und schließt mit Faust einen Pakt: Wenn er es schafft Faust vollends glücklich zu machen erhält er dessen Seele. Zunächst versucht Mephistopheles Faust, der den Pakt eingegangen ist, Freude zu bereiten, doch bereits beim ersten Versuch scheitert er. Als nächstes ermutigt er Faust einen Trank zu nehmen, der ihn jünger macht. Infolge dessen begegnet Faust Gretchen, in die er sich verliebt. Mit der Hilfe Mephistopheles gelangt er in ihr Schlafzimmer und schenkt ihr Schmuck. Gretchen, die ihrer Nachbarin davon berichtet, zeigt ebenfalls Interesse an Faust. Während des Gespräches erscheint Mephistopheles bei der Nachbarin, um ihr mitzuteilen dass ihr Mann verstorben ist. Diese wiederum lädt Mephistopheles und Faust für den Abend ein, damit Gretchen sich mit Faust unterhalten kann. Gretchen und Faust verlieben sich ineinander und es kommt zum ersten Kuss. Faust verführt Gretchen dazu ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Gretchens Mutter stirbt jedoch an dem Trank. In der darauf folgenden Nacht kehrt Gretchens Bruder Valentin nach Hause zurück und fordert Faust zu einem Duell heraus. Faust gewinnt das Duell und tötet Valentin. Daraufhin muss dieser fliehen und lässt Gretchen zurück. Auf der Flucht versucht Mephistopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust hat unterdessen eine Erscheinung, dass Gretchen in Gefahr ist und kehrt zurück um sie zu retten. Er findet sie im Kerker, wo sie ihm gesteht, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die Tragödie endet damit, dass Gott Gretchen im Himmel aufnimmt.
Faust: "Nacht" V.353-385
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Faust“ handelt es sich um einen Auszug aus dem ersten Teil der gleichnamigen Tragödie, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahre 1808. Thematisiert wird das Streben nach dem Unerreichbaren.
Protagonist der Handlung ist der Wissenschaftler Heinrich Faust, der zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er nicht alles Wissen kann. Wenig später begegnet Faust dem Teufel Mephistopholes und lässt sich mit diesem auf einen Pakt ein: Wenn er es schafft Faust vollends glücklich zu machen erhält er dessen Seele. Während Mephistopheles versucht seinen Teil der Abmachung zu erfüllen verliebt sich Faust in Gretchen. Gretchen, die ebenfalls Interesse an Faust zeigt, lässt sich von diesem verführen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Die Mutter jedoch stirbt an dem Trank und Gretchens Bruder wird von Faust im Duell getötet, woraufhin dieser fliehen muss und Gretchen zurücklässt. Auf der Flucht versucht Mephistopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust jedoch kehrt zu Gretchen zurück und findet diese im Kerker, wo sie ihm gestehet, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe.
Die zu analysierende Textstelle setzt ein mit dem Ausruf Fausts: „Habe nun, ach! Philosophie,/ Juristerei und Medizin“ (V.354 f.). Die Anzahl der Studienfächer kennzeichnet Faust als eine gelehrte Person. Auffällig ist jedoch die Interjektion „ach!“ (ebd.), welche trotz des hohen Wissensstandes eine gewisse Unzufriedenheit in Bezug auf die Studienfächer verdeutlicht. Faust ergänzt die Studienfächer um ein weiteres mit der Aussage: „Und leider auch Theologie“ (V.365). Das Adverb „leider“ (ebd.) in Bezug auf das Studium der Theologie verdeutlicht die Unzufriedenheit Fausts. Die Theologie steht generell im Kontrast zu den anderen Studienfächern, da es sich bei diesen um faktenbasierte Wissenschaften handelt und diese nicht, wie die Theologie unlösbare Fragen aufwerfen. Faust selbst berichtet, er habe „mit heißem Bemühen [studiert]“ (V. 357). Der Ausdruck „mit heißem Bemühen“ (ebd.) ist eine unreine Synästhesie, welche verdeutlichen soll wie intensiv und ehrgeizig Faust in seinem Studium vorgegangen ist. Im weiteren Verlauf erklärt Faust: „Da steh ich nun, ich armer Tor!/ Und bin so klug als wie zuvor“ (V. 358 f.). Die beiden Aussagen stehen im Gegensatz zu einander, da Faust sich in der ersten Aussage als „armer Tor“ (V.358) beschreibt und in der zweiten Aussage erläutert, er sei „so klug als wie zuvor“ (V.359). Zuvor hat Faust ganze vier Fächer studiert und bezeichnet sich dennoch als einen armen Narren. Diese Aussagen sind ebenfalls als Unzufriedenheit Fausts zu interpretieren. Als nächstes berichtet er, er„heiße Magister“ (V.360) und er „heiße Doktor“ (ebd.), damit sind die akademischen Titel gemeint, die er während seines intensiven Studiums errungen hat und die seinen Erfolg als Wissenschaftler verdeutlichen sollen. In den folgenden Versen wird erläutert, dass Faust bereits seit mehreren Jahren Lehrer ist und seine Schüler „an der Nase herum[führt]“ (V. 363), was bedeutet, dass er seinen Schülern aus seiner Sicht nichts Sinnvolles beibringt und im Zusammenhang mit der Unzufriedenheit am Anfang der Textstelle steht. In den Jahren als Lehrer ist er ebenfalls zu der Erkenntnis gekommen, „dass wir nichts wissen können“ (V. 364). Diese Erkenntnis vertrat ursprünglich der griechische Philosoph Sokrates, welcher versuchte damit zu verdeutlichen, dass wir Menschen so bedeutungslos im Universum sind, sodass wir nichts wissen können. Nach dieser Erkenntnis ist Faust so verzweifelt, dass es ihm „schier das Herz verbrenn[t]“ (V. 365). Faust bezeichnet sich selbst als „gescheiter als alle die Laffen,/ Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen“ (V.366 f.), was eine gewisse Arroganz verdeutlicht, da er sich selbst über Gelehrte und Priester stellt. Untermauert wird dies ebenfalls durch die Aussagen: „Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel“ (V. 368) und „Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel“ (V.369), wobei letzteres ebenso eine Vorrausdeutung für die zukünftige Handlung ist. Seine Verzweiflung wird ebenfalls darin bestätigt, dass ihm „alle Freud entrissen [wurde]“ (V.370). Die folgende Anapher: „Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,/ Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren“ (V. 371 f.) steht im Kontrast zu den vorherigen Aussagen, da Faust dort erwähnte, dass er sehr gebildet ist und seit Jahren Schüler unterrichtet. Er habe zudem „weder Gut noch Geld, Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt“ (V. 374), was veranschaulicht, dass er seiner Ansicht nach nichts Weiteres als unnützes Wissen besitzt. Aus diesem Grund habe er sich, seiner Aussage nach „der Magie ergeben“ (V. 377), damit ihm „durch Geistes Kraft und Mund/ Nicht manch Geheimnis würde kund“ (V. 378 f.) und er „nicht mehr, mit saurem Schweiß,/ Zu sagen brauche was [er] nicht weiß“ (V. 380 f.). Faust, dem es missfällt nicht alles wissen zu können, versucht nun in der Magie nach antworten zu suchen. Die Metapher „saure[r] Schweiß“ (V. 380) verdeutlicht ebenfalls die Unzufriedenheit Fausts. Auffällig ist, dass die Magie im Gegensatz zu den Studienfächern zu Beginn der Textstelle nicht in irgendeiner Form belegbar ist und es Faust somit nicht möglich wäre sein Wissen, welches er durch die Magie erlangt, in wissenschaftlicher Form zu erklären oder anderen glaubhaft zu vermitteln. Im weiteren Verlauf wird Fausts Wunsch, „dass [er] erkenn[t], was die Welt/ Im Innersten zusammenhält“ (V. 382 f.). Die Textstelle endet mit der Aussage: „Schau alle Wirkenskraft und Samen,/ Und tu nicht mehr in Worten kramen“ (V. 384 f.). Er legt dar, dass er erkennen möchte was die Welt antreibt, anstatt zu versuchen es irgendwie zu erklären, was an der Metapher „alle Wirkenskraft und Samen“ (V. 384) veranschaulicht wird.
Zum Schluss ist zusammenzufassen, dass Faust aufgrund seiner Erkenntnis, nicht alles wissen zu können, verzweifelt und unzufrieden ist. Diese Tatsache impliziert in ihm den Wunsch zu sehen wie die Welt funktioniert, dies ist ihm jedoch mit gewöhnlichen Methoden nicht möglich, weshalb er sich der Magie zuwendet.
Faust: "Gretchens Stube" V.3374-3413
Bei dem vorliegenden Text, handelt es sich um die Szene „Gretchens Stube“ aus dem ersten Teil der Tragödie „Faust“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahr 1808. Thematisiert wird die Frage des Menschen hinsichtlich der Lebensbezüge.
Die Szene „Gretchens Stube“ beschreibt die Gefühle Gretchens für Faust. Faust, der zu Beginn der Tragödie erkannt hat, dass er nicht in der Lage ist alles zu wissen und aus diesem Grund einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles eingegangen ist, welcher ihm versprach ihn für den Preis seiner Seele vollends glücklich zu machen. Mephistopheles ist mit seinen Versuchen Faust glücklich zu machen gescheitert bis dieser Gretchen traf. Gretchen lässt sich von Faust verführen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Die Mutter jedoch stirbt an dem Trank und Gretchens Bruder wird von Faust im Duell getötet, woraufhin dieser fliehen muss und Gretchen zurücklässt. Auf der Flucht versucht Mephisopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust jedoch kehrt zu Gretchen zurück und findet diese im Kerker, wo sie ihm gesteht, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die Szene ist insofern für die Handlung wichtig, als dass das Interesse Gretchens, auf welchem die Liebesgeschichte zwischen ihr und Faust beruht, verdeutlicht wird.
Der Monolog Gretchens, welcher in Form eines Liedes verfasst ist, lässt sich in drei Sinnabschnitte gliedern, die formal durch den Refrain voneinander getrennt sind. Das Lied setzt mit dem Refrain ein, somit bilden die Strophen zwei und drei einen Sinnabschnitt, in dem Gretchen ihre eigenen Gefühle beschreibt. Der darauf folgende zweite Sinnabschnitt erstreckt sich über die Strophen fünf, sechs und sieben, da die vierte Strophe wieder den Refrain beinhaltet. Thematisiert wird diesmal allerdings Faust und die Abhängigkeit Gretchens von diesem. Der letzte Sinnabschnitt ist nach dem Refrain in der achten Strophe zu verorten und legt Gretchens Wünsche und Sehnsüchte dar. Insgesamt umfasst das Lied zehn Strophen zu je vier Versen. Das Metrum wird durch zwei- und dreihebige Jamben gekennzeichnet. Als Reimschema liegen hauptsächlich unterbrochene Kreuzreime vor, aber auch vollständige Kreuzreime und Paarreime sind zu finden.
Die zu analysierende Textstelle setzt mit der Aussage Gretchens: „Meine Ruh ist hin“ (V.3374) ein. Diese Aussage ist auf die vorherigen Ereignisse, wie dem Tod der Mutter und die erste Begegnung mit Faust, zu beziehen. Da all diese Ereignisse mit Menschen in Verbindung stehen, die Gretchen viel bedeuten und ihre Familie bildeten, ist diese nun innerlich erschüttert und auf sich selbst gestellt. Ebenfalls klagt sie „[ihr] Herz ist schwer“ (V. 3375), was veranschaulicht, dass sie sehr unter der Trennung von Faust leidet. Die darauf folgende Äußerung: „Ich finde sie nimmer / und nimmermehr“ (V. 3376 f.) verdeutlicht in Bezug auf ihre innere Unruhe und die Trennung von Faust, dass sie sich der Endgültigkeit ihrer Gefühle Faust betreffend sicher ist. Dies wird ebenfalls zu Beginn der zweiten Strophe aufgegriffen, in der sie behauptet: „Wo ich ihn nicht hab, / Ist mir das Grab“ (V. 3379 f.). Gretchen sieht demnach keinerlei Sinn ohne Faust weiter zu leben, ihr Leben ist dementsprechend abhängig von ihm. Der Ausdruck: „Die ganze Welt / ist mir vergällt“ (V. 3380 f.) ist ebenfalls auf diesen Umstand zu beziehen und bestätigt, dass ihr ohne die Anwesenheit des Geliebten die Lebensfreude fehlt. Auffällig in der zweiten Strophe ist ebenfalls, dass diese die einzige Strophe des Liedes ist in der Paarreime eingesetzt wurden. Die Paarreime sollen daher abermalig die Beziehung zu Faust aufgreifen. Die dritte Strophe schließt sich thematisch unmittelbar der zweiten an, da Bezeichnungen, wie „Mein armer Kopf / ist mir verrückt“ (V. 3382 f.) und „Meiner armer Sinn / Ist mir zerstückt“ (V.3384 f.) die Bedeutung Fausts für Gretchen ein weiteres Mal unterstreichen. Zudem bilden beide Bezeichnungen einen Parallelismus, der die Endgültigkeit entsprechend Gretchens Ansicht ihre Gefühle betreffend aufzeigt. Im Gegensatz zur zweiten Strophe ist die dritte gekennzeichnet durch unterbrochene Kreuzreime, welche an die innere Unruhe Gretchens zu Beginn anknüpfen und somit die Überleitung zum Refrain,der diese Unruhe erläutert. Die fünfte Strophe setzt ein mit der Aussage: „Nach ihm nur schau ich / Zum Fenster hinaus“ (V. 3390 f.), welche darlegen soll, dass sie ihre Umwelt gar nicht mehr wahrnimmt, sondern nur Faust noch für sie von Bedeutung ist. Diese Strophe ist ebenso wie die dritte mit einem Parallelismus versehen, der die Verse gegenseitig in Verbindung setzt. Die Strophe endet daher mit der Aussage: „Nach ihm nur geh ich / Aus dem Haus“ (V. 3392 f.). Der Parallelismus ist ebenfalls wie in der dritten Strophe mit der Endgültigkeit bezüglich Gretchens Gefühlen zu deuten. In der sechsten und siebten Strophe wird Faust näher beschrieben. Sie erwähnt „Sein[en] holde[n] Gang, / Sein[e] edle Gestalt, / Seines Mundes Lächeln [und] / Seiner Augen Gewalt“ (V. 3394 ff.). Insgesamt ist diesen Beschreibungen die Tatsache zu entnehmen, dass ihre Gefühle für Faust sehr stark sind. Weiterhin beschreibt Gretchen Fausts Rede als „Zauberfluss“ (V. 3399) und schwärmt von „Sein[em] Händedruck“ (V. 3400) und „sein[em] Kuss“ (V. 3401). Die beiden Strophen bilden einen zusammenhängenden Satz, der mit einem Ausrufezeichen endet und somit die Bedeutung Fausts für Gretchen in Form der Schwärmereien verdeutlicht. In der achten Strophe folgt ein drittes Mal der Refrain des Liedes. Die letzten beiden Strophen sind ebenfalls durch einen zusammenhängenden Satz verbunden. Dem Beginn der neunten Strophe ist zu entnehmen, dass die letzten beiden Strophen Gretchens Sehnsüchte und Wünsche darstellen. Die Strophe setzt ein mit dem Ausdruck: „Mein Busen drängt / Sich nach ihm hin“ (V. 3406 f.), welcher im Gegensatz zu Gretchens vorherigem tugendhaften Verhalten steht. Dies wird ebenfalls im weiteren Verlauf der Strophe: „Ach dürft ich fassen / Und halten ihn“ (V. 3408 f.) deutlich. Auffällig ist hierbei jedoch auch der Moduswechsel von Indikativ zu Konjunktiv. Der Konjunktiv führt wiederholt die Sehnsucht nach Faust und die starken Gefühlte Gretchens vor Augen. Der Moduswechsel besteht bis zum Ende des Gedichtes und gibt, da es sich beim Konjunktiv um die Möglichkeitsform handelt, eine Vorausdeutung auf den weiteren Verlauf der Handlung. Das Lied endet mit dem Wunsch Gretchens: „Und küssen ihn, / So wie ich wollt, / An seinen Küssen / Vergehen sollt!“ (V. 3410 ff.). Das Enjambement, welches die letzten beiden Verse verbindet, deutet auf die Abhängigkeit Gretchens von Faust hin.
Zum Schluss ist festzuhalten, dass Gretchen durch ihre starken Gefühle für Faust eine Abhängigkeit von diesem entwickelt hat. Sie ist bereit selbst ihr Leben für ihn zu geben. Während seiner Abwesenheit verfällt sie einer inneren Unruhe, die teilweise das Gegenteil ihrer sonst tugendhaften Charakterzüge hervorbringt.
Faust: "Kerker" V.4580-4595
Bei dem vorliegenden Textauszug handelt es sich um einen Teil der Szene „Kerker“ aus der Tragödie „Faust – Der Tragödie Erster Teil“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe und veröffentlicht im Jahr 1808. Die Tragödie thematisiert die Suche nach dem Sinn des Lebens. Inhaltlich handelt der Textauszug von der bevorstehenden Hinrichtung Margaretes.
Die Handlung veranschaulicht zudem den Wahnsinn, dem Margarete verfallen ist, nachdem Faust sie verlassen, ihre ganze Familie tot ist und sie ihr eigenes Kind ertränkt hat, sowie ihre Akzeptanz der Todesstrafe. Der Textauszug umfasst 15 Verse. Es liegen unterschiedliche Reimschemen vor, es gibt zwei umarmende Reime, ein Kreuzreim, sowie ein Paarreim und auch zwei reimlose Verse. Das Metrum wird durch drei- bis sechshebige Trochäen gekennzeichnet. Am Ende des Verses liegen sowohl klingende als auch stumme Kadenzen vor.
Der zu analysierende Text setzt ein mit „Tag! Ja es wird Tag! Der letzte Tag dringt herein“ (V. 4580). Die Textpassage ist in einem Trikolon aufgebaut, welches die Akzeptanz ihres Todes von Seiten Gretchens veranschaulicht, da sie am nächsten Tag dem Henker vorgeführt wird. Im weiteren Verlauf erklärt sie „Mein Hochzeitstag sollt es sein“ (V. 4581), was im Kontrast zur Realität steht, da der Hochzeitstag eigentlich der glücklichste Tag im Leben sein sollte und nicht der Tag der Hinrichtung. Dies ist daher auf den Wahnsinn, dem Gretchen verfallen ist zu beziehen. Gretchen fährt fort mit dem Ausruf „Weh meinem Kranze“ (V. 4583). Gemeint ist hierbei der Hochzeitskranz, welcher traditionell am Haus des Hochzeitspaares angebracht wurde um diesem Glück zubringen. Der Hochzeitskranz bildet somit ebenfalls eine Antithese zur Hinrichtung. Mit der Aussage „Es ist eben geschehen“ (V. 4584) wechselt Gretchen vom Hochzeitstag zum Todestag, was die Endgültigkeit dieses Tages und den Wahnsinn dem Gretchen verfallen ist wiederholt vor Augen führt. Im weiteren Verlauf verspricht sie Faust „Wir werden uns wiedersehen“ (V. 4585), womit sie ihm die Möglichkeit auf ein Treffen nach dem Tod in Aussicht stellt und sich somit vorläufig von ihm verabschiedet. Im Kontrast dazu steht der Zusatz „Aber nicht beim Tanze“ (V.4586). Der vorhin erwähnte Tanz ist in diesem Zusammenhang der Hochzeitstanz, der von dem frisch verheirateten Paar getanzt wird. Gretchen erklärt Faust somit indirekt, dass sie ihn nicht heiraten wird, zum einen nicht, weil sie am kommenden Tag getötet wird und zum anderen will sie ihn nicht heiraten oder generell mit ihm zusammen sein, da alles Schreckliche was ihr in der letzten Zeit geschehen ist mit Faust zusammenhängt. Im weiteren Verlauf beschreibt Gretchen „Die Menge drängt sich, man hört sie nicht“ (V.4587), womit sie nun final ihre Hinrichtung thematisiert. Die stumme Menge (vgl. V.4587) steht hier für das Publikum, das damals bei der Hinrichtung zugegen war. Selbst „Der Platz [und] die Gassen / Können sie nicht fassen“ (V. 4588 f.) veranschaulicht, dass zahlreiche Menschen bei einer Hinrichtung erscheinen und Gretchen dies nicht angenehm ist, da es normalerweise nicht ihrem Charakter entspricht sich auffällig in der Gesellschaft zu verhalten. Ihre Erzählung fährt fort mit „Die Glocke ruft, dass Stäbchen bricht“ (V. 4590). Bei einer Hinrichtung wurde in der Regel das Armesünderglöcklein geläutet und über dem Haupt des Hinzurichtenden zerbrach der Richter als Zeichen der endgültigen Verurteilung ein weißes Stäbchen, das er ihm dann vor die Füße warf. Gretchens Wahnsinn lässt sich nicht nur am stetigen Wechsel zwischen Hochzeits- und Todestag belegen sondern auch an der Textpassage „Wie sie mich binden und packen“ (V. 4591), da sie nach wie vor mit Faust im Kerker steht und niemand sie fesselt oder nach ihr greift. Sie berichtet zudem „Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt“ (V.4592). Der „Blutstuhl“ (ebd.) ist eine Metapher für den Stuhl der bei der Hinrichtung verwendet wird, was zusätzlich die wenigen Stunden verdeutlicht, die noch bis zum Todeszeitpunkt vergehen werden. Dies wird ebenso an der Aussage Gretchens „So zuckt nach jedem Nacken / Die Schärfe, die nach meinem zückt“ (V. 4593 f.) ausgedrückt. Die „Schärfe“ (ebd.) steht metaphorisch für die Hinrichtung oder eben die Waffe, die dafür verwendet wird. Der Umstand, dass die Schärfe „nach jedem Nacken [zuckt]“ (V. 4593), verdeutlicht, dass jeder an Gretchens Stelle stehen könnte und sich alle Anwesenden dessen bewusst sind. Die Textstelle endet mit dem Vergleich „Stumm liegt die Welt wie das Grab“ (V. 4595) welcher verdeutlicht, dass Gretchen ihre Hinrichtung vollends akzeptiert hat und sich nicht wiedersetzt. Zudem hebt sich dieser Vers auch formal von den übrigen ab, da dieser über kein Reimschema verfügt und somit die Endgültigkeit Gretchens Hinrichtung vor Augen führt. Die wechselnden Reimschemen, die unterschiedlich langen Trochäen und die verschiedenen Kadenzen verdeutlichen wiederholt den Wahnsinn dem Gretchen verfallen ist.
Zum Schluss ist festzuhalten, dass Gretchen, nach allem was vorgefallen ist, wahnsinnig geworden ist und ihre Hinrichtung akzeptiert hat, obwohl noch die Möglichkeit besteht mit Faust aus dem Kerker zu fliehen. Zentrale Sprachliche Mittel sind das Trikolon zu Beginn der Textstelle, welches die bevorstehende Hinrichtung ankündigt und die zahlreichen Metaphern und Traditionen, die in Bezug zur Hinrichtung stehen. Faust
Abschrift der 1. Klausur
Bei dem vorliegenden Textauszug handelt es sich um einen Teil der Szene „Wald und Höhle“ aus der Tragödie „Faust – Der Tragödie Erster Teil“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe und veröffentlicht im Jahr 1808. Die Tragödie thematisiert die Frage nach dem Meschen in seinen vielfältigen Lebensbezügen<. Inhaltlich handelt der Textauszug von Faust, der einen Monolog führt, in dem er die Natur und seine Verbundenheit zu dieser erläutert. Er befasst sich ebenfalls mit der Vollkommenheit des Menschen, Mephistopholes und Gott. Die Handlung veranschaulicht zudem Fausts Entwicklung von harmonischem Einklang mit der Schöpfung zur Erkenntnis seiner eigenen Begrenztheit, welche sich zudem formal in den zwei Abschnitten des Textes wiederspiegelt. Der Textauszug umfasst 36 Verse und ist im 25. Vers durch eine Leerzeile unterbrochen. Es ist kein Reimschema zu erkennen. Das Versmaß besteht aus 5-hebigen Jamben, die einen harmonischen Rhythmus komplettieren.
Der zu analysierende Text setzt ein mit der Regieanweisung „Faust allein“ (V.1), welche auf einen Monolog hindeutet, da sich keine andere Figur in seiner Nähe befindet. Er beginnt den Monolog mit dem Wortlaut „Erhabner Geist“ (V.2). Dieser Wortlaut verdeutlicht, dass er seinen Monolog einer nicht anwesenden Figur als Gebet widmet, da der Wortlaut dem Beginn eines Gebetes sehr ähnelt. Die darauf folgende Erkenntnis „du gabst mir, gabst mir alles“ (V.2) lässt insbesondere durch die Geminatio „gabst mir“ (ebd.) darauf schließen, dass es sich bei dem angesprochenen Geist um Gott handeln muss, der ihn bisher immer zufrieden gestellt hat. Faust erwähnt auch, dass der Geist ihm „Sein Angesicht im Feuer zugewendet“ (V.4) habe. Das „Feuer“ (ebd.) steht in diesem Zusammenhang für die Verzweiflung, die Faust zu Beginn der Tragödie durchlebt hat. Der Umstand, dass der Geist sich ihm während der Verzweiflung zugewendet hat, belegt ebenfalls, dass es sich bei dem zuvor erwähnten Geist um Gott handelt, da dieser im Wissen, dass Mephistopholes scheitern wird die Wette bezüglich Faust eingegangen ist und Mephistopholes letztendlich doch zu Faust gelassen hat. Gott ist sich schließlich sicher, dass Faust den rechten Weg wiederfindet und nicht der Versuchung durch den Teufel vollständig verfällt. Ein weiterer Aspekt, der die Rolle Gottes als Geist bestätigt, ist die Aussage Fausts „Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich“ (V.5), denn Gott hat die Natur und das Leben geschaffen. Die Tatsache jedoch, dass Faust die Natur als sein „Königreich“ (ebd.) bezeichnet, verdeutlicht seine Arroganz, da er sich eines Herrschers gleich an die Spitze der Natur stellt, obwohl er sie zum einen nicht selbst geschaffen hat und zum anderen auch nur ein unbedeutender Teil davon ist. Faust bestätigt dies, da jemand ihm „Kraft, sie zu fühlen, zu genießen“ (V.6) gab. Das Enjambement „Nicht / Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur“ (V.6 f.) verdeutlicht, dass Faust sich im Einklang mit der Natur befindet, da er ein Teil davon ist und nicht als eine außenstehende Person, wie ein Besucher, nur dass äußere Erscheinungsbild sieht, sondern täglich alles das, was im Inneren verborgen ist, erkundet. Der darauf folgende Vergleich „in ihre tiefe Brust / Wie in den Busen eines Freunds zu schauen“ (V.8 f.) ist ebenfalls Teil eines Enjambements und lässt sich im selben Kontext wie die vorherigen Zeilen deuten. Faust führt seinen Monolog mit der Aussage „Du führst die Reihen der Lebendigen / Vor mir vorbei“ (V.10 f.), veranschaulicht die Tatsache, dass er sich als König sieht und sein Volk in Form von allen Lebewesen an ihm vorbei geführt wird. Der Zusatz „lehrst mich meine Brüder“ (V.11) führt vor Augen, dass er durch seinen Stellenwert in der Natur dieser und seine Mitmenschen, was die Metapher „Brüder“ (ebd.) verdeutlicht, besser kennenlernt. Veranschaulicht wird dies durch verschiedene Metaphern aus der Natur, wie „Busch“ (V.12) oder die Elemente „Luft und Wasser“ (ebd.), die den Pantheismus in Form zweier Lebensnotwendiger Elemente zusätzlich hervorheben. Faust befindet sich in vollkommener Harmonie mit der Natur und Pflanzenwelt, da er selbst den „stillen Busch“ (V.12) als seinen Bruder bezeichnet und sich in den Elementen Luft und Wasser (vgl. V.12) geborgen fühlt. Deutlich wird hieran ebenfalls der Pantheismus, der im gesamten ersten Teil des Gedichtes zu finden ist. Faust führt die Metapher des Sturmes, die eine Antithese zu den vorherigen ruhigen, elementaren Metaphern bildet auf, indem er beschreibt, wie eine „Riesenfichte stürzend Nachbaräste / Und Nachbarstämme quetschend niederstreift / Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert“ (V.14 ff.). Die Metapher des Sturmes ist hier ein entscheidendes Symbol für die Naturthematik welche bereits im Titel „Wald und Höhle“ wieder zu finden ist. Der Wald wurde durchaus in Form der fallenden Bäume thematisiert. Die Symbolik der Höhle wird in Vers 17 aufgegriffen, wenn es heißt: „Dann führst du mich zur sicheren Höhle“ (V.17). Die sichere Höhle bildet eine Antithese zu der zuvor beschriebenen gefährlichen Situation im Wald. Das Pronomen „du“ (V.17) macht deutlich, dass es für Faust nur eine Person, in diesem Fall Gott, gibt, die ihm hilft aus einer gefährlichen Situation hinaus zu finden und für ihn somit als Retter und Beschützer da ist. Nachdem Gott ihn aus der Gefahrensituation befreit hat, zeigt er Faust sich „selbst, und meiner eignen Brust / Geheime tiefe Wunden öffnen sich“ (V.18 f.), was bedeutet, dass Faust seine eigenen Fehler und Charakterzüge, die ihn erst in diese Situation gebracht haben, verdeutlicht und seine eigenen Schwächen somit ins Licht treten. Als nächstes erklärt Faust, ihm schweben „Der Vorwelt silberne Gestalten auf / Und lindern der Betrachtung strenge Lust“ (V.23 f.). Mit „Vorwelt“ (ebd.) ist die Vergangenheit gemeint und die silbernen Gestalten sind Personen, denen er einst Schaden oder Leid zugefügt hat. Der Anblick dieser lässt ihn sein Verlangen nach Wissen zurückhalten, da die Schuld, die er gegenüber jenen Gestalten verspürt, auf seinen Schultern lastet und er bei ihrem Anblick Scham empfindet. Im 25. Vers folgt eine Leerzeile, die das Schamgefühl deutlicher zum Ausdruck bringt und den Text in zwei Teile gliedert. Der zweite wird durch die Interjektion „O“ (V.26) eingeleitet, die eine resignative Stimmung vermuten lässt. Der weitere Wortlaut „dass dem Menschen nichts Vollkommen wird, / Empfinde ich nun“ (V. 26 f.) bestätigt die resignativen Gemütszustand, in dem sich Faust befindet. Fausts Ziel ist es alles zu wissen, auch wenn er weiß, dass dies einem Menschen nicht möglich ist. Daher bezeichnet er den Umstand, dass Gott ihn die Natur lehrt, als eine „Wonne, / Die mich den Göttern nah und näher bringt“ (V.27 f.). Die Steigerung „nah und näher“ (V.28) führt seine Arrogant vor Augen, da er sich schon bald als göttlich betrachtet, auch wenn er nur ein einfacher Mensch ist. Im weitern Verlauf beschreibt Faust Mephistopholes als „den Gefährten, den ich schon nicht mehr / Entbehren kann“ (V.29 f.), auch wenn dieser kalt, frech und erniedrigend ist (vgl. V.30 f.) „und zu Nichts, / Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt“ (V.31 f.). Mephistopholes, der als Teufel Gottes Gegenspieler ist, wird hier in einer antithetischen Darstellung noch einmal als jener identifiziert. Die Adjektive „kalt und frech“ (V. 30) sowie das erniedrigende Verhalten stehen im Gegensatz zu Gottes Verhalten, der Faust schützt und lehrt. Ebenso wird dies an der Tatsache deutlich, dass Mephistopholes keine Hemmungen hat, das was Gott geschaffen hat, zu zerstören (vgl. V.31 f.). Des Weiteren führt Faust auf, dass Mephistopholes „in meiner Brust ein wildes Feuer / Nach jenem schönen Bild geschäftigt an[facht]“ (V.33 f.). Das wilde Feuer steht metaphorisch für das Verlangen nach „jenem schönen Bild“ (V.34), welches wiederum eine Metapher für den Umstand ist, dass Mephistopholes Faust versprach ihm seinen Wunsch nach Wissen zu erfüllen. Der Textauszug endet mit dem Chiasmus „So tauml ich von Begierde zu Genuss, / Und im Genuss verschmacht ich nach Begierde“ (V. 35 f.). Die Nomen „Begierde“ (ebd.) und „Genuss“ (ebd.) bilden den Chiasmus und bringen so zum Ende des Textauszuges die Resignation Fausts zum Ausdruck.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Faust Gott sehr viel verdankt und dies in seinem Monolog auch zum Ausdruck bringt. Er ist sich der Schuld bewusst, in der er bei Gott steht, seitdem er Mephistopholes als Gefährten akzeptiert und bereut sein selbstsüchtiges Verhalten nach Vollkommenheit zutiefst. Zentrale Sprachliche Mittel des Textes sind die Interjektion zu Beginn des zweiten Abschnittes, welche den Wendepunkt in Fausts Entwicklung darstellt, und der Chiasmus am Abschluss des Textauszuges, der die Resignation Fausts zum Ende hin verdeutlicht.
Woyzeck
Inhaltsangabe Woyzeck
Das vorliegende Drama „Woyzeck“ verfasst von Georg Büchner und erschienen im Jahre 1879 thematisiert die gesellschaftlichen Missstände in der Zeit des Vormärzes. Protagonist der Handlung ist der dreißigjährige Soldat Franz Woyzeck, der zu einer der unteren Gesellschaftsschichten gehört und somit von seinen Vorgesetzten ausgenutzt und verspottet wird. Er hat mit seiner Freundin Marie einen gemeinsamen Sohn und ist daher zusätzlich zu seinem eigentlichen Beruf als Forschungsobjekt für einen Doktor tätig, um Marie und das Kind finanziell zu unterstützen. Während der Forschungen vollzieht Woyzeck eine Mangelernährung und wiederfährt dadurch psychische Erkrankungen. Marie betrügt ihm im Laufe der Handlung mit dem Tambourmajor. Woyzeck leidet unterdessen an Halluzinationen, als Nebenwirkung der Forschungen, und hört eine Stimme, die ihm aufträgt Marie, wegen ihres Verrats, zu ermorden. Letztendlich hört Woyzeck auf die Stimme, er tötet Marie und gibt das gemeinsame Kind weg
Der Hessische Landbote Z.70-128
Bei dem vorliegenden Textauszug mit dem Titel „Der Hessische Landbote“, verfasst von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahr 1834, handelt es sich um ein Flugblatt. Thematisiert wird die Unterdrückung der unteren sozialen Schichten. Mögliche Intentionsaspekte sind der Wiederstand gegen die Adligen und Beamten, der Wunsch nach Rechten und Gesetzen, sowie der Gedanke an Deutschland als einen Freistaat. Der zu analysierende Textauszug setzt ein mit dem Appell: „Seht nun, was man in dem Großherzogtum aus dem Staat gemacht hat; seht was es heißt die Ordnung im Staate erhalten!“ (Z.70 f.). Der Appell ist abwertend zu verstehen und stellt sofort zu Beginn der Textstelle das Großherzogtum negativ dar. Zunächst benennt der Autor klare Fakten, wie „700 000 Menschen bezahlen dafür 6 Millionen“ (Z. 72 f.), was ihn zu der Schlussfolgerung kommen lässt, dass diese „zu Ackergäulen und Pflugstieren gemacht [werden], damit sie in Ordnung leben“(Z. 74 f.). Die umgangssprachlichen und negativen Bezeichnungen „Ackergäulen“ (Z.74) und „Pflugtieren“ (ebd.) legen die unmenschlichen Bedingungen dar, die die unteren Bevölkerungsschichten ertragen, nur um die Steuern zahlen zu können, die die Ordnung im Staat erhalten. Als Resultat leitet er daraus ab, dass „In Ordnung leben heißt hungern und geschunden werden“ (Z. 75 ff.) und zieht somit einen weiteren Bezug zum Tiervergleich, da er geradeheraus sagt, dass die Bürger von den wohlhabenden Bevölkerungsschichten wie Arbeitstiere behandelt und gehalten werden. Der Autor fährt mit der rhetorischen Frage „Wer sind denn die, welche diese Ordnung gemacht haben und die wachen, diese Ordnung zu erhalten?“ (Z. 78 ff.) um noch einmal vor Augen zu führen wer seiner Meinung nach Schuld an der Situation der unteren Bevölkerungsschichten trägt. Er beantwortet die Frage im weiteren Verlauf selbst und stellt zudem dar aus welchen Mitgliedern die Regierung zusammengesetzt wird. Er erläutert „Die Regierung wird gebildet von dem Großherzog und seinen obersten Beamten“ (Z. 81 f.), zudem gibt es auch zusätzlich weitere untergeordnete Beamte, „die von der Regierung berufen werden um jene Ordnung in Kraft zu erhalten“ (Z. 83 ff.). Durch die Akkumulation „Staatsräte und Regierungsräte, Landräte und Kreisräte, geistliche Räte und Schulräte, Finanzräte und Forsträte usw. mit allem ihrem Heer von Sekretären“ (Z. 86 ff.) wird veranschaulicht wie viele Personen beim Großherzogtum angestellt sind und dementsprechend bezahlt werden müssen. Die Tatsache das alle Angestellten die Bezeichnung Rat in der Berufsbeschreibung haben, verdeutlicht dass sie nur eine beratende Aufgabe haben und somit nicht alle zwingend notwendig für die staatliche Ordnung sind, aber trotzdem von der Allgemeinheit bezahlt werden. Er vergleicht das Volk mit einer Herde und die Beamten mit ihren „Hirten, Melker und Schinder“ (Z.90 f.). Die Beamten stehen dementsprechend über dem Volk, obwohl sie teilweise selbst Teil des Volkes sind. Zusätzlich merkt er an „sie haben die Häute der Bauern an, der Raub der Armen ist in ihrem Hause; die Tränen der Witwen und Waisen sind das Schmalz auf ihren Gesichtern“ (Z.91 ff.) ein Semikolon trennt die Aufzählung in Form einer Klimax vom Fazit des Autors „sie herrschen frei und ermahnen das Volk zur Knechtschaft“ (Z.94 f.). Die Regierung regiert in einer Art Willkürherrschaft über das Volk, das machtlos unter ihnen steht. Das Verb „regieren“ (Z. 97) definiert der Autor mit der Erklärung „sich von euch füttern zu lassen und euch eure Menschen- und Bürgerrechte zu rauben“ (Z.98 f.). Das Volk wehrt sich nicht gegen die Steuern und die Herrschaft der Regierung, obwohl es ihnen dadurch schlecht geht. Zusätzlich bezeichnet der Autor die Mitglieder der Regierung als „Schurken“ (Z.100), denn „Diese Regierung ist nicht von Gott, sondern vom Vater der Lügen“ (Z.101 ff.) und „den deutschen Kaiser, der vormals vom Volke frei gewählt wurde, haben sie seit Jahrhunderten verachtet und endlich gar verraten“ (Z.105 ff.). Die oberen Gesellschaftsschichten, die zum großen Teil die Regierung bilden, haben somit den vom Volk gewählten und somit von Gott bestimmten Machtinhaber entmachtet und die Macht auf sich selbst übertragen um das Volk zu unterdrücken. Der Autor fügt diesem noch hinzu, dass „ihr Wesen und Tun von Gott verflucht! Ihre Weisheit ist Trug, ihre Gerechtigkeit ist Schinderei“ (Z.111 ff.), was bedeutet das ihre gesamte Regierung auf einem ungerechten und unterdrückendem System basiert. Sie sind nicht so Weise und Gerecht wie sie sich aufführen, sondern handeln nur zu ihrem eigenen Vorteil. Er schließt dieses Argument mit der Behauptung: „Ihr lästert Gott, wenn ihr einen dieser Fürsten einen Gesalbten Herrn nennt“ (Z.115 f.). Im weiteren Verlauf erwähnt der Autor erneut den deutschen Kaiser und erinnert die Bürger daran, dass „unsere freien Voreltern [diesen] wählten“ (Z.121). Im Kontrast dazu stellt er die Tatsache, dass „diese Verräter und Menschenquäler nun Treue von euch [verlangen]!“ (Z.122 ff.), wodurch er zum Abschluss noch einmal zusammenfasst was die Regierung dem Volk angetan hat. Der Autor beendet den Text mit seiner Vision des zukünftigen Deutschlands „als ein Freistaat mit einer vom Volk gewählten Obrigkeit" (Z.127 f.), womit er am Schluss die Intention seines Textes offenlegt. Zum Schluss ist festzuhalten, dass der Autor den Text strukturiert auf seine Intention ausgelegt hat und diese auch im gesamten Inhalt als positive Lösung dargestellt hat, auch wenn seine Argumentation nicht in einem neutralen Stil verfasst wurde konnte er dennoch überzeugende Argumente anbringen, die seine Meinung deutlich vor Augen führen. Er verwendet einige sprachliche Mittel, von denen am Meisten die Akkumulation der Regierungsangestellten und die Tiermetaphorik in Bezug auf das Volk herausstachen.
Parallelen "Der Hessische Landbote" und "Woyzeck"
Der vorliegende Text, mit dem Titel „Der Hessische Landbote“ verfasst von Georg Büchner im Jahre 1834, weist einige Parallelen zum Drama „Woyzeck“, ebenfalls geschrieben von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahre 1879, auf. Büchner erklärt in „Der Hessische Landbote“, dass die Menschen in eine Art Ständegesellschaft gegliedert sind. Dementsprechend sind auch die Figuren im Drama angeordnet: zur oberen Schicht zählen der Hauptmann, der Doktor und der Tambourmajor, zur unteren Schicht zählen dementsprechend Woyzeck und Marie. Woyzeck ist ein Soldat und verdient nur ein geringes Gehalt, das er vollständig Marie überlässt um sie und ihr gemeinsames Kind zu versorgen. Die beiden Leben daher in ständiger Armut, auch wenn Woyzeck durch zusätzliche Arbeiten bei seinem Vorgesetzten und als Forschungsobjekt bei einem Arzt versucht sein Gehalt aufzubessern. Woyzecks Vorgesetzter, der Hauptmann, erhält ein durchaus höheres Gehalt und muss sich dementsprechend wenig Sorgen um seine finanzielle Lage machen. Es ist ihm sogar möglich andere, oder in diesem Fall Woyzeck für tägliche Arbeiten, wie das Rasieren seines Bartes (Szene: „Beim Hauptmann“) zu bezahlen. Zudem wird er in der Szene Straße als äußerst Wohlgenährt beschrieben, was ebenfalls einer höheren Gesellschaftsschicht entspricht. Des Weiteren wären noch der Arzt und der Tambourmajor zu nennen. Der Arzt verwendet Woyzeck für einen zusätzlichen Lohn als Forschungsobjekt und interessiert sich mehr für seine Forschung als für Woyzecks Wohlbefinden. Er bezeichnet ihn daher als „Subjekt“ und „interessanten casus“ (Szene: „Beim Doktor“). Zudem spricht er ihn lediglich in der dritten Person an und redet somit nicht mit ihm wie mit einem Menschen sondern wie mit einem Versuchsobjekt (Szene: ebd.). Der Tambourmajor wird als selbstbewusster und starker Mann beschrieben, dessen Ziel es ist Marie zu erobern (Szene: „Mariens Kammer“). Er befindet sich auf Grund seines militärischen Ranges ebenfalls in einer höheren Gesellschaftsklasse und es ist ihm möglich Marie mit Hilfe von Schmuck zu verführen und Woyzeck somit das einzige zu nehmen, das ihm noch Lieb ist. Büchner stellt in seinem Flugblatt die oberen Gesellschaftsschichten, insbesondere die Regierung, als negativ dar und legt dar, dass diese die unteren Gesellschaftsschichten ausnutzen und nicht menschengerecht behandeln. Er geht sogar so weit dass er die Menschen aus den unteren Schichten als „Ackergäulen“ und „Pflugstieren“ (Z.74) bezeichnet. Diese Bezeichnungen treffen durchaus auf Woyzeck zu, der teilweise unmenschliche und gesundheitsgefährdende Auflagen erträgt, nur um bei den Forschungen des Doktors zusätzliches Geld zu verdienen. Zudem erläutert Büchner, dass in der staatlichen Ordnung leben für die untere Bevölkerungsschicht bedeutet zu „hungern und geschunden [zu] werden“ (Z.76 f.), was ebenfalls Woyzecks aktueller Situation entspricht. Im weiteren Verlauf stellt Büchner die Metapher einer Herde von Tieren (vgl. Z.89 ff.) auf, die der unteren Gesellschaftsschicht entsprechen. Generell ist der Tiervergleich auch im Drama wieder zu finden, da Woyzeck sowohl vom Arzt als auch vom Hauptmann auf den Stellenwert eines Tieres herabgeschraubt und auch dementsprechend behandelt wird. Er führt auf, dass das einfache Volk die Herde der Oberschicht ist und „sie sind seine Hirten, Melker und Schinder“ (Z.90 f.). Im gesamten Drama wird die Oberschicht als dominant und egoistisch dargestellt, wohingegen die Unterschicht am Rande der Armut lebt und sich sogar, wie in Woyzecks Fall für andere Menschen aufopfert. Die Aussage Büchners „sie herrschen frei und mahnen das Volk zur Knechtschaft“ (Z.94 f.), stimmt mit der Art des Tambourmajors überein, der sich ohne auf Woyzecks Lage oder andere Situationen zu achten mit Marie trifft und diese schlussendlich auch verführt, indem er sie mit materiellen Werten beschenkt und somit seine ständische Überlegenheit demonstriert (Szene: „Mariens Kammer“). Zum Schluss seines Flugblattes ruft Büchner das einfache Volk der unteren Bevölkerungsschichten dazu auf sich mit Gewalt gegen die Oberschicht aufzulehnen und die aktuelle Situation nicht zu akzeptieren. Deutschland soll seiner Ansicht nach „als ein Freistaat mit einer vom Volk gewählten Obrigkeit wieder auferstehen“ (Z.127 f.). Diese zentrale Textpassage lässt sich nicht konkret im Drama wiederfinden, obwohl sie die gesamten Aussagen des Flugblattes wiederspiegelt.
Brief Büchners an die Eltern vom 05.April 1833
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Brief Büchners an die Eltern“ verfasst von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahre 1833, handelt es sich um einen Brief an Büchners Eltern in Frankfurt. Thematisiert wird die politische Situation im heutigen Deutschland zur Zeit des Vormärzes. Büchner legt bereits zu Beginn des Briefes seine Meinung zu den gescheiterten Aufständen demokratisch Gesinnter in Frankfurt dar. Seine Eltern hatten ihm von diesen in einem vorherigen Brief berichtet. Büchner unterbreitet diesen seine unmissverständliche Meinung „Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt“ (Z.2 f.). Büchners Meinung nach ist Gewalt somit die einzige Lösung um gegen die Regierung und die Fürsten vorzugehen. Er erläutert zudem dass "Wir wissen, was wir von unseren Fürsten zu erwarten haben" (Z. 3). Büchner ist sich demnach bewusst, dass die Fürsten sich nicht um die Bürger in ihrem Staat kümmern und ihre Forderungen missachten. Dass sie den Forderungen nicht nachkommen zeigt sich auch an Büchners Behauptung "Alles, was sie bewilligten, wurde ihnen durch die Notwendigkeit abgezwungen" (Z.4 f.). Dementsprechend halten die Fürsten und die Regierung die Bürger hin und sprechen ihnen nur die Rechte zu, die sie sich anderenfalls durch Gewalt oder Aufstände erkämpfen würden. Büchner fährt fort mit der Metapher "Und selbst das Bewilligte wurde uns hingeworfen, wie eine erbettelte Gnade und ein elendes Kinderspielzeug, um dem ewigen Maulaffen Volk seine zu eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen" (Z.5 ff.). Das Volk hat demnach den selben gesellschaftlichen Stand wie ein Tier oder ein kleines Kind, was durch den Vergleich der "erbettelten Gnade" (ebd.) oder "ein elendes Kinderspielzeug" (ebd.) deutlich. Zusätzlich wird das Volk als "Maulaffen" (Z.7) bezeichnet, was die Position des Volkes als einfältige Schaulustige darstellt. Die Tatsache, dass die oben genannten Bewilligungen dazu dienen dem „Volk seine zu eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen“ (Z.7 f.) veranschaulicht wiederum die Situation des Volkes, welches durch die erhaltenen Rechte von Aufständen oder ähnlichem abgelenkt wird und die eigentlichen Missstände, unter denen sie leiden, geraten vorerst in Vergessenheit. Aus dieser Metapher heraus zieht Büchner den Vergleich, dass diese Aufstände „eine blecherne Flinte und ein hölzerner Säbel, womit nur ein Deutscher die Abgeschmacktheit begehen konnte, Soldatchens zu spielen“ (Z.8 ff.). Die Metaphern „blecherne Flinte“ (ebd.) und „hölzerner Säbel“ (ebd.) stellen die Zwecklosigkeit dieser Aufstände anhand von tödlichen Waffen dar, die jedoch in einem Material hergestellt wurden, dass diese unbrauchbar und somit ungefährlich macht. Ebenso erläutert er, dass nur ein Deutscher „die Abgeschmacktheit begehen konnte“ (Z.9) mit diesen Waffen „Soldat[...]“ (ebd.) zu spielen. Die Bezeichnung „Soldatchens“ (Z.9 f.) bildet zugleich ein Diminutiv und eine Antithese. Ein Soldat ist in der Regel eine Personifikation von Stärke, das Diminutiv macht diesen jedoch durch die Verniedlichung schwach und bildet somit eine Antithese, die sich gleichzeitig auf die vorherige Metapher beziehen lässt, da ein Soldat mit solchen Waffen zunächst stark wirkt, aber bei näherer Betrachtung als schwach dasteht. Den zweiten Teil seines Briefes leitet Büchner mit der Äußerung „Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor“ (Z.11), welches Verhalten seine zu Beginn erwähnte Ansicht wiederspiegelt. Die Rhetorische Frage „Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand?“ (Z.11 f. betont zusätzlich seine oben genannte Ansicht zum Erfolg der Aufstände durch Gewalt. Die Bezeichnung des „ewigen Gewaltzustand“ (Z.12) verdeutlicht zusätzlich die politische Situation in Deutschland, da die Regierung und Fürsten das Volk gewaltsam dazu drängen ihre Anforderungen zu erfüllen. Büchner beantwortet die Frage daher mit der Begründung „Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind“ (Z.12 f.). Der Kerker steht in diesem Zusammenhang als Metapher für das ungerechte politische System und somit die Missstände von denen die gesamte untere Gesellschaftsschicht betroffen ist. Zusätzlich führt Büchner seine Begründung mit der Erläuterung „wir [merken] nicht mehr, dass wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde“ (Z.13 ff.). Er greift hier die Metapher des Kerkers (vgl. Z.12) wieder auf und ergänzt diese mit Metaphern, wie „angeschmiedeten Händen und Füßen“ (Z.14) und „Knebel im Munde“ (Z.15), die das Volk mit Gefangenen gleich setzen und deren politischen Stand, in dem sie keine Möglichkeit haben frei zu entscheiden oder generell Rechte einzufordern, darlegt.
Abschrift der 2. Klausur
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „An die Familie“ handelt es sich um einen Brief, verfasst von Georg Büchner im Juli 1835 in Straßburg. In seinem Brief thematisiert Büchner die Unterschiede zwischen dramatischen Dichtern, Historikern und Idealdichtern. Der Brief ist in der Literaturepoche des Vormärz entstanden und an die Familie Büchners adressiert. Der zu analysierende Sachtext ist in zwei Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt thematisiert Büchner die Anforderungen, denen dramatische Dichter gerecht werden sollen. Im zweiten Abschnitt setzt er diese Anforderungen in Kontrast zu seiner Vorstellung eines Idealdichters. Der erste Abschnitt (Z.2-15) setzt mit der Aussage Büchners „Was übrigens die sogenannte Unsittlichkeit meines Buchs angeht, so habe ich folgendes zu antworten“ (Z.2 f.) ein. Dieser Wortlaut bildet die Einleitung in die Thematik des ersten Abschnittes. Laut Büchner sei „der dramatische Dichter […] in meinen Augen nicht als ein Geschichtsschreiber“ (Z.3 f.). Büchner ist dementsprechend der Ansicht, dass die kritisierten Unsittlichkeiten in seinem Buch angebracht gewesen seien, da er als dramatischer Dichter automatisch die Rolle eines Historikers einnimmt und die Geschichte daher neutral wiedergegeben müsse. Er bemerkt zudem, dass der Dichter „aber über Letzterem“ (Z.5) stehe. Der Geschichtsschreiber oder Historiker verfüge demzufolge über einen niedrigeren Stellenwert als ein dramatischer Dichter, da der dramatische Dichter laut Büchner einen Geschichtsschreiber verkörpere. Büchner rechtfertigt seine zuvor erwähnte Ansicht mit der Behauptung, „dass [der dramatische Dichter] uns die Geschichte zum zweiten Mal erschafft und uns gleich unmittelbar, statt eine trockene Erzählung zu geben, in das Leben einer Zeit hinein versetzt, uns statt Charakteristiken Charaktere, uns statt Beschreibungen Gestalten gibt“ (Z.5 ff.). Büchner führt in dieser Behauptung die Anforderungen auf, die seiner Ansicht nach einen dramatischen Dichter ausmachen. Als einen Aspekt nennt er, dass ein dramatischer Dichter „die Geschichte zum zweiten Mal erschafft“ (Z.5) und diese im Vergleich zu einem Historiker „unmittelbar“ (Z.5) anstatt wie „eine trockene Erzählung“ (Z.6) wiedergebe. Das Adjektiv „trockene“ (ebd.) in Bezug auf die Erzählungen eines Historikers ist abwertend zu verstehen und bildet somit eine Antithese zum folgenden Wortlaut „in das Leben einer Zeit hineinversetzt“ (Z.6 f.), da dies mit Interesse und Spannung assoziiert wird und somit im Kontrast zum oben genannten Adjektiv steht. Des Weiteren führt Büchner in seiner Behauptung den Parallelismus „uns statt Charakteristiken Charaktere, uns statt Beschreibungen Gestalten“ (Z.8 f.) auf. Der Parallelismus veranschaulicht zusätzlich, dass der dramatische Dichter laut Büchner die Geschichte durch Charaktere und Gestalten in lebendiger Verfassung wiedergebe, anstatt dass er wie ein Historiker die Charakteristik und Beschreibungen einer vergangenen Zeit erläutere. Im weiteren Verlauf erklärt Büchner aus der Perspektive eines dramatischen Dichters, „seine höchste Aufgabe ist, der Geschichte, wie sie sich wirklich begeben, so nahe als möglich zu kommen“ (Z.9 ff.), was zum einen den oben erläuterten Parallelismus bestätigt und zum anderen Büchners persönliches Ziel verdeutlicht. Zum Abschluss des ersten Abschnittes greift er die zu Beginn erwähnte Unsittlichkeit seines Buches noch einmal auf und rechtfertigt diese anhand seiner zuvor aufgeführten Anforderungen eines dramatischen Dichters. Zunächst beschreibt er „Sein Buch darf weder sittlicher noch unsittlicher sein, als die Geschichte selbst“ (Z.11 f.), was vor Augen führt, dass Büchner demnach sein Buch neutral verfasst habe und somit die Realität dem entspricht, was in seinem Buch steht. Letzteres greift Büchner daraufhin noch einmal auf, indem er sich rechtfertigt, dass „die Geschichte […] vom lieben Herrgott nicht zu einer Lektüre für junge Frauenzimmer geschaffen worden [ist], und da ist es mir auch nicht übel zu nehmen, wenn mein Drama ebenso wenig dazu geeignet ist“ (Z.12 ff.). Büchner erklärt somit, dass er nur die von Gott geschaffene Realität wiedergebe. Im zweiten Abschnitt (Z.16-38) führt Büchner zunächst die Aufgaben eines Dichters auf. Dementsprechend erklärt er, „Der Dichter ist kein Lehrer der Moral, er erfindet und schafft Gestalten, er macht vergangene Zeiten wieder auflebe, und die Leute mögen dann daraus lernen, so gut, wie es aus dem Studium der Geschichte und der Beobachtung dessen, was im menschlichen Leben um sie herum vorgeht“ (Z.15 ff.). Zusammenfassend knüpft Büchner mit dieser Erklärung an seine Ergebnisse aus dem ersten Abschnitt an und stellt den Dichter als einen neutralen Beobachter dar, der die Menschen auf vorherrschende Missstände aufmerksam machen soll. Im weiteren Verlauf bezieht sich Büchner wieder auf die in seinem Buch kritisierten Unsittlichkeiten. Er legt dar, wie es aussehen würde, wenn die Dichter diese Unsittlichkeiten generell nicht mehr in ihren Texten erwähnen würden. Büchner behauptet daher sie dürften „keine Geschichte studieren, weil sehr viele unmoralische Dinge darin erzählt werden, müsste mit verbundenen Augen über die Gassen gehen, weil man sonst Unanständigkeiten sehen könnte, und müsste über einen Gott Zeter schreien, der eine Welt erschaffen, worauf so viele Liederlichkeiten vorfallen“ (Z.22 f.). Diese Aufzählung wurde von Büchner in einer Klimax angelegt um die Ironie und die Absurdität, die in dieser Klimax angefangen vom Verbot des geschichtlichen Studiums bis hin zur Beschuldigung Gottes, für alle Liederlichkeiten verantwortlich zu sein, darzustellen. Büchner selbst, so äußert er sich im vorliegenden Brief, antworte auf die Behauptung „der Dichter müsse die Welt nicht zeigen wie sie ist, sondern wie sie sein solle“ (Z.28 f.) mit der Aussage, „dass ich es nicht besser machen will als der liebe Gott, der die Welt gewiss gemacht hat, wie sie sein soll“ (Z.29 ff.). Büchners Aussage ist auf die Projektionstheorie des deutschen Philosophen Ludwig von Feuerbach zu beziehen. In Feuerbachs Theorie projiziert der Mensch alle Eigenschaften und moralischen Vorstellungen des Guten auf Gott mit dem Ziel diese Vorstellung eines Tages selbst zu repräsentieren. Büchner stellt daher den dramatischen Dichter als Beobachter dar, der die Mensch auf die vorherrschenden Missstände aufmerksam machen soll, da die Menschen diese sonst nicht bewusst wahrnehmen und verbessern mit dem Ziel vor Augen eines Tages als ihre Idealvorstellung des Guten zu leben. Am Schluss des Textes geht Büchner noch auf die „sogenannten Idealdichter“ (Z.31 f.) ein. Idealdichter sind Dichter, die, wie die Bezeichnung bereits verdeutlicht, ein bestimmtes Ideal vertreten. Büchner steht diesen kritisch gegenüber. Er bezeichnet ihre Figuren als „Marionetten mit himmelblauen Nasen und affektiertem Pathos“ (Z.33 f.). Die Metapher der „Marionetten“ (ebd.) veranschaulicht, dass die Figuren einem Ideal Folgen und von diesem Abhängig sind. Die metaphorische Beschreibung der „himmelblauen Augen“ (ebd.) und der Wortlaut „affektiertem Pathos“ (ebd.) verdeutlichen, dass die Idealdichter die Welt und auch ihre Werke nach dem vertretenen Ideal richten und somit die vorherrschenden Missstände außer Acht lassen. Büchner setzt sie daher in Kontrast zu Figuren von dramatischen Dichtern die als „Menschen von Fleisch und Blut“ (Z.34) dargestellt werden und „deren Leid und Freude mich mitempfinden macht, und deren Tun und Handeln mir Abscheu oder Bewunderung einflößt“ (Z.35 ff.). Büchner sieht die Figuren der Idealdichter demnach nicht als Charaktere mit realitätsnahen Gefühlen und eigenem Antrieb, sondern als von ihrem Ideal gesteuerte Puppen. Am Ende des Briefes fasst er den Inhalt zusammen: „Mit einem Wort, ich halte viel auf Goethe oder Shakespeare, aber sehr wenig auf Schiller“ (Z.37 f.). Goethe und Shakespeare sind dementsprechend dramatische Dichter und Schiller ist Büchners Ansicht nach ein Idealdichter. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Büchner die dramatischen Dichter als Historiker und neutrale Beobachter sieht, die die Menschen auf vorherrschende Missstände aufmerksam machen. Einige zentrale sprachliche Mittel des Textes sind der Parallelismus in Bezug auf den Unterschied zwischen Historikern und dramatischen Dichtern, sowie die Metaphern am Ende des Textes in Bezug auf Büchners Meinung zu den Idealdichtern.
Aufgabe 2:
Büchners Aussagen treffen in folgenden Punkten auf das Drama „Woyzeck“, ebenfalls verfasst von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahr 1879, zu. Büchner führt als einen seiner ersten Punkte die Tatsache auf, dass dramatische Dichter die Geschichte zum zweiten Mal erschaffen und somit die Leser in das Leben in einer anderen Zeit hineinversetzt. Dies wird durch Charaktere und Gestalten, die dieser Zeit entsprechen, verdeutlicht. Woyzeck, Marie, der Tambourmajor, der Hauptmann und der Doktor stammen aus einer Zeit, in der zum einen nicht die moralischen Vorstellungen der heutigen Zeit (uneheliches Kind; Szene 5) vertreten werden, noch die Verhaltensweise und Menschenrechte (Erbsendiät Woyzeck, medizinische Forschung; Szene 8 / Mord an Marie; Szene 20, Szene 26) den heutigen Vorstellungen entsprechen. Als nächsten Punkt nennt Büchner, dass die Geschichte die Realität widerspiegeln soll. Das Drama „Woyzeck“ thematisiert die gesellschaftlichen Missstände in der Literaturepoche des Vormärz und stellt somit die Ungerechtigkeit der Ständegesellschaft und die Armut der unteren Bevölkerungsschicht aus Sicht des Protagonisten Woyzeck, der der untersten Schicht angehört, dar. Bemerkbar werden die gesellschaftlichen Missstände daran, dass Woyzeck zahlreiche Zusatzarbeiten verrichten muss (Hauptmann rasieren; Szene 5 / Forschungsobjekt für den Doktor; Szene 8), bei denen sich die höher gestellten Mitglieder der Gesellschaft über ihn lustig machen oder ihn unter unmenschlichen Bedingungen leiden lassen, um für seine Freundin Marie und ihr gemeinsames uneheliches Kind zu sorgen. Marie betrügt ihn jedoch im Laufe der Handlung mit dem gesellschaftlich höher gestellten Tambourmajor, der in der Lage ist ihr teuren Schmuck zu schenken. Als weiteren Punkt ist die Tatsache zu nennen, dass keine der Figuren im Drama ein klar definiertes Ideal verfolgt, sondern dass sie die guten und schlechten Seiten ihrer Welt ungeschönt miterleben und der Leser damit zum Mitempfinden angeregt wird und ihre Taten daher für diesen nachvollziehbar sind. Insgesamt sind die Aussagen Büchners auf Grundlage der zuvor genannten Punkte auf das Drama „Woyzeck“ zutreffen.
Effi Briest
Inhaltsangabe Effi Briest
Effie Briest ist zu Beginn des Romans ein 17 jähriges Mädchen, das aus adligem Hause stammt. Gemeinsam mit ihren Eltern lebt sie auf dem Gut Hohen-Cremmen. Die Familie erwartet den Landrat Baron von Innstetten aus Kessin, einen ehemaligen Verehrer von Effies Mutter, zu besuch. Der Baron hält bei seinem Besuch um Effies Hand an und diese lässt sich von ihrer Mutter überzeugen sich zu verloben. Sie heiraten und machen eine Hochzeitsreise nach Italien. Danach zieht Effie zu Innstetten nach Kessin. Effie hat von Beginn an Angst vor dem Haus, jedoch freundet sie sich schnell mit Innstettens Hund Rollo und dem Apotheker Gieshübler an. Im Laufe der Zeit langweilt sich Effie zunehmend, da Innstetten arbeiten muss und sie sich nicht mit den übrigen adligen Damen der Gegend anfreunden will. Am Ende des Jahres wird sie schwanger. Effie vertreibt sich die Zeit mit Spaziergängen. Bei einem Spaziergang trifft sie Roswitha, deren frühere Arbeitgeberin gerade gestorben war. Effie bietet ihr eine Stelle als Kindermädchen für ihr Kind an. Effie bekommt eine Tochter namens Annie. Major Crampas, ein ehemaliger Kamerad von Innstetten, der erst vor kurzem nach Kessin gekommen ist gibt Effie die Hauptrolle in einem Theaterstück, bei dem er Regie führt. Daraufhin reiten Effie und Crampas des öfteren gemeinsam aus. An Weihnachten reist die adlige Gesellschaft der Stadt zum Oberförster, doch auf der Rückfahrt müssen sie den Schloon passieren, was für die Kutschen kaum möglich ist. Da Innstetten eine andere Kutsche fahren muss fährt Crampas mit Effie und sie beginnen eine Affäre. Nach einiger Zeit wird Innstetten nach Berlin versetzt und Effie ist begeistert, da sie nicht mehr in dem Haus und in der Nähe von Crampas leben muss. Sie reist nach Berlin und sucht eine neue Wohnung für die Familie. Nach einigen Jahren erkrankt Effie schwer und muss zur Kur nach Bad Ems. Kurz vor ihrer Rückkehr stürzt Annie und schlägt sich den Kopf auf. Innstetten und der Arzt Doktor Rummschüttel machen sich auf die Suche nach Nähzeug und finden dabei Briefe von Crampas an Effie. Innstetten liest die Briefe und trifft sich mit Crampas zum Duell. Dieser verliert das Duell und Innstetten kehrt nach Berlin zurück. Effie bekommt in der Kur einen Brief von ihrer Mutter. In dem Brief schreibt die Mutter das Innstetten sich von ihr Trennt und sie der Ehre halber nicht zu den Eltern zurückkehren kann. Drei Jahre später lebt Effie mit Roswitha, die nach wie vor zu ihr hält, in einer kleinen Wohnung in Berlin. Irgendwann sieht sie ihre Tochter auf der Straße und überzeugt Innstetten davon, dass Annie sieh besuchen darf. Nach Annies Besuch erleidet Effie einen Nervenzusammenbruch. Effies Arzt schreibt daraufhin einen Brief an ihre Eltern in Hohen-Cremmen, die sie daraufhin wieder aufnehmen. Roswitha reist mit ihr und überredet Innstetten Effie den Hund Rollo zu überlassen. Rollo begleitet Effie von nun an auf ihren Spaziergängen bis sie schließlich krank wird und stirbt. Zuvor vergibt sie Innstetten und findet ihren Frieden.
Vergleich Inhaltsangaben
Wikipedia
- Sachlich
- Sehr ausführlich teilweise zu detailliert (z. B. Zeitungen von Gieshübler, Geschichte des Chinesen, Verhalten Crampas, Theaterstück)
- Zitate in der Inhaltsangabe
- Sehr lang
- Struktur/Geschichtlicher Verlauf wurde beibehalten
Wortwuchs
- Einige wichtige Aspekte fehlen (z. B. Annie, Leben in Kessin, Roswitha)
- Teilweise wertend geschrieben (unglücklich verheiratet, machtlos, bescheidenes Leben, Vergebung zahlt sich nicht aus)
- Tempusfehler im vorletzten Abschnitt: Während Effi auf einer Kur war
- Verhältnismäßig sehr kurz und unvollständig
Dieterwunderlich
- Unwichtige Details (Kunstausstellung während der Hochzeitsreise, Einrichtung des Hauses missfällt Effi, Crampas küsst Effis Hand; Innstettens Zweifel am Duell mit Crampas)
- Zitate in der Inhaltsangabe
- Teilweise Passagen einer Analyse
- Tempus: Präsens
- Teilweise stimmt der Inhalt nicht mit der Handlung des Romans überein (z. B. Besuch Annie und anschließender Zusammenbruch Effis)
- Unsachlich (z. B. ebenso ausführlich wie ermüdend, naive und lebensfrohe junge Frau, pedantisch-korrekte und wenig einfühlsame Mann)
Deutsch Online 1
- Sachlich
- Tempus: Präsens
- Sehr unstrukturiert
- Wiederholung (Verhältnis Effis Mutter zu Innstetten)
- Wichtige Aspekte fehlen (z. B. Annie, Gesundheitszustand Effis, Roswitha, Eltern nehmen sie wieder auf, Tod)
- Sehr knapp und undetailliert
Deutsch Online 2
- alle wichtigen Aspekte ab Annies Geburt vorhanden
- Handlung zuvor wird nicht aufgegriffen
- Sachlich
- Unstrukturiert und unvollständig
- Sprachliche Fehler und Ausdrucksfehler (z. B. ergibt sich ein Bruch, hier wird sie zum ersten Mal relativ glücklich, also)
- Oftmals kein Präsens verwendet (z. B. hatte verbracht, wieder erkannte)
Analyse Romananfang
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Auszug aus dem ersten Kapitel des Romans „Effi Briest“, verfasst von Theodor Fontane und veröffentlicht im Jahre 1896. Thematisiert werden die gesellschaftlichen Erwartungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Protagonistin der Handlung ist die zu Beginn des Romans 17 jährige Effi Briest, die aus adligem Hause stammt. Die Familie erwartet den Landrat Baron Geert von Innstetten aus Kessin zu Besuch, der um Effis Hand anhält. Sie heiraten und ziehen gemeinsam nach Kessin. Am Ende des Jahres wird Effi schwanger. Nach einem Zwischenfall an Weihnachten beginnt Effi eine Affäre mit Major Crampas. Innstetten wird einige Zeit später nach Berlin versetzt und seine Familie zieht mit ihm. Mehrere Jahre lang führt die Familie ein ruhiges Leben in Berlin, bis Innstetten auf Briefe stößt, die Crampas vor langer Zeit an Effi geschrieben hatte. Er duelliert sich mit Crampas, wobei dieser stirbt, und trennt sich von Effi. Effi, die nicht nur von Innstetten sondern auch von ihren Eltern der Ehre halber verstoßen wurde, erleidet nach dem Besuch ihrer Tochter drei Jahre später einen Nervenzusammenbruch und wird daraufhin von ihren Eltern wieder aufgenommen. Mit 30 Jahren stirbt Effi.
Mögliche Intentionsaspekte sind die Situation der Frauen im 19. Jahrhundert und die Kritik an der damaligen Gesellschaft.
Der Roman setzt mit der Beschreibung des Ortes ein. Der Ort ist in diesem Fall das „schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohen-Cremmen“ (Z. 1 f.). Kurfürst Georg Wilhelm herrschte von 1620 bis 1640 in Preußen. Die Handlung des Romans spielt im zu Beginn des 19. Jahrhunderts, was darauf schließen lässt dass es sich bei der Familie Briest um eine schon seit langer Zeit bestehende Adelsfamilie handelt, besonders auch daran zu erkennen, dass sie in einem Herrenhaus leben. Herrenhäuser bewohnten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Familien, die über den größten Teil der Fläche verfügt und daher eine sichere finanzielle Lage innehaben. Weiterhin wird beschrieben, dass „heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße“ (Z. 3) fällt. Diese Beschreibung deutet auf ein harmonisches und idyllisches zu Hause hin. Als nächstes wird die „Park- und Gartenseite“ (Z. 5) des Gebäudes beschrieben. Insgesamt wird bereits an der Beschreibung ihrer Heimat der Charakter Effis deutlich. Neben der nach außen hin präsentierten adligen und harmonischen Familienseite, wird durch den Garten Effis natürliche Seite dargestellt. Allerdings wirft „ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen breiten Schatten erst auf einen weißen und grün quadrierten Fliesengang“ (Z. 5 f.). Der Fliesengang, der in den Garten führt wird nach und nach von dem Schatten eingenommen, was darauf hindeutet, dass eine schwierige Zeit bevorsteht, die Effis natürliche Seite nach und nach einnimmt. Neben dem Fliesengang befindet sich im Garten auch ein „großes in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Canna indica und Rhabarberstauden besetztes Rondell“ (Z. 8 f.). Die Sonnenuhr ist in diesem Fall ein Symbol für die Lebenszeit Effis, je weiter der Schatten reicht, desto weniger Zeit bleibt ihr. Im Kontrast dazu steht die Canna indica. Der Name der Pflanze bedeutet übersetzt zeitlos. Das Rondell unterstützt diese Symbolik zusätzlich, da es sich hierbei um einen Kreis handelt und ein Kreis über keinen Anfang und somit ebenso über kein Ende verfügt. Des Weiteren wird eine „ganz in kleinblättrigem Efeu stehende, nur an einer Stelle von einer kleinen, weiß gestrichenen Eisentür unterbrochenen Kirchhofsmauer“ (Z. 11 ff.). Die Mauer mit dem „kleinblättrigen Efeu“ (Z. 11) steht symbolisch für einen gefestigten Glauben, besonders Efeu ist in Bezug auf den Glauben ein weit verbreitetes Symbol. Efeu steht einer alten christlichen Tradition entsprechend für einen tief verwurzelten Glauben. Die Tatsache, dass die Mauer auf dem Gut der Briests steht verdeutlicht deren Religiosität. Effi wird in dieser Symbolik als das weiße Tor dargestellt. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Noch ist Effi unschuldig, allerdings wird das Tor nicht für alle Zeiten so strahlend weiß wie am Anfang bleiben, ebenso wenig wie Effi. Dies wird ebenfalls durch den „Hohen-Cremmer Schindelturm mit seinem blitzenden, weil neuerdings erst wieder vergoldeten Wetterhahn“ (Z. 13 ff.). Als nächstes wird dargelegt, dass „Fronthaus, Seitenflügel und Kirchhofsmauer […] ein einen kleinen Ziergarten umschließendes Hufeisen [bildeten]“ (Z. 15 ff.). Das Symbol des Hufeisens steht für Glück und passt zu der idyllischen Ausstrahlung des Ortes. Auch die offene Seite des Hufeisens ist geschlossen durch einen „Teich[…] mit Wassersteg und angeketteltem Boot“ (Z. 18 f.). Der Teich ist ebenso wie der Schatten eine Metapher für Gefahr. Das „angekettelte Boot“ (Z. 19) veranschaulicht Effis Liebe zur Gefahr. Der Unterschied zwischen angekettelt und angekettet besteht darin, dass das Verb angekettet mit etwas unüberwindbarem in Verbindung gebracht wird, jedoch bedeutet das Verb „angekettelt“ (Z. 19), dass es zwar einen Wiederstand gibt, welcher jedoch verhältnismäßig leicht zu überwinden ist. Weiterhin veranschaulicht auch die Tatsache, dass „dicht daneben einer Schaukel gewahr wurde, deren horizontal gelegtes Brett zu Häupten und Füßen an je zwei Stricken hing – die Pfosten der Balkenlage schon etwas schief stehend“ (Z. 19 ff.). Die Schaukel steht für Effis kindlichen und freiheitsliebenden Charakter. Effi wird in diesem Fall ebenso mit dem Brett in Verbindung setzen, da dieses „zu Häupten und Füßen an je zwei Stricken hing“ (Z. 20 f.). Nicht nur das Brett ist mit Seilen an die Schaukel gefesselt, sondern auch Effi. Sie ist an die gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit gebunden und kann sich nicht von ihnen lösen, ohne von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Die Tatsache, dass „die Pfosten der Balkenlage schon etwas schief“ (Z. 20 f.) stehen führt vor Augen, dass Effi sehr gerne Schaukelt, da dies nur durch die ständig pendelnde Bewegung eines Gewichtes geschehen kann und Effi das einzige Kind im Haus ist. Die Beschreibung schließt mit dem Wortlaut „Zwischen Teich und Rondell aber und die Schaukel halb versteckend standen ein paar mächtige alte Plantanen“ (Z. 21 f.). Werden die erarbeiteten Interpretationen betrachtet so stehen die „alten Plantanen“ (Z. 23) zwischen Effis Liebe zu Gefahr und ihrer Lebenszeit, dabei verdecken sie ebenso ihre kindliche Seite. Die Plantanen könnten dementsprechend Effis Eltern symbolisieren, da diese versuchen die Seiten ihrer Tochter zu beschützen oder zu verbergen, die nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechen.
Auf sprachlicher Ebene fällt neben der sehr bildhaften Sprache besonders der hypotaktische Satzbau auf. Beides verhilft zu einer verständlichen und lebhaften Beschreibung.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschreibung des Ortes schon vorab einen Einblick in das weitere Geschehen und Effis Charakter. Besonders zu betrachten sind hierbei die zahlreichen Metaphern bezogen auf die Natur und die Symbolik der Pflanzen.
Analyse Kapitel 17 S.114/115
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Auszug aus dem ersten Kapitel des Romans „Effi Briest“, verfasst von Theodor Fontane und veröffentlicht im Jahre 1896. Thematisiert werden die gesellschaftlichen Erwartungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Die vorliegende Textstelle handelt von einem Ausritt Effis mit dem Major Crampas. Effi, die Protagonistin des Romans, ist zu Beginn der Handlung 17 Jahre alt und stammt aus adeligem Hause. Die Familie erwartet von ihr, dass sie den Landrat Baron von Innstetten aus Kessin heiratet. Nach der Hochzeit ziehen sie gemeinsam nach Kessin und nur wenig später bringt Effi ihre Tochter Annie zur Welt. Nach und nach kommt Effi dem erst kürzlich in die Stadt gezogenen Major Crampas näher. Sie verbringen viel Zeit zusammen, sehr zum Vergnügen Effis, die während Innstettens Arbeitszeit an Langeweile leidet. Nach einem Zwischenfall an Weihnachten, beginnt Effi schließlich eine Affäre mit Major Crampas. Innstetten wird einige Zeit später nach Berlin versetzt und seine Familie zieht zu ihm. Mehrere Jahre lang führt die Familie ein ruhiges Leben in Berlin, bis Innstetten auf Briefe stößt, die Crampas vor langer Zeit an Effi geschrieben hatte. Er duelliert sich mit Crampas, wobei dieser stirbt, und trennt sich von Effi. Effi, die nicht nur von Innstetten, sondern auch von ihren Eltern der Ehre halber verstoßen wurde, erleidet sie drei Jahre später beim Besuch ihrer Tochter einen Nervenzusammenbruch und wird daraufhin von ihren Eltern wieder aufgenommen. Mit 30 Jahren stirbt Effi.
Die Textstelle ist in sofern für den weiteren Verlauf der Handlung wichtig, als dass das Verhältnis zwischen Crampas und Effi verdeutlicht wird und somit die später folgende Affäre angedeutet wird, die letzten Endes Effis Leben zerstört.
Möglichhe Intionsaspekte sind die Situation der Frauen im 19. Jahrhundert und die Kritik an der damaligen Gesellschaft.
Die Textstelle setzt mit der Beschreibung der Umgebung ein. Es heißt „Der Ritt ging wie gewöhnlich durch die Plantage hin“ (S.114 Z.10). Der Wortlaut „wie gewöhnlich“ (ebd.) veranschaulicht, dass solche Ausritte eine gewisse Routine für beide darstellen, was zunächst auf ein freundschaftliches Verhältnis hindeutet. Jedoch ist nicht nur die Umgebung angegeben, sondern auch die Reihenfolge in der sich die kleine Gruppe fortbewegt, „Rollo war wieder vorauf, dann kamen Crampas und Effi, dann Kruse“ (S.114 Z.10 f.). Die Tatsache, dass Effi und Crampas auf gleicher Höhe reiten, verdeutlicht, dass sie das Zentrum der Gruppe bilden und auf einer Augenhöhe sind, was ebenfalls ein freundschaftliches Verhältnis bestätigt. Während des Ausrittes führen Effi und Crampas eine formlose Unterhaltung. Auf die Frage, wo Knut, Crampas Kutscher, der sie eigentlich auf ihren Ausflügen begleitete, geblieben sei, antwortet ihr Crampas, er habe „einen Ziegenpeter“ (S.114 Z.14). Die Bezeichnung „Ziegenpeter“ ist heute unter der Krankheit Mumps bekannt, die sehr ansteckend ist und eigentlich im Kindesalter auftritt. Auf diese Äußerung reagiert Effi vergnügt mit der Entgegnung „Eigentlich sah er schon immer so aus“ (S.114 Z.15 f.) in Bezug auf Knuts Krankheit. Bei Mumps schwellen in der Regel eine, wenn nicht sogar beide Backen stark an. Diese Reaktion spricht für Effis kindlichen Charakter, der den Ernst der Krankheit nicht begreift oder begreifen will und sich lieber an den Unannehmlichkeiten der Kranken erfreut. Crampas geht auf ihr Verhalten ein und erwidert „Sehr richtig. Aber Sie sollten ihn jetzt sehen!“ (S.114 Z.17). Allerdings wirft er kurz danach ein „Oder lieber doch nicht. Denn Ziegenpeter ist ansteckend, schon bloß durch Anblick“ (S.114 Z.17 f.) ein. Diese Aussage veranschaulicht zum Einen, dass er sich Sorgen um ihren Gesundheitszustand macht und sie zum Anderen gleichzeitig aufzieht, um sie zu amüsieren. Er hat dementsprechend ein großes Interesse an Effis Wohlbefinden, sowohl körperlicher als auch psychischer Seits. Effi, die jedoch in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen ist und dementsprechend gebildet ist, entgegnet ihm eigensinnig „Glaub ich nicht“ (S.114 Z.20) und verdeutlicht somit, dass sie ihm intellektuell nicht unterlegen ist und sich von ihm nicht aufziehen lässt. Crampas jedoch lässt sich nicht davon beirren und behauptet „Junge Frauen glauben vieles nicht“ (S.114 Z.21). Mit dieser Behauptung schmeichelt er Effi, die von Innstetten immer noch wie ein Kind behandelt wird. Effi, die neben ihren sehr kindlichen Charakterzügen auch Wiederwillen und die Liebe zur Gefahr aufweist, schlägt auf seine Behauptung ohne zu Zögern mit der Bemerkung „Und dann glauben sie wieder vieles, was sie besser nicht glaubten“ (S.114 Z.22 f.), um Crampas vor Augen zu führen, dass sie ihm trotz ihres jungen Alters und ihrer eigenwilligen und kindlichen Charakterzüge durchaus ebenbürtig ist, an. Durch die Frage Crampas „An meine Adresse“ (S.114 Z.24) und der darauf folgenden Verneinung Effis wird verdeutlicht, dass Crampas Eindruck auf sie machen möchte und sie zu verführen versucht. Jedoch hat er nicht mit Effis bestehendem Wiederstand gerechnet, was durch den Ausdruck „Schade“ (S.114 Z.26) aufgezeigt wird. Auch Effi sind die Absichten des Majors durchaus bewusst, weshalb sie ihn auch unmittelbar darauf anspricht, „Ich glaube wirklich Major, Sie hielten es für ganz in Ordnung, wenn ich Ihnen eine Liebeserklärung mache“ (S.114 Z.27 ff.). Der Major hingegen entgegnet „So weit will ich nicht gehen“ (S.114 Z.30), auch wenn es vorhin einen anderen Anschein gemacht hat. Allerdings ergänzt er seine Aussage auch mit dem Wortlaut „Aber ich möchte den sehen, der sich dergleichen nicht wünschte. Gedanken und Wünsche sind zollfrei“ (S.114 Z.30 f.). Effi geht auf diese Feststellung ein, indem sie den Unterschied zwischen Gedanken und Wünschen erläutert, der da wäre „Gedanken sind in der Regel etwas, das noch im Hintergrunde liegt, Wünsche aber liegen meist schon auf der Lippe“ (S.114 Z.34 ff.). Mit dieser Erläuterung trifft sie bei Crampas auf Missfallen, der sie bittet „nicht gerade diesen Vergleich“ (S.114 Z.37) zu wählen. Der Umstand, dass das Pronomen „diesen“ (ebd.) kursiv gedruckt ist, veranschaulicht, dass der eben genannte Vergleich sowohl mit Effis Erläuterung, als auch mit Crampas Versuch sie zu verführen in Verbindung steht. Effi will daraufhin etwas erwähnen, allerdings lässt das Repetitio „Sie sind… Sie sind…“ (S.114 Z.38) darauf schließen dass ihr kein passender Vergleich für Crampas Persönlichkeit einfällt. Er versucht ihr auszuhelfen, indem er den Vorschlag macht, ihn mit „Ein Narr“ (S.114 Z.39) zu vergleichen. Effi verneint diesen Vergleich jedoch und versucht es mit Worten aus ihrer alten Heimat zu beschreiben „In Hohen-Cremmen „sagen wir immer, und ich mit, das Eitelste was es gäbe, das sei ein Husarenfähnchen von achtzehn…“ (S.114 Z.40 ff.). Zum jetzigen Zeitpunkt ist es ihr allerdings möglich zu sagen „das Eitelste, was es gibt, ist ein Landwehrs-Bezirksmajor von zweiundvierzig“ (S.115 Z.2 f.). Sie bezeichnet ihn dementsprechend als das Eitelste, das sie je gesehen habe und nicht als reifer als einen achtzehnjährigen, unterwürfigen Soldaten. Der Major versucht die Beleidigung mit Humor zu überspielen, indem er anmerkt „Wobei die zwei Jahre, die Sie mir gnädigst erlassen, alles wieder gutmachen“ (S.115 Z.4 f.). Effi fährt fort und berichtet dem Major von Wienern, die ihr in Karlsbad den Hof gemacht haben und von welchen sie durchaus ungezogenes gehört habe (vgl. S.115 Z.6 ff.). Nach einer kurzen Pause und keiner folgenden Entgegnung Seitens Crampas wechselt Effi das Thema und macht den Major auf die Umgebung aufmerksam. Mit der Textpassage „Aber sehen Sie da die Bojen, wie die schwimmen und tanzen. Die kleinen roten Fahnen sind eingezogen. Immer, wenn ich diesen Sommer, die paar Mal wo ich mich bis an den hinauswagte, die roten Fahnen sah, sagt‘ ich mir: da liegt Vineta, da muss es liegen, das sind die Turmspitzen…“ (S.115 Z.11 ff.). Vineta ist eine Stadt, die laut einer Sage wegen des Unmoralischen Handelns der Bewohner in der Ostsee versunken sein soll. Die Tatsache, dass Effi sich die Stadt unterhalb der Bojen vorstellt ist zum Einen eine Vorausdeutung auf ihr weiteres Verhalten in Bezug auf Crampas und ist ebenso auf ihren kindlichen Charakter zurückzuführen, welcher nun die zuvor entschlossene Willensstärke im Gespräch mit Crampas ersetzt. Des Weiteren wird der Aspekt der Vorausdeutung durch die roten Fahnen bestätigt, die zwar eingezogen sind, aber dennoch vorhanden sind. Die Farbe Rot ist ein Symbol für Gefahr und verdeutlicht einerseits Effis Liebe zur Gefahr und andererseits die Vorausdeutung, dass sie sich in Gefahr begibt.
Als Schauplatz der Textpassage werden die Plantagen nahe Kessin genannt. Unter Plantagen werden die Dünen am Meer bezeichnet, was auf eine raue Umgebung hindeutet, in der es unter Umständen schwierig ist, sich zu unterhalten. Der Textauszug wurde in personalem Erzählverhalten verfasst, was das persönliche und freundschaftliche Verhältnis von Effi und Crampas verdeutlicht, da beide Ansichten dargestellt werden. Zusätzlich dazu ist auch das Redemittel des Dialogs zu erwähnen, welcher das Erzählverhalten unterstützt. Zudem wird der Handlungsverlauf zeitdeckend dargestellt, sodass das Gespräch einen sehr nahen Bezug zur Realität erhält.
Zum Schluss ist festzuhalten, dass Effi durch mehr als einen Charakterzug gekennzeichnet ist und sich Crampas dessen nun auch bewusst ist. Er, der schon zuvor als Damenmann bezeichnet wurde, hat besonders in dieser Textpassage seinen Ruf bestätigt. Formal ist festzuhalten dass es im Gespräch des Öfteren Pausen gibt, die meist durch drei Punkte gekennzeichnet werden. Die Textstelle bietet zudem eine Vorausdeutung für die spätere Affäre Effis mit dem Major.
Analyse Kapitel 19 S.136
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Auszug aus dem neunzehnten Kapitel des Romans „Effi Brist“, verfasst von Theodor Fontane und veröffentlicht im Jahr 1896. Thematisiert werden die gesellschaftlichen Erwartungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Die vorliegende Textstelle handelt von einer Kutschfahrt am Silvesterabend. Die adlige Gesellschaft von Kessin war beim Oberförster zu Gast und kehrte mit Kutschen und Schlitten zurück nach Kessin. Innstetten musste die Kutsche eines anderen Adligen fahren und Crampas nahm daher neben Effi Platz. Effi, die Protagonistin des Romans, ist zu Beginn der Handlung 17 Jahre alt und stammt aus adligem Hause. Die Familie erwartet von ihr, dass sie den Landrat Baron von Innstetten aus Kessin heiratet. Nach der Hochzeit ziehen sie gemeinsam nach Kessin und nur wenig später bringt Effi ihre Tochter Anni zur Welt. Nach und nach kommt Effi dem erst kürzlich in die Stadt gezogenen Major Crampas näher. Sie verbringen viel Zeit zusammen, sehr zum Vergnügen Effis, die während Innstettens Arbeitszeit an Langeweile leidet. Nach einem Zwischenfall am oben genannten Abend, beginnt Effi schließlich eine Affäre mit dem Major. Innstetten wird einige Zeit später nach Berlin versetzt und seine Familie zieht zu ihm. Mehrere Jahre lang führt die Familie ein ruhiges Leben in Berlin, bis Innstetten auf Briefe stößt, die Crampas vor langer Zeit an Effi geschrieben hatte. Er duelliert sich mit Crampas, wobei dieser stirbt, und trennt sich anschließend von Effi. Effi, die nicht nur von Innstetten, sondern auch von ihren Eltern der Ehre halber verstoßen wurde, erleidet sie drei Jahre später beim Besuch ihrer Tochter einen Nervenzusammenbruch und wird daraufhin von ihren Eltern wieder aufgenommen. Mit 30 Jahren stirbt Effi.
Die Textstelle ist insofern fundamental für die weitere Handlung, als dass die Affäre zwischen Effi und Crampas ihren Anfang nimmt.
Mögliche Intentionsaspekte sind die Situation der Frauen im 19. Jahrhundert und die Kritik an der damaligen Gesellschaft.
Der zuf analysierende Textauszug setzt ein mit der Beschreibung „Effi war einen Augenblick unschlüssig“ (Z. 1). Ihr ist durchaus bewusst, dass es sich nach den gesellschaftlichen Konventionen nicht gehört alleine mit einem anderen Mann als dem Ehemann ohne Aufsicht in einer Kutsche zu fahren. Jedoch hatte Innstetten zuvor Crampas den Auftrag erteilt sich zu Effi in die Kutsche zu setzen, damit diese nicht alleine fahren muss. Aus diesem Grund „rückte [sie] rasch von der einen Seite nach der anderen hinüber“ (Z. 1 f.), damit „Crampas […] links neben ihr Platz [nehmen]“ (Z. 2 f.) konnte.
Zudem wird erläutert, dass „Er […] deutlich [sah], daß Effi nur tat, was nach Lage der Sache das einzig Richtige war“ (Z. 6 f.), was belegt, dass ihr die Situation nicht behagte, da sie keinerlei Schutz oder Kontrolle, wie es sonst die Male gewesen war hatte. Ebenso sieht sie ein, dass es „unmöglich [war], sich seiner Gegenwart zu verbitten“ (Z.7 f.). Sie ist also mehr oder weniger dazu gezwungen mit ihm in einem Schlitten zu fahren, wenn sie nicht Innstettens Misstrauen erregen wollte. Im weiteren Verlauf wird die Umgebung beschreiben. Effi und Crampas führen in ihrem Schlitten „den anderen Beiden Schlitten nach, immer dicht an dem Wasserlauf hin, an dessen Ufer dunkle Waldmassen aufragten“ (Z. 8 ff.). Die Umgebung, in der sich Effi befindet vermittelt einen sehr bedrohlichen Eindruck. Der „Wasserlauf“ (Z. 9), auch bezeichnet als Schloon, ist für die Schlitten ziemlich gefährlich, da es schon zuvor wegen des Wassers zu einer kritischen Lage gekommen war. Auch die zuvor beschriebenen „dunkle[n] Waldmassen“ (Z. 10) bestärken die bedrohliche Stimmung. Besonders das Adjektiv „dunkel“ (Z. 10) in Bezug auf die Waldmassen verdeutlicht eine gewisse Gefahr die sich um Effi herum aufbaut. Dieser Umstand wird ebenso durch Effis Verhalten deutlich, Effi nahm an, dass sie „an dem landeinwärts gelegenen Außenrand des Waldes hin die Weiterfahrt gehen würde“ (Z. 11 ff.), also folglich „den Weg entlang, auf dem man in früher Nachmittagsstunde gekommen war“ (Z. 13 f.). Diese Überlegungen verdeutlichen, dass Effi der gefährlichen und bedrohlichen Umgebung entfliehen will und entsprechend in ein helles, besiedeltes Gebiet fahren möchte, in welchem sie sich nicht mehr allein mit Crampas befindet. Der Umstand, dass „Innstetten […] sich inzwischen einen anderen Plan gemacht [hatte]“ (Z. 14 f.) veranschaulicht, dass er trotz der Gerüchte rund um Crampas, diesem Vertraut und sich keine Gedanken über Effis Wohlergehen oder eventuelle Sorgen macht. Dies wird ebenso dadurch bestätigt, dass sein Plan beinhaltet „statt den Außenweg zu wählen, in einen schmaleren Weg ein[ zu biegen], die mitten durch die dichte Waldmasse hindurchführte“ (Z. 16 ff.). Besonders auffallend an der Wortwahl sind die Adjektive „schmal“ (Z. 17) und „dicht“ (Z. 18), die in Bezug auf die Umgebung die bedrohliche Atmosphäre zusätzlich verstärken. Ebenso wird dadurch Innstettens unempfindsame Art gegenüber Effis Gefühlen und Ängsten deutlich. Dies wird gleichermaßen durch die Schilderung „Effi schrak zusammen“ (Z. 18 f.) bekräftigt. Auch die Umgebung passt sich der bedrohlichen Situation weiterhin an. ES wird beschrieben, dass „Bis dahin […] Luft und Licht um sie her gewesen [waren], aber jetzt war es damit vorbei und die dunklen Kronen wölbten sich über ihr“ (Z. 19 ff.). Die „dunklen Kronen“ (Z. 20) stellen metaphorisch die Vorausdeutung auf die Entwicklung dieser Schlittenfahrt da, denn Effi ist Crampas, der jederzeit über sie herfallen könnte, hilflos ausgeliefert. Im weiteren Verlauf heißt es „Ein Zittern überkam sie“ (Z. 21), was Effis unbehagliche Situation und ihre Angst vor der fortlaufenden Fahrt mit Crampas verdeutlicht. Dies wird ebenso an der folgenden Reaktion „sie schob die Finger fest ineinander, um sich Halt zu geben“ (Z. 21 f.) aufgezeigt.
Figurenvergleich Innstetten - Woyzeck
Bei den vorliegenden Texten handelt es sich um das Drama „Woyzeck“, verfasst von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahre 1879, sowie der Roman „Effi Briest“, verfasst von Theodor Fontane und veröffentlicht im Jahre 1896. Im Folgenden werden die Figuren Franz Woyzeck aus dem gleichnamigen Drama und Baron Geert von Innstetten, welcher zu den zentralen Figuren im Roman „Effi Briest“ zählt.
Zu Beginn sind die grundlegenden Angaben über beide Figuren zu nennen. Franz Woyzeck ist ein dreißigjähriger Soldat und Protagonist der Handlung. Gemeinsam mit seiner Freundin Marie hat er ein Kind. Neben seiner Tätigkeit als Soldat arbeitet er ebenso als Laufbursche für seinen Vorgesetzten und als Versuchsobjekt für einen Arzt, da sein Gehalt als Soldat nicht ausreicht um seiner kleinen Familie ein angemessenes Leben bieten zu können (Szene 2, Szene 5). Der vierunddreißigjährige Baron Geert von Innstetten dahingegen arbeitet als Landrat in Kessin. Zu Beginn des Romans heiratet er die siebzehnjährige Effi Briest. Sie leben im Laufe der Handlung mit ihrer Tochter Annie in Kessin und später in Berlin (Kapitel 1, Kapitel 14, Kapitel 22).
Generell lassen sich bereits bei den grundlegenden Angaben Unterschiede zwischen den beiden Figuren feststellen. Woyzeck ist ein Soldat, der obwohl er zusätzliche Arbeiten verrichtet, mit seinem Gehalt seiner Familie kein zufriedenstellendes Leben bieten kann, wohingegen Innstetten einen gut bezahlten Beruf ausübt und im Laufe der Handlung sogar befördert wird (Kapitel 22). Ebenso lässt sich dadurch die gesellschaftliche Stellung der beiden Figuren ermitteln. Woyzeck gehört als einfacher Soldat einer unteren Gesellschaftsschicht an, weshalb er von seinem Vorgesetzten und dem Doktor, die beide einer gehobenen Gesellschaftsschicht angehören, verspottet wird (Szene 5, Szene 8). Innstetten gehört als Baron und Landrat zur gehobenen Bevölkerungsschicht und verkehrt gemeinsam mit Effi in den adligen Kreisen von Kessin (Kapitel 9).
Auch die Intentionen der beiden Figuren sind verschieden. Obwohl sie beide viel arbeiten und durchaus fleißig sind, tun sie dies aus unterschiedlichen Gründen. Woyzeck ist gezwungen zu arbeiten um seine Familie zu ernähren und um Marie bei sich zu halten, da diese danach strebt einer höheren gesellschaftlichen Schicht anzugehören. Innstetten verbringt sehr viel Zeit im Landratsamt und lässt seine junge Ehefrau meist alleine zu Hause sitzen. Seine Ambition liegt in erster Linie darin seine Karriere fortzusetzen und zum Ministerialrat befördert zu werden (Kapitel 5).Besonders in der Beziehung zu Effi bzw. Marie werden die Unterschiede zwischen beiden Figuren näher erläutert. Sowohl Innstetten, als auch Woyzeck werden im Laufe der Handlung betrogen. Effi betrügt Innstetten mit Major Crampas, einem ehemaligen Kameraden von Innstetten, der ihr die Zeit und Aufmerksamkeit schenkt (Kapitel 17), die Innstetten Effi auf Grund seiner Karriere dies vorenthält. Marie betrügt Woyzeck mit dem gesellschaftlich höher gestellten Tambourmajor, welcher in der Lage ist ihr Schmuck zu schenken (Szene 4).
Nachdem der Betrug aufgedeckt worden ist begehen beide Figuren einen Mord. Innstetten tötet Crampas bei einem Pistolenduell (Kapitel 28)und Woyzeck tötet Marie. Hierbei spielen jedoch ebenso die Motive der beiden Figuren eine bedeutende Rolle, da diese wiederrum unterschiedlich sind. Innstetten duelliert sich mit dem Major, da die Gesellschaft die der Ehre halber von ihm erwartet und trennt sich lediglich von Effi, wobei er diese weiterhin finanziell unterstützt und sie auch einmal ihre Tochter sehen lässt (Kapitel 30). Woyzeck dahingegen konfrontiert den Tambourmajor und wird bei dem darauf stattfindenden Kampf selbst verletzt (Szene 14). Da er die Affäre der beiden jedoch nach wie vor nicht ertragen kann und durch die Experimente des Doktors geistlich krank geworden ist, ersticht er am Ende des Dramas bei einem Spaziergang Marie und gibt das gemeinsame Kind weg (Szene 19).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Woyzeck und Innstetten unterschiedlichen Gesellschaftsschichten angehören und über eine nahezu identische Familiensituation verfügen. Beide haben eine Frau, bzw. Freundin, und ein Kind. Auch die weitere Handlung ist in großen Teilen inhaltsgleich. Sie arbeiten den größten Teil des Tages und werden am Ende von Effi und Marie betrogen. Jedoch unterscheidet sich diese wiederum durch die Reaktion der Figuren auf den Betrug.
Poetischer Realismus
Der poetische Realismus ist eine europäische Literaturepoche am Ende des 19. Jahrhunderts, die auf den Zeitraum zwischen 1848 und 1890 datiert wird. Somit beendet sie die Romantik und löst den Vormärz und Biedermeier ab. Zudem leitet sie ebenso den Naturalismus ein.
Das zentrale Thema der Literaturepoche bildet der bürgerliche Mensch. Die Bezeichnung „Realismus“ wird dadurch definiert, dass eine Sache wirklichkeitsnah bzw. wirklichkeitstreu oder lebensecht dargestellt wird. Dies bildet zudem eines der zentralen Merkmale der Epoche. Als wesentliche epische Gestaltungsmittel gelten der Roman und die Novelle, wohingegen in der Lyrik häufig Dinggedichte verwendet, die in Alltagssprache und nicht mit überladener Metaphorik verfasst werden. Das Drama befindet sich in dieser Epoche weitgehend im Hintergrund. Weiterhin bedienen sich die Autoren hauptsächlich der poetischen Sprache um die Realität darzustellen. Im Gegensatz zum späteren Naturalismus wird die Realität nicht radikal und unmissverständlich beschrieben. In ihren Werken stehen sie selbst meist als objektiver Beobachter dar, was besonders durch die für die Epoche typische auktoriale Erzählperspektive und die melancholische Stimmung deutlich wird. Zusätzlich bedienen sie sich der Ironie als zentrales Stilmittel und einer überschaubaren Figurenkonstellation rund um den Protagonisten. Die Werke zeigen das realistische Einzelschicksal eines Protagonisten, über welchen sie die Leser am Ende selbst ein Urteil bilden können.
Auch der historische Hintergrund bildet eine wesentliche Rolle in der Literatur. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es einige gesellschaftliche Veränderungen, die zunehmend die Unzufriedenheit der Bevölkerung hervorrufen. Der Epoche geht die gescheiterte Märzrevolution im Vormärz zuvor und die Gesellschaft hat nach der aufreibenden Zeit wieder in den Alltag zurückgefunden. Allerdings steht ebenso die beginnende Industrialisierung im Vordergrund, welche mehr und mehr Menschen in die Städte treibt, da ihnen die Existenzgrundlagen auf dem Land entzogen werden. Zuvor bestand die städtische Bevölkerung aus dem gehobenen Bürgertum, den Adligen und einigen Klerikern. Dies ändert sich nun und das Bürgertum der Städte steht nun der wachsenden Arbeiterschicht gegenüber, was zu gesellschaftlichen Spannungen und Auseinandersetzungen führt. Ebenso bilden die wachsende Arbeitslosigkeit und die überlaufenen Städte Probleme für die einfache Bevölkerung. Durch die Entwicklung der Gesellschaft wurde überdies ein Werteverfall hervorgerufen, da altbewährte Normen, wie beispielsweise die Ständegesellschaft oder das christliche Weltbild infrage gestellt wurden.
Wichtige Vertreter dieser Epoche waren Theodor Fontane, Gottfried Keller, Gustav Freytag, Adalbert Stifter, Theodor Storm und Marie von Ebner-Eschbach
Bewertung
Webseite
- eintönige Gestaltung (keine Bilder, keine Farben, nur schwarz und weiß)
- gute Gliederung
- sehr einfach gehalten
- Inhaltlich richtig und verständlich
- kein Autor; keine sonstigen Angaben
- sehr eingeschränkt
- generell irgendwie fraglich
- kein Jahr/Zeitangabe
Video
- Alltagsbeispiele (generell Beispiele)
- sehr gut erklärt
- gute und passende Bilder
- Jugend bzw. Alltagssprache wird verwendet
- leicht verständlich
- gut gestaltet (Sprecherin, Bilder, Text etc.)
- sehr aktuell (vor 1 Woche)
- speziell für Deutsch ausgelegt
Abschrift der 3. Klausur
Analyse:
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Auszug aus dem 24. Kapitel des Romans „Effi Briest“, verfasst von Theodor Fontane und veröffentlicht im Jahr 1895. Der Textauszug handelt von Effis Besuch in Hohen-Cremmen, genauer gesagt vom Abend vor der Abreise zurück zu Innstetten nach Berlin.
Effi Briest, die zu Beginn des Romans siebzehnjährige Protagonistin, heiratet auf den Wunsch ihrer Mutter hin deren ehemaligen Verehrer Landrat Baron Geert von Innstetten aus Kessin. Nach der Hochzeitsreise zieht Effi zu Innstetten nach Kessin. Da Innstetten jedoch mehr an seiner Karriere interessiert ist, langweilt sich Effi zunehmend, besonders da sie bei der übrigen adligen Gesellschaft keinen Anschluss findet oder finden will. Am Ende des Jahres wird sie schwanger und bringt ihre Tochter Annie zur Welt. Major Crampas, ein ehemaliger Kamerad Innstettens, ist erst von kurzem in die Stadt gezogen und verbringt viel Zeit mit Effi. Nach einem Zwischenfall bei der Rückfahrt am Weihnachtsabend beginnen die Beiden eine Affäre. Innstetten erreicht einige Zeit später seine Beförderung zum Ministerialrat und die ganze Familie zieht nach Berlin. Im Sommer verreisen Effi und Innstetten gemeinsam, während Annie und ihre Amme Roswitha bei Effis Eltern in Hohen-Cremmen zu Besuch sind. Effi stößt zum Ende ihrer Reise dazu, jedoch ohne Innstetten, der arbeiten muss. Nach ihrer Rückkehr aus Hohen-Cremmen wird Effi krank und begibt sich zur Kur nach Bad Ems. Während bereits die Vorbereitung für ihre Rückkehr stattfinden stößt sich Annie zu Hause in Berlin den Kopf und muss verbunden werden. Auf der Suche nach einer Kompresse findet Innstetten Briefe von Crampas an Effi. Der Ehre halber fordert er Crampas zum Duell heraus, bei welchem letzterer stirb. Innstetten trennt sich von Effi und die Eltern teilen ihr in einem Brief mit, dass sie wegen des gesellschaftlichen Ansehens nicht zu ihnen zurückkehren kann. Drei Jahre später lebt Effi mit Roswitha in einer kleinen Wohnung in Berlin. Nach dem lang ersehnten Besuch ihrer Tochter erleidet Effi einen Nervenzusammenbruch, woraufhin die Eltern sie wieder aufnehmen. Sie stirbt im Alter von 30 Jahren.
Mögliche Intentionsaspekte sind die Erinnerung Effis an ihre glückliche Kindheit und die metaphorische dargestellte vergehende Lebenszeit.
Die zu analysierende Textstelle setzt mit der Beschreibung „Die von ihr im oberen Stockwerk bewohnten Zimmer lagen nach dem Garten hinaus“ (Z.1) ein. Effi befindet sich nach der Reise mit Innstetten bei ihren Eltern in Hohen-Cremmen. Sie ist zudem ohne ihren Mann hierher gereist, da dieser in Berlin arbeiten muss, während der Rest der Familie noch eine Woche in Hohen-Cremmen verbringt. Effi verhält sich in dieser Zeit wieder wie eine Tochter, anstatt sich wie eine Ehefrau zu benehmen. Dies wird durch den Umstand bestätigt, dass die Zimmer „nach dem Garten hinaus“ (Z.1) ausgerichtet sind, da Effi den Garten als Kind sehr geliebt und oft mit ihren Freundinnen darin gespielt hat.
Die Textstelle wird fortgeführt mit der Beschreibung, bezogen auf die Aufteilung der Zimmer, „in dem kleineren schliefen Roswitha und Annie, die Tür nur angelehnt, in dem größeren, das sie selber innehatte, ging sie auf und ab“ (Z. 1 ff.). Im Kontrast zum Beginn der Textstelle wird diese Passage durch Semikola abgetrennt, da dort Tätigkeiten beschrieben werden und nicht die Anordnung von Räumen oder Gegenständen. Die Tatsache, dass „Roswitha und Annie [schliefen]“ (Z.2) verdeutlicht, dass bereits Abend oder eher Nacht ist, aber Effi, die „auf und ab“ (Z.2) geht, nicht zur Ruhe kommen kann. Die unruhige Atmosphäre wird ebenso durch die hypotaktische Satzstruktur sowie besonders durch die zahlreichen Nebensätze belegt. Der auktoriale Erzähler, welcher ein charakteristisches Merkmal für die Literaturepoche des poetischen Realismus ist, berichtet zudem von einem distanzierten Erzählstandort, da er weder die Gefühle oder Gedanken, noch den Grund für ihre Ruhelosigkeit angibt.
Es wird weiterhin erwähnt, dass „die unteren Fensterflügel […] geöffnet [waren], und die kleinen, weißen Gardinen bauschten sich in dem Zuge, der ging, und fielen dann langsam über die Stuhllehne, bis ein neuer Zugwind kam und sie wieder frei machte“ (Z. 3 ff.). Die „kleinen, weißen Gardinen“ (Z. 4) bekräftigen die unruhige Atmosphäre, die der Grund ist, weshalb Effi so ruhelos ist. Es wird aufgeführt, die „Gardinen bauschten sich in dem Zuge, der ging“ (Z.4). Effi, die nervös oder beunruhigt im Zimmer umherläuft, steigert sich in diese Gefühle hinein und die Atmosphäre wird noch unruhiger. Weiterhin gibt es aber auch Momente, in denen sie sich beruhigt, welche dadurch dargestellt werden, dass die Gardinen „dann langsam über die Stuhllehne [fallen]“ (Z.5). Durch die Ergänzung „bis ein neuer Zugwind kam und sie wieder freimachte“ (Z. 5 f.) wird veranschaulicht, dass Effis Gefühle und Gedanken zwischen ruhelos und beruhigend umherspringen, was ebenfalls damit korrespondiert, dass sie, wie vorhin erwähnt, im Zimmer auf und ab geht. Die Beschreibung der Gardinen ist zeitdeckend, was die Situation realistischer erscheinen lässt.
Im weiteren Verlauf der Textstelle wird dargelegt, dass es im Zimmer „so hell [war], dass man die Unterschriften unter den über dem Sofa hängenden und in schmalen Goldleisten eingerahmten Bildern deutlich lesen konnte“ (Z. 6 f.). Bei den Bildern handelt es sich einmal um „Der Sturm auf Düppel, Schanz V“ (Z. 8) und um „König Wilhelm und Graf Bismarck auf der Höhe von Lipa“ (Z. 8 f.). Bei beiden Orten, die die Bilder zeigen, handelt es sich um bedeutende Kriegsschauplätze. Effi betrachtet die Bilder und bemerkt daraufhin, „‘Wenn ich wieder hier bin bitt´ ich mir andere Bilder aus; ich kann sowas kriegerisches nicht leiden‘“ (Z. 9 ff.). Effi ist durch ihren Charakter und ihr behütetes Aufwachsen sehr kindlich geprägt, sodass sie die Situation oder die Grundlage hinter Kriegen nicht begreifen oder nicht wahrhaben will. Sie verbindet mit Hohen-Cremmen Frieden und Glück, zwei Konstanten, mit denen sie aufgewachsen ist.
Aus diesem Grund „schloss sie das eine [kursiv] Fenster und setzte sich an das andere, dessen Flügel sie offen ließ“ (Z. 11 f.). Effi verschließt mit dieser Handlung metaphorisch gesehen ihre negativen oder beunruhigenden Gedanken und wendet sich ihren positiven Erinnerungen zu, die sie noch aus ihrer Kindheit hat. Dies wird formal durch die kursive Schreibweise des Satzteils „eine“ (Z. 11) bezogen auf das nun geschlossene Fenster deutlich. Durch die Wendung hat sich ebenfalls der Erzählstandort des auktorialen Erzählers geändert. Der auktoriale Erzähler berichtet nicht mehr distanziert über Effis Taten, sondern ist nun nah bei ihn, denn es wird festgestellt, „Wie tat ihr das alles so wohl“ (Z. 12) in Bezug auf die Zeit, die Effi in Hohen-Cremmen verbracht hat und die Erinnerungen, die sie mit diesem Ort verbindet. Es liegt neben dem Wechsel des Erzählstandortes auch ein Wechsel des Raumes vor. Zu Beginn wird das Zimmer, in dem sich Effi befindet, beschrieben, nach dem Wechsel jedoch wird der Garten beschrieben, der im Gegensatz zum begrenzten Zimmer über eine deutlich größere Weite verfügt. Es wird dargelegt, dass „Neben dem Kirchturm […] der Mond [stand] und […] sein Licht auf den Rasenplatz mit der Sonnenuhr und den Heliotropbeeten [warf]“ (Z. 12 ff.). Die Raumgestaltung gibt, wie auch zu Beginn und Ende des Romans, Aufschluss auf das, was mit Effi geschieht beziehungsweise geschehen wird. Zu Beginn der Passage wird der Kirchturm genannt, welcher Teil der hufeisenartigen Anordnung der Gebäude in Hohen-Cremmen ist, die Effi Schutz bieten. Der Mond, welcher „Licht auf den Rasenplatz mit der Sonnenuhr und den Heliotropbeeten [wirft]“ (Z. 13 f.), ersetzt in diesem Fall die Sonne und zeigt auf der Sonnenuhr, die metaphorisch für Effis Lebenszeit steht, die Zeit an, die ihr noch bleibt, bis sie stirbt. Bekräftigt wird dies ebenso durch die „Heliotropbeete[.]“ (Z. 14), denen die Bedeutung der Sonnenwende zugeschrieben wird und die somit auch ein Symbol für vergehende Zeit sind.
Zudem wird beschrieben, „Alles schimmerte silbern, und neben den Schattenstreifen lagen weiße Lichtstreifen“ (Z. 14 f.). Der Kontrast der „Schattenstreifen“ (Z. 14) zu den „weißen Lichtstreifen“ (Z. 15), verdeutlicht bezogen auf die Lebenszeit Effis, dass schon einige Zeit vergangen ist, welche als dunkel oder schwarz dargestellt wird, aber immer noch genug unverbrauchte Lebenszeit in weiß vorhanden ist. Diese „weißen Lichtstreifen“ (ebd.) werden in einem Vergleich als „so weiß [beschrieben], als läge Leinwand auf der Bleiche“ (Z. 15), was die Unverbrauchtheit der Lebenszeit bekräftigt. Als nächstes wird erläutert, „Weiterhin aber standen die hohen Rhabarberstauden wieder, die Blätter herbstlich gelb“ (Z. 15 f.). Auf Grund der Tatsache, dass diese Aussage durch die adversative Konjunktion „aber“ (Z. 15) eingeleitet wird, die einen Gegensatz zum vorangegangenen Text hervorruft. Dieser Gegensatz besteht aus den hohen Rhabarberstauden, mit den „herbstlich gelb[en]“ (Z. 16) Blättern, welche darauf hindeuten, dass die Pflanze bald sterben wird und somit die vergehende Zeit noch einmal thematisiert.
Effis Gedanken kreisen derweil um die Zeit vor der Ehe, in der sie mit ihren Freundinnen im Garten gespielt hat (vgl. Z. 17 f.) und „eine Stunde später […] Braut“ (Z. 18 f.) war. Mit dieser Erinnerung endet die Textstelle.
Zum Schluss ist festzuhalten, dass Effi an ihrer Heimat Hohen-Cremmen als friedlicher und liebevoller Ort festhält und den negativen Aspekten in ihrem Leben durch die Erinnerungen, die sie mit der Heimat verbindet, entfliehen. Zentrale formale Analyseergebnisse des Textes sind die metaphorische Gestaltung der Zeit durch Uhr, Pflanzen und Licht, sowie die räumliche Gestaltung, die entscheidend für Effis Charakter ist und der Erzählstandort.
Vergleich Effi und Marie:
Die Figuren Effi Briest, aus dem gleichnamigen Roman, verfasst von Theodor Fontane und veröffentlicht im Jahr 1895, und Marie aus dem Drama „Woyzeck“, verfasst von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahr 1879, lassen sich an Hand von Gemeinsamkeiten und Unterschieden miteinander vergleichen. Zunächst ist die grundlegende Situation zu erläutern. Effi stammt aus adligem Hause, ist mit Landrat Baron Geert von Innstetten verheiratet und hat eine Tochter mit dem Namen Annie. Marin hingegen lebt in ärmlichen Verhältnissen, ist nicht mit Woyzeck verheiratet und hat demnach einen unehelichen Sohn. Generell besteht ein Unterschied darin, zu welcher Gesellschaftsschicht die Frauen angehören und aus welcher ihre Partner stammen.
Ein weiterer Unterschied liegt in der Erziehung der Kinder. Während Effi ihre Tochter von einer Amme großziehen lässt (Kapitel 13, Kapitel 14), zieht Marie ihren Sohn alleine groß (Szene 2), da sie sich keine Amme leisten kann. Aus diesem Aspekt lässt sich ebenso die Freizeitbeschäftigung der jungen Frauen schlussfolgern. Während Marie den Haushalt erledigt und das Kind versorgt und erzieht (Szene 2), langweilt sich Effi in Kessin, die für solche Tätigkeiten Angestellte hat (Kapitel 6).
Der nächste zentrale Unterschied ist das Verhalten ihrer Partner. Innstetten, der stets an seine Karriere denkt, lässt Effi dementsprechend of alleine zu Hause und nimmt sich wenig Zeit für sie (Kapitel 6, Kapitel 22). Woyzeck hat ebenfalls nicht viel Zeit für Marie, jedoch übt er mehrere Tätigkeiten aus um Geld zu verdienen, damit er für sie und das Kind sorgen kann. Er liebt sie aufrichtig und verbringt so oft es möglich ist Zeit mit ihr (Szene 3). Eine Gemeinsamkeit der beiden Frauen ist also, dass ihre Partner kaum Zeit für sie haben, was jedoch an unterschiedlichen Gründen liegt, welche gleichzeitig einen Kontrast bilden.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist zudem, dass beide im Verlauf der Handlung ihre Partner betrügen, allerdings ebenso aus unterschiedlichen Gründen, die mit den Intentionen der Frauen einhergehen. Marie, die ihr Leben in der unteren Gesellschaftsschicht verbracht hat, wünscht sich einen sozialen Aufstieg und Reichtum. Der Tambourmajor ist Teil einer höheren Gesellschaftsschicht und verfügt über genügend Geld um Marie Geschenke, wie z. B. Ohrringe zu machen (Szene 6, Szene 12). Effi hingegen wünscht sich Zeit und Aufmerksamkeit, zwei Kriterien einer Beziehung, für die Innstetten wegen seiner Karriere keine Zeit hat. Crampas jedoch ist in der Lage mit ihr auszureiten, ihr zuzuhören und ihr Komplimente zu machen (Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 19). Daraus resultiert wiederum ein weiterer Unterschied, und zwar, wie die Frauen mit der Affäre umgehen. Effi macht sich später Vorwürfe Innstetten hintergangen zu haben und ist zudem erleichtert, als er ihr verkündet sie werden nach Berlin ziehen (Kapitel 21, Kapitel 24). Marie sucht dahingegen Trost in der Bibel (Szene 17).
Als letztes ist auch der Unterschied aufzuführen, wie die Frauen sterben. Effi stirbt im Beisein ihrer Eltern in ihrer geliebten Heimat an einer Krankheit (Kapitel 36), wohingegen Marei von Woyzeck erstochen wird (Szene 20).
Es lässt sich zusammenfassen, dass die Frauen von außen betratet ein paar Gemeinsamkeiten, wie die Familiensituation oder die Affäre haben. Allerdings überwiegen die Unterschiede, besonders die Intentionen der Frauen betreffend, die finanzielle Lage und die gesellschaftliche Stellung betreffend.
Die Marquise von O...
Inhaltsangabe Die Marquise von O...
Die Novelle setzt mitten in der Handlung mit dem Einblick in eine Zeitungsannonce, verfasst von der Marquise Julietta von O…, ein, welche nach dem Vater ihres ungeborenen Kindes sucht. Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie mit ihren beiden Kindern bei ihren Eltern, dem Obrist und der Obristin von G… . Während der Übernahme des Wohnortes der Familie, wird die Marquise von russischen Soldaten entführt und misshandelt. Der russische Offizier Graf F… rettet sie aus der Hand der Soldaten. Der General erteilt den Befehl, die Soldaten, welche die Marquise misshandelt haben, zu erschießen. Kurz darauf ziehen die Truppen weiter, sodass die Marquise keine Gelegenheit hat, sich bei ihrem Retter zu bedanken. Letzterer fällt angeblich wenige Tage später auf dem Schlachtfeld. Nach einigen Wochen kehrt Graf F… jedoch überraschend zum Elternhaus der Marquise zurück und hält um deren Hand an. Er befindet sich auf einer Dienstreise nach Neapel und lässt sich erst überzeugen weiterzuziehen, als die Marquise ihm verspricht, bis zu seiner Rückkehr keinen Anderen zu heiraten. Kurz darauf bemerkt die Marquise, dass sie schwanger ist und wird von ihren Eltern verstoßen, da sie nicht weiß wer der Vater des Kindes ist. Sie zieht mit ihren Kindern auf den Landsitz in V… . Dort widmet sie sich der Erziehung ihrer Kinder und dem Haushalt. In diesem Haus macht Graf F… ihr erneut einen Antrag, den sie jedoch ablehnt. Daraufhin gibt sie die zu Beginn erwähnte Annonce auf. Frau von G… besucht ihre Tochter und lässt sich von ihrer Unschuld überzeugen, woraufhin die Marquise zurück ins Elternhaus kehren darf. Graf F… erfährt unterdessen von der Annonce und trifft sie im Haus der Eltern, wo er ihr seine Schuld gesteht. Die Marquise wendet sich von ihm ab, allerdings heiraten sie am Tag darauf, da sie das Versprechen, welches sie in der Annonce gegeben hat, halten muss. Graf F… bezieht eine Wohnung in der Stadt und sieht seine Frau erst bei der Taufe des gemeinsamen Sohnes wieder. Wegen seines tadellosen und entschlossenen Verhaltens wird er immer mehr in die Familie integriert und bereits ein Jahr später verzeiht die Marquise ihm und gibt ihm zum zweiten Mal das Jawort.
Stellungnahme 1
Die Aussage „Der Autor parodiert spitz und präzise die Brutalität der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und ihr Versagen“ in Bezug auf die Novelle „Die Marquise von O…“, verfasst von Heinrich von Kleist und veröffentlicht im Jahre 1808, ist durchaus nachvollziehbar.
Die Novelle kann in ihrer Gesamtheit durchaus als Parodie verstanden werden, da die durchaus ernsthafte Situation in einigen Fällen überspitzt und ironisch dargestellt wurde, beispielsweise in Bezug auf die Diagnose der Schwangerschaft durch den Arzt und die Hebamme. Zudem werden viele Szenen, wie beispielsweise der Konflikt zwischen Vater und Tochter, als der Vater nach der Pistole greift und ein Schuss in die Decke gefeuert wird, sowie die Versöhnung zwischen Vater und Tochter sehr dramatisch dargestellt. Ebenso zu erwähnen ist das unvollziehbare Verhältnis zwischen Mutter und Tochter zu beginn und später zwischen Vater und Tochter.
In der Novelle ist ebenso die in der Aussage erwähnte Brutalität der bürgerlichen Gesellschaftsordnung zu erwähnen, da es zum einen geächtet wird, dass die Marquise unbewusst schwanger geworden ist, ihr kein Glauben geschenkt wird und letzten Endes von der Gesellschaft sogar erwartet wird, dass die Eltern sich von ihr abwenden, da ansonsten die gesamte Familie von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Ebenso verdeutlicht auch das Verhalten innerhalb der Familie, dass die gesellschaftlichen Konventionen eine große Rolle spielen und dass dadurch kein harmonisches Familienleben möglich ist. Beispielsweise wird sowohl von Vater, als auch Bruder erwartet dass sie in bestimmten Situationen den Raum verlassen und dass die Frauen ihnen unterstellt sind. Diese wiederrum müssen sich fügen und zumindest die Marquise traut sich am Anfang der Novelle nicht ihren Eltern zu wiedersprechen.
Insgesamt gesehen ist die Aussage aus den oben aufgeführten Gründen zurecht auf die Novelle zu beziehen, da Kleist das Leid der Marquise und ihrer Familie auf Grund der gesellschaftlichen Konventionen in einer überspitzten und ironischen Art und Weise darstellt.
Die Rede als Stilmittel der Personengestaltung
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Die Rede als Stilmittel der Personengestaltung“, handelt es sich um einen Auszug aus dem Buch „Bauformen des Erzählens“, verfasst von Eberhart Lämmert und veröffentlicht im Jahre 1993 in Stuttgart. Der Sachtext thematisiert die Bedeutung der wörtlichen Rede für den Charakter einer Figur.
Der zu analysierende Text setzt mit der Aussage „Es ist kein Zufall, dass jene Erzählungen, die auf Charakterdarstellung angelegt sind, sich eben durch ihren besonders großen Redeanteil von der ‚fabulierenden‘ Epik absondern“ (Z. 1 f.) ein. Bereits die Formulierung zu Beginn „Es ist kein Zufall“ (Z. 1) deutet auf eine Behauptung oder eher eine These hin. Unter „jene Erzählungen, die auf Charakterdeutung angelegt sind“ (Z.1) werden epische, aber auch dramatische Texte zusammengefasst, welche zur Analyse der einzelnen Figuren oder der zusammenhängenden Figurenkonstellation ausgelegt sind, beispielsweise Romane, Novellen oder Dramen. Dies wird ebenfalls darin bestätigt, dass Lämmert anführt, dass diese „sich eben durch ihren besonders großen Redeanteil von der ‚fabulierenden‘ Epik absondern“ (Z. 1 f.). Der Umstand, dass das Verb fabulieren, hier im Partizip I als „‘fabulierend‘“ (Z. 2) aufgeführt, in Anführungszeichen dargestellt wird, zeigt, dass es die „‘fabulierende‘ Epik“ (Z. 2) nicht als offizielle Gattung gibt. Unter diesem Begriff werden jene Textsorten der Epik aufgeführt die durch die Fantasie ihres Verfassers hervorgerufen werden, wie beispielsweise Märchen oder Fabeln. Demnach ist festzuhalten, dass der Autor in seiner ersten These verdeutlicht, dass er der Ansicht ist Texte, die auf die Analyse von Figuren oder Figurenkonstellationen aufgebaut sind, heben sich durch ihren höheren Anteil an wörtlicher Rede von fantasievollen Erzählungen ab.
Als nächstes führt der Autor an, dass „die Quantität der Rede nichts […] über die Art und die Subtilität der Personencharakterisierung [aussagt]“ (Z. 4 f.). Bei dieser Textpassage handelt es sich ebenso um eine Behauptung und somit eine weitere These des Autors. Allerdings schränkt Lämmert mit dieser Aussage seine vorherige These ein. Er führte zuvor an, dass der höhere Anteil an wörtlicher Rede Texte, die sich auf Figurenanalyse beziehen, ausmacht. Nun wiederrum führt er an, dass die Häufigkeit der wörtlichen Rede „nichts […] über die Art und die Subtilität der Personencharakterisierung [aussagt]“ (Z. 4 f.). Demnach kann die Menge der wörtlichen Rede nicht viel über den Charakter einer Figur enthüllen. Weiterhin erwähnt Lämmert, dass „Die Rede […] ebenso zur Dokumentierung allgemein-typischer Seelenhaltungen des Menschen wie zu individueller Personencharakteristik genutzt werden [kann]“ (Z. 5 f.). Nach der Auffassung des Autors ist demnach die wörtliche Rede ein bedeutsames Mittel „zur Dokumentierung allgemein-typischer Seelenhaltungen des Menschen“ (Z. 5 f.), genauso wie „zu[r] individuelle[n] Personencharakteristik“ (Z. 6). Es fällt auf, dass der Autor in den ersten beiden Abschnitten des Textauszuges lediglich Thesen anführt und diese weder auf Beispiele noch auf Belege stützt.
Im nächsten Abschnitt heißt es „So lässt der Redereichtum einer Erzählung an sich nur die eine allgemeine Feststellung zu, in der sich in der Tat alle die angeführten Dichtungen verschiedenster Epochen begegnen“ (Z. 8 f.). Diese Textpassage verdeutlicht, dass die Menge der Rede in einer Erzählung einen ganz bestimmten Zweck hat, welcher in literarischen Texten „verschiedenster Epochen“ (Z. 9) zu finden ist. Dieser wird wie folgt beschrieben: „Die Vorstellung menschlicher Reaktion dominiert bei ihnen gegenüber der Kundgabe bloßer Aktionen und Begebenheiten“ (Z. 9 ff.), was so viel bedeutet, wie dass die Charaktere im Vordergrund stehen und nicht lediglich deren Handlungen. Seine eben erst aufgestellte These schränkt er wieder, wie bereits einige Zeilen zuvor, ein. Lämmert stellt fest, dass „diese Hervorkehrung menschlicher Reaktionen nicht schlechthin als das Mittel verstanden werden [darf], schicksalshafte Bezüge zwischen Mensch und Welt dichterisch auszudrücken“ (Z. 11 ff.). Demnach wird durch die wörtliche Rede der Charakter in den Vordergrund gerückt, jedoch kann diese nicht oder nur ansatzweise dazu verwendet werden das übrige Geschehen der Handlung oder beispielsweise den Ort zu beschreiben. Der Autor führt daraufhin seinen Text mit der adversativen Konjunktion „Doch“ (Z. 13) fort. Diese Konjunktion veranschaulicht, dass der nachfolgende Satz im Kontrast zu der vorrausgehenden Aussage steht. Er ist der Auffassung, dass „jeweils die Art und Weise bezeichnend [ist], in der Mensch und Welt gebannt werden“ (Z. 13 f.). Mit dem Ausdruck „Art und Weise“ (Z. 13) wird verdeutlicht, dass es darauf ankommt wie etwas gesagt wird, als das was gesagt wird. Die Tatsache, dass sich ebenen dies auf die wörtliche Rede bezieht wird durch das Synonym „Mensch und Welt“ (Z. 13) verdeutlicht, denn in der wörtlichen Rede wird über die Menschen und die Welt in der die Charaktere leben geredet. Im weiteren Verlauf geht Lämmert auf die Werke von Heinrich Kleist ein. Er leitet den Bezug zu diesen Werken mit dem Wortlaut „Ein Blick auf gewisse aktionsgedrängte und redearme Kleist-Novellen zeigt“ (Z. 14) ein. Bereits die Formulierung „Ein Blick auf Gewisse“ (Z. 14) lässt darauf schließen, dass es sich hierbei um eine Wertung handelt. Die Werke werden zudem als „gewisse aktionsgedrängte und redearme Kleist-Novellen“ (Z. 14) bezeichnet. Allein das Adjektiv „gewisse“ (ebd.) deutet auf eine abfällige Haltung gegenüber den Werken des Schriftstellers Kleist hin. Weiterhin ist ebenso festzuhalten, dass beispielsweise die Novelle „Die Marquise von O…“, verfasst von Heinricht Kleist und veröffentlicht im Jahre 1808, keineswegs als „redearme“ (Z. 14) Novelle bezeichnet werden kann. Das Adjektiv „aktionsgedängt[.]“ (ebd.) lässt sich allerdings zutreffend auf die Novelle beziehen. Bezogen auf die eben erwähnten Kleist-Novellen fährt der Autor fort mit der Aussage „dass solche Dichtungen auf eine besondere, metapsychische Weise Tragik oder auch Komik des Menschenschicksals gestalten“ (Z. 14 ff.). Demnach ist es laut Lämmert auch möglich ohne einen hohen Anteil an wörtlicher Rede dem Leser die Charaktere auf metapsychische Weise nahe zu bringen. Er erläutert dies mit der Aussage „In derartigen Werken ist der Vollzug des Handelns und Leidens selbst das Entscheidende, während wir bei redereichen Erzählungen immer wieder in Verlegenheit geraten, wenn wir durch die Wiedergabe des Handlungsablaufs die ‚Welt‘ der Dichtung wiederzugeben versuchen“ (Z. 16 ff.). Er sagt aus, dass die fehlende wörtliche Rede durch Handlungen und Leiden kompensiert werden kann, wohingegen in Erzählungen mit viel wörtlicher Rede die Handlungen durch Figurenrede wiedergegeben werden können und diese somit dem Leser selbst die Welt in der sie leben erläutern können. Das Nomen „‘Welt‘“ (Z. 18) wird in Anführungszeichen aufgeführt, da es sich bei dem fiktionalen Raum, in dem die Figuren leben, nicht um die reale Welt handelt.
Im vierten Abschnitt des Textes wird dieser Gedankengang fortgeführt, denn „Durch das Medium der Person erfährt die erzählte Welt eine spezifische Brechung, und eben diese Brechung der Außenwelt dient dem Erzähler gleichzeitig zur Anreicherung eines typischen oder individuellen Charakterbildes“ (Z. 20 ff.). Jeder Charakter gibt nach Lämmert durch die wörtliche Rede seine Sicht auf die fiktionale Welt, in der er oder sie lebt, wieder und ergänzt das Weltbild. Wie auch zuvor schränkt Lämmert seine These weiterhin durch die Äußerung „Das geschieht freilich nicht durch jedes Gespräch in gleichem Maße“ (Z. 22), was durchaus nachvollziehbar sind, da nicht alle Gespräche einen wichtigen Inhalt thematisieren oder von ausreichender Länge sind. Stattdessen legt Lämmert dar, dass „vielmehr die Gesamtkonstellation der Gespräche in einer Erzählung untersucht [werden muss] und dann die besondere Haltung eines jeden Sprechers zu jedem anderen sowohl im Querschnitt durch einzelne Erzählphasen als auch im Längsschnitt, im Wandel von Phase zu Phase bestimmt werden“ (Z. 23 ff.). Der Autor erläutert, dass Gespräche nicht nur im sogenannten Querschnitt, das heißt einzelne Passagen, sondern auch im Längsschnitt, das heißt die gesamte Handlung, betrachtet werden müssen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten.
Im folgenden Abschnitt knüpft der Autor an die vorausgegangene These an und erläutert wie mit einem sogenannten Querschnitt umzugehen ist. Er legt dar, dass „nun am gleichen Objekt der Längsweg einer derartigen Untersuchung über eine kleine Verlaufsspanne hin abgeschnitten und im größeren Zusammenhang wenigstens angedeutet“ (Z. 27 f.) werden sollte. Demnach erschließt sich, dass Lämmert der Auffassung ist einzelne Textpassagen können nicht ohne eine Betrachtung der vorangegangenen und folgenden Szenen analysiert werden. Dies belegt er zudem an einem Beispiel (vgl. Z. 31 – 34).
Den nächsten und vorletzten Abschnitt des Textes leitet der Autor mit der allgemeinen Feststellung „Man bemerkt“ (Z. 35) ein, welche voraussetzt, dass entsprechendem Fachpublikum dieser Umstand auffallen sollte. Weiterhin erläutert er den Zusammenhang seiner bisher aufgestellten Thesen am eben erwähnten Beispiel. Das Beispiel handelt von einem Großvater und seinem Enkel. Der Erzähler, in diesem Fall der Großvater, gehört „selbst zum Kreis der handelnden Personen“ (Z. 35) und bezieht „selbst handelnd seine Stellung“ (Z. 36). Der Parallelismus beziehungsweise die Wiederholung des Adjektives „selbst“ (Z. 35, Z. 36) veranschaulicht, dass der Fokus auf dem Charakter des Großvaters liegt. Im weiteren Verlauf Analysiert der Autor an Hand der geringen Anzahl an Zeilen das Verhalten und den daraus resultierenden Charakter der beiden Figuren. Letzten Endes kommt er zu dem Ergebnis, dass „sich schon in dem geduldigen Zuhören des älteren Erzählers eine bergende, umfangende Großherzigkeit an, die sich über die zuvor geschilderten Charaktere erhebt“ (Z. 42 f.). Seine Analysestruktur und sein Ergebnis sind durchaus nachvollziehbar. Allerdings wird bereits beim ersten Betrachten der Textstelle deutlich, dass kaum wörtliche Rede vorliegt, was somit die Thesen, die der Autor zu Beginn getroffen hat, für diese Textstelle nicht sonderlich relevant macht. Das Beispiel wirkt daher nur durch die aufgeführte Analyse überzeugend.
Im letzten Abschnitt seines Textes greift Lämmert wiederholt das Beispiel aus Zeile 31 ff. auf. Allerdings legt er in diesem Abschnitt den Fokus auf den übergeordneten Erzähler, da „wir als Zuhörer gerade zu dieser Person besonderes Zutrauen“ (Z. 49 f.) empfinden. Lämmert erläutert allerdings nicht wie die wörtliche Rede, die zu Beginn des Textes das zentrale Element seiner Thesen war, in Zusammenhang mit dem übergeordneten Erzähler steht, welcher vergleichsweise im Beispiel, sehr wenig wörtliche Rede verwendet.
Am Schluss ist festzuhalten, dass Lämmert in seinem Text ein wiederkehrendes Argumentationsschema verwendet. Er nutzt eine These, die auf unausgesprochenen Faken basiert und schränkt diese im weiteren Verlauf, ein sodass sie überzeugende wirkt. Lämmert fasst die Bedeutung der wörtlichen Rede als einen entscheidenden Teil der Charakteranalyse zusammen. Am Ende des Textes erfährt seine Schwerpunktlegung jedoch eine überraschende Wendung von wörtlicher Rede zu übergeordneter Erzähler, was seinen Gedankengang in Frage stellt.
Stellungnahme 2
Das Zitat „Durch das Medium der Person erfährt die erzählte Welt eine spezifische Brechung, und eben diese Brechung der Außenwelt dient dem Erzähler gleichzeitig zur Anreicherung eines typischen oder individuellen Charakterbildes“ aus dem Kapitel „Die Rede als Mittel der Personengestaltung“ des Buches „Bauformendes Erzählens“, verfasst von Eberhart Lämmert und veröffentlicht im Jahre 1993 in Stuttgart, lässt sich an der Novelle „Die Marquise von O…“, verfasst von Heinrich Kleist und veröffentlicht im Jahr 1808, überprüfen. Betrachtet wird ein Auszug von Zeile 910 bis 925. Dieser Textstellt geht die Erkenntnis der Schwangerschaft der Marquise und das damit verbundene Verlassen des Elternhauses, sowie der Kontaktabbruch voraus. Die Passage handelt von einem Gespräch zwischen der Obristin und der Marquise, in dem die Obristin ihren Fehler einsieht und die Marquise ihr verzeiht. Dieses Gespräch steht im Kontrast zu den gesellschaftlichen Konventionen, die bis zu diesem Zeitpunkt das Weltbild der beiden Figuren bestimmt haben.
Die zu analysierende Szene setzt mit dem Versprechen der Obristin ihrer Tochter gegenüber sie würde „nicht von deinen Füßen weich[en], bis du mir sagst, ob du mir die Niedrigkeit meines Verhaltens […] verzeihen kannst“ (Z. 910 ff.). Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Obristin ihre Tochter nicht um Verzeihung bitten müssen. Dies verdeutlicht eine Wendung in ihrem Weltbild, das bisher nur auf die Rolle einer der Tochter überlegenen Mutter zutrifft. Sie bezeichnete ihre Tochter weiterhin als „du Herrliche, Überirdische“ (Z. 912), was im Kontrast zu dem steht, wie sie sich zuvor bei der Kenntniserlangung über die Schwangerschaft ihrer Tochter verhalten hat. Die Marquise versucht ihre Mutter daraufhin dazu zu veranlassen sich zu beruhigen, indem sie ihr versichert, dass sie ihr verzeiht. Die Mutter ist davon allerdings nicht überzeugt, da sie wiederholt nachfragt (vgl. Z. 13 f.). Dies wiederspricht ebenfalls ihrem zuvor sehr dominanten und überlegenen Charakter. Es wird deutlich, dass sie ihre Tochter sehr liebt und sie ihr auch überaus wichtig ist. Ein Umstand den sie ihr zuvor nie so gezeigt hat. Weiterhin kann auch die Reaktion der Tochter, die ihrer Mutter ohne zu zögern vergibt, obwohl diese die gesellschaftliche Stellung der Familie über das Wohl ihrer eigenen Tochter zu stellen. Stattdessen erklärt die Tochter ihrer Mutter sogar, dass „Ehrfurcht und Liebe […] nie aus meinem Herz gewichen [seien]“ (Z. 16). Die Obristin geht nun auf die Erklärung ihrer Tochter ein, sie verspricht ihre Tochter auf Händen zu tragen und dass sie ihr Wochenlager bei ihr zu Hause halten darf (vgl. 19 ff.). Weiterhin verspricht die Mutter ihrer Tochter auch „Die Tage meines Lebens nicht mehr von deiner Seite weiche ich“ (Z. 22 f.). Zusätzlich versichert sie ihr ebenso „Ich biete der ganzen Welt Trotz, ich will keine andre Ehre mehr, als deine Schande; wenn du mir nur wiedergut wirst, und der Härte nicht, mit welcher ich dich verstieß, mehr gedenkst (Z. 23 ff.). Die Textpassage endet entsprechend damit dass die Mutter ihre Tochter wieder als solche anerkennt und zu ihr steht, obwohl die gesellschaftlichen Konventionen ihr dies verbieten, da die Tochter voraussichtlich ein uneheliches Kind austragen wird.
In dieser Szene ist die Figur der Obristin das Medium, welches der erzählten Welt eine Brechung wiederfahren lässt. Diese Brechung findet statt, sobald die Mutter ihre Tochter um Vergebung bittet und ihren Fehler einsieht. Zudem lässt sich auch das Charakterbild der Obristin ergänzen, da sie sich zuvor noch nie bei ihrer Tochter entschuldigt hat und für sie immer die gesellschaftlichen Konventionen oder die gesellschaftliche Stellung an vorderster Stelle gestanden haben.
Jochen Vogt: Auktoriale Erzählsituation
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Auktoriale Erzählsituation“, verfasst von Jochen Vogt und veröffentlicht im Jahr 1979 in Opladen, handelt es sich um einen Auszug aus dem Sachbuch „Aspekte erzählende Prosa“. Thematisiert wird die Bedeutung des auktorialen Erzählers.
Die zu analysierende Textstelle setzt mit einem Auszug aus dem Roman „Der Zauberberg“, verfasst von Thomas Mann und veröffentlicht im Jahre 1960 in Frankfurt am Main, ein. Bei dem Auszug handelt es sich um die ersten Sätze des Romans. Vorgestellt wird der Protagonist Hans Castorp, welcher vom auktorialen Erzähler als „einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Mann“ (Z. 2) gekennzeichnet wird. Es wird deutlich, dass der auktoriale Erzähler so gestaltet ist, dass es scheint als verfüge er über eine eigene Meinung, was ihn als eine reale Persönlichkeit kennzeichnen soll. Über die Geschichte bzw. die geschilderte Handlung äußert sich der auktoriale Erzähler wie folgt: „diese Geschichte ist sehr lang her, sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen“ (Z. 5 f.). Mit der Metapher „historische[r] Edelrost“ (Z. 6) verdeutlicht der Erzähler welchen Wert er der Geschichte zuschreibt, da die Handlung einer alten Zeit entstammt und dennoch von Bedeutung für die heutige Zeit ist. Diese Ansicht führt er weiter aus, indem er erläutert, dass „Geschichten […] vergangen sein [müssen], und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie in ihrer Eigenschaft als Geschichten und für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts“ (Z. 9 ff.). Es erscheint zunächst Paradox, dass der auktoriale Erzähler in diesem Abschnitt über sich selbst erzählt, allerdings ist es durchaus möglich, dass Thomas Mann, der Autor selbst und somit der Erschaffer der Figuren und des auktorialen Erzählers, diese Zeilen aus seiner Position geschrieben hat. Formal werden die Beispiele durch kursive Schrift vom übrigen Text abgehoben und somit als solche kenntlich gemacht. Im zweiten Abschnitt bezieht sich Vogt auf den zuvor erwähnten Roman „Der Zauberberg“ von Thomas Mann. Er beginnt den Roman zu analysieren mit der Aussage der erste Satz zeuge „von einer völlig anderen Erzählsituation“ (Z. 12 f.). Er geht zunächst nicht näher auf seine These ein, sondern erläutert die generelle Erzählstruktur des Textes. Diese bezeichnet der als „Die Spuren des Erzählenwerdens“ (Z. 13), welche seiner Ansicht nach in diesem Roman „zahlreich und deutlich ausgeprägt“ (Z. 14) sind. Um seine These zu belegen führt Vogt daraufhin ein Zitat aus dem Sachbuch „Typische Formen des Romans“, verfasst von F. K. Stanzel und veröffentlich im Jahre 1981 in Göttingen, an. Das Zitat schildert, dass der Erzähler durch Kommentare und wertende Beschreibungen den Anschein einer eigenen Persönlichkeit vermitteln kann. Im weiteren Verlauf knüpft Vogt an dieses Zitat an und zeigt auf, dass der „‘Erzähler‘ nicht als Handlungsfigur erscheint“ (Z. 16), sich aber stattdessen „durch die Erzählweise und […] das Personalpronomen ‚wir‘“ (Z. 17) zu erkennen gibt. Die verwendeten Personalpronomen sollen das Erscheinungsbild einer „fiktiven Erzählerexistenz“ (Z. 19) darstellen. Dieser fiktive Erzähler soll als „Kunstmittel des wahren Erzählers (=Autors)“ (Z. 20) dienen und diesen somit zum Teil der Handlung werden lassen. Den Rückbezug zum Roman stellt Vogt durch die zuvor erwähnte Erzählweise und die Personalpronomen her. Kunstmittel wie beispielsweise der fiktive Erzähler sollen laut dem Autor Teil dessen sein „was Stanzel als die ‚auktoriale Erzählsituation‘“ (Z. 21 f.) bezeichnet. Der Umstand, dass Vogt wiederholt eine Passage aus Stanzels Sachbuch zitiert, verdeutlicht, dass er den Leser mit einer zweiten fachlichen Meinung zu überzeugen versucht. In den nachfolgenden Zeilen benennt der Autor die Funktion des auktorialen Erzählers. Dieser ist in erster Linie durch „‘Allwissenheit‘“ (Z. 23) gekennzeichnet, welche er „beim personalen Erzählen weitgehend ‚unterschlägt‘“ (Z. 23), weiterhin zeichnen sich seine Worte durch Souveränität (vgl. Z. 24), sowie durch „Rückwendungen und Vorausdeutungen“ (Z. 25) und die Tatsache, dass er in der Lage ist „bereits von Personen und Ereignissen [zu sprechen], die erst noch zu erzählen sind“ (Z. 26 f.) aus. Weiterhin führt Vogt auf, dass „Dem Gang des Geschehens […] Erzählereinmischungen, Anreden an den Leser [und] reflektierende Abschweifungen beigefügt [werden]“ (Z. 27 f.). In den nachfolgenden Zeilen geht Vogt auf den ersten Abschnitt seines Textes ein. Der auktoriale Erzähler oder in den ersten Zeilen auch als der Autor persönlich auszumachen, erläutert wie er vorgegangen ist um bereits in den ersten Zeilen den Leser für sich einzunehmen. Er verwendet dazu die Zeitgestaltung (vgl. Z. 29), „erläuternde Einmischungen“ (Z. 30) durch den Autor, sowie „Bezugnahmen auf den Leser“ (Z. 31) und „allgemeine Erörterungen“ (Z. 33), welche er mit entsprechenden Beispielen aus dem ersten Abschnitt des Textes belegt. Die zuvor erwähnten allgemeinen Erörterungen können laut dem Autor vom auktorialen Erzähler „bis zu regelrecht essayistischen Partien anschwellen“ (Z. 35 f.). Im nächsten Abschnitt geht Vogt auf die „Souveränität [des] auktorialen Erzählens“ (Z. 38) ein. Zur Souveränität zählt unter anderem die „Personenzeichnung, die sich der Innensicht bedient und somit […] Indizien der Fiktionalität liefert“ (Z. 38 ff.). Als Beispiel dafür zitiert er einige Zeilen aus dem zu Beginn erwähnten Roman „Der Zauberberg“ verfasst von Thomas Mann, die sich auf die Vorstellung der Figur Hans Castorps konzentrieren. Weiterhin erwähnt der Autor ebenso, dass „Berichte über innere Vorgänge und indirekte Rede“ (Z. 47) zusätzliche Bestandteile des auktorialen Erzählens sind. Über den auktorialen Erzähler werden somit die Tatsache der Vermittlung und das Erzählenwerden“ (Z. 49) dargestellt. Dies verdeutlicht dem Leser weiterhin, dass eine höhere „Instanz“ (Z. 51) einen Überblick über die gesamte Handlung und alle Personen hat. Vogt führt seine These aus indem er hervorhebt, dass „Die epische Distanz zwischen Geschehen und Erzähltwerden […] beträchtlich [ist]“ (Z. 51 f.). Darüber hinaus verallgemeinert er seine These, indem er angibt, dass dieser Umstand „deutlich wahrnehmbar“ (Z. 52) sei. Um seine These zu bestätigen bezieht er sich wiederholt auf den Roman „Der Zauberberg“ und analysiert das Erzählschema als „durchaus distanziert, mit wohlwollender Ironie“ (Z. 53), welche sich letzten Endes laut Vogts Ansicht Auswirkungen auf den Leser hat (vgl. Z. 54). An Hand seiner Ergebnisse schließt Vogt dieses Argument mit der Aussage, dass die „auktoriale Erzählhaltung weiterhin typisch für humoristische, aber auch für stark reflektorische Erzählprosa [ist]“ (Z. 54 ff.).
Zum Ende der Textstelle geht Vogt ebenfalls auf die „Elemente personalen Erzählens“ (Z. 57 f.) ein. Er erläutert, dass sowohl auktoriales, als auch personales Erzählen „Idealtypen [sind], die in einzelnen Texten jeweils verschiedene Kombinationen eingehen“ (Z. 59 f.). Mit dieser Behauptung endet der Textauszug.
Erzählsituation Die Marquise von O...
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Auszug aus der Novelle „Die Marquise von O…“, verfasst von Heinrich Kleist und veröffentlicht im Jahr 1808. An diesem Auszug, welcher von Zeile 1111 bis zum Ende der Novelle reicht, sollen die Erzählsituation und deren Funktion an Hand von Belegen erläutert werden.
Der Textauszug setzt ein mit der Darlegung, dass es „Erst am Portal der Kirche […] dem Grafen erlaubt [war], sich an die Familie anzuschließen“ (Z. 1111 f.). Der Umstand, dass dies von einem auktorialen Erzähler, zu erkennen an der neutralen Darstellung der Situation, wiedergegeben wird, verdeutlicht, dass er mehr als der Leser zu wissen scheint, und somit als Allwissend zu kennzeichnen ist, und über die gesellschaftlichen Konventionen, die in dieser Zeit gelten Kenntnis hat. Weiterhin gibt der auktoriale Erzähler ebenfalls die Handlung bzw. den Verlauf der Trauung wieder. Er bemerkt, dass „Die Marquise […), während der Feierlichkeiten, starr auf das Altarbild [sah]“ (Z. 1112). Dieser Kontext, insbesondere in Bezug auf das Adjektiv „starr“ (ebd.), deutet auf eine wertende und somit seine Meinung vermittelnde Aussage des auktorialen Erzählers hin. Dies lässt sich auch in der Bemerkung „nicht ein flüchtiger Blick ward dem Manne zuteil, mit welchem sie die Ringe wechselte“ (Z. 1113), insbesondere durch den wertenden Ausdruck „nicht ein flüchtiger Blick“ (ebd.) bestätigen. Die zu Beginn erwähnte Sachlage, dass der auktoriale Erzähler über die geltenden gesellschaftlichen Konventionen im Bilde ist, zeigt sich in der Schilderung „Der Graf bot ihr, als die Trauung vorüber war, den Arm; doch sobald sie wieder aus der Kirche heraus waren, verneigte sich die Gräfin vor ihm“ (Z. 1114 f.). Zudem fällt auf, dass in der Handlung deutlich öfter indirekte Rede, die vom auktorialen Erzähler wiedergegeben wird, vorkommt, als direkte Rede (vgl. Z. 1115 f.). Allein dem auktorialen Erzähler ist es möglich Handlungen in indirekter Rede wiederzugeben, da ansonst einer der handelnden Figuren dies in die Handlung in direkter Rede erläutern muss. Auf die Frage des Kommandanten, ob der Graf die Gräfin nun öfter Besuchen würde, gibt der auktoriale Erzähler an, dass „der Graf etwas stammelte, das niemand verstand, den Hut vor der Gesellschaft abnahm und verschwand“ (Z. 1117 f.). Bereits der Kommentar in Bezug auf das Gesagte des Grafen „das niemand verstand“ (ebd.) ergänzt die Unterstellung, dass der auktoriale Erzähler über eine eigene Meinung verfügt, da er behauptet dass keine der Figuren die Worte des Grafen verstanden hat. Im weiteren Verlauf spiegelt sich wiederholt die Allwissenheit des auktorialen Erzählers über die gesamte Handlung wider. Er gibt an, dass der Graf F… seit der Hochzeit eine Wohnung in M… besitzt. Durch den Zeitsprung „in welcher er mehrere Monate zubrachte, ohne auch nur den Fuß in des Kommandanten Haus zu setzen“ (Z. 1118 f.), veranschaulicht die Allwissenheit des auktorialen Erzählers, da keine der übrigen Figuren (z. B. die Marquise oder der Graf F…) in der Lage ist eine vorausgehende Handlung glaubhaft zu vermitteln und somit nur er in der Lage ist Zeitsprünge wiederzugeben. Weiterhin bemerkt der auktoriale Erzähler, dass der Graf es „Nur seinem zarten würdigen und völlig musterhaften Betragen überall, wo er mit der Familie in irgend eine Berührung kam, […] zu verdanken [hatte], daß er, nach der nunmehr erfolgten Entbindung der Gräfin von einem jungen Sohne, zur Taufe desselben eingeladen ward“ (Z. 1120 ff.). Dieser Bemerkung sind zum einen die wertenden Adjektive „zart[…]“ (Z. 1120), „würdig[…]“ (ebd.) und „musterhaft[…]“ (Z. 1121), und zum anderen die Zeitgestaltung, die als Zeitraffung vorliegt, zu entnehmen. Die wertenden Adjektive bestätigen die Meinung des auktorialen Erzählers, zusätzlich deutet die Zeitraffung, die durch jenen wiedergegeben wird, auf die Allwissenheit des Erzählers hin. Die Handlung wird vom auktorialen Erzähler weiter fortgeführt, als dass der Graf seine Frau, die nach wie vor auf dem Wochenbett saß (vgl. Z. 1124 f.), „von weitem ehrfurchtsvoll grüßte“ (Z. 1125), ebenso „warf [er] unter den Geschenken, womit die Gäste den Neugeborenen bewillkommten, zwei Papiere auf die Wiege“ (Z. 1126 f.). Bei diesen zwei Papieren handelt es sich laut des auktorialen Erzählers um „eine Schenkung von 20000 Rubel an den Knaben“ (Z. 1128) und um das Testament des Grafen, in welchem nun seine Frau als Erbin angegeben war. Das Verhalten des Grafen, das sich gegenüber seiner Frau bereits als sehr unpersönlich feststellen lässt, wird gegenüber des Lesers ebenfalls als solches dargestellt, da es vom auktorialen Erzähler vorgetragen wird, was die epische Distanz des Textes ohnehin schon vergrößert. Der auktoriale Erzähler bestätigt seine Allwissenheit im weiteren Verlauf dadurch, dass er erläutert der Graf F… würde nun „auf Veranstaltung der Frau von G… öfter [.] eingeladen“ (Z. 1130), sowie dass „bald kein Abend [verging], da er sich nicht [im Haus des Kommandanten] gezeigt hätte“ (Z. 1131 f.). Er gibt demnach vergangene Handlungen die zunächst für die Geschichte nicht wichtig sind als Rückblende wieder. Ebenso ist der auktoriale Erzähler der zentrale Part im Ende der Novelle. Er gibt bis zum Schluss die Handlung wieder und beschreibt den Teil der Handlung, in welchem der Graf F… seine Ehefrau um ein zweites Jawort bittet (vgl. Z. 1133 f.). Überdies erwähnt er ebenso, dass „auch eine zweite Hochzeit ward gefeiert, froher, als die erste, nach deren Abschluß die ganze Familie nach V… hinauszog“ (Z. 1135 f.) Zum Ende der Handlung fragt der Graf die Gräfin wieso sie an den Tag, an dem sie zum ersten Mal den Vater ihres Kindes getroffen hatte vor ihm geflohen wäre als sei er der Teufel. Anstelle der Gräfin selbst antwortet der auktoriale Erzähler an ihrer Stelle mit den Worten: „er würde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht, bei seiner ersten Erscheinung, wie ein Engel vorgekommen wäre“ (Z. 1140 ff.).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der auktoriale Erzähler besonders am Ende der Novelle eine zentrale Rolle spielt, da er zum einen über die Allwissenheit verfügt und es ihm somit möglich ist Rückblenden und Vorausdeutungen zu tätigen, sowie durch wertende Adjektive oder andere Meinung vermittelnde Aussagen den Leser für seine Ansicht zu gewinnen. Weiterhin gibt jener das Gesprochene durch indirekte Rede oder Zusammenfassungen wieder und sorgt für die notwendige epische Distanz zwischen Leser und Figur.
Abschrift 4. Klausur
Aufgabe 1:
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Personale Erzählsituation“ handelt es sich um einen Auszug aus dem Sachbuch „Aspekte erzählender Prosa“, verfasst von Jochen Vogt und veröffentlicht im Jahr 1979 in Opladen. Thematisiert wird die Darstellung des personalen Erzählens. Der zu analysierende Textauszug setzt mit einem Beispiel, entnommen aus dem Roman „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“, verfasst von Thomas Mann und veröffentlicht im Jahr 1901, ein. Dieses Beispiel, welches sich durch die kursive Schrift vom übrigen Text abhebt, umfasst die ersten 14 Zeilen des Textauszuges und wird von Vogt als „Der Anfang von Thomas Manns erstem Roman“ (Z. 15) benannt. Weiterhin stellt Vogt in Bezug auf das Beispiel seine erste These auf, die besagt, dass im angeführten Beispiel „auf den ersten Blick keine Spuren des Erzähltwerdens [gezeigt werden]“ (Z. 16). Diese These führt er im weiteren Verlauf des Textauszuges näher aus. Vogt gibt an, dass „keine vermittelnde Instanz […] dem Leser vom Geschehen zu berichten“ (Z. 16 f.) scheine. Seiner Ansicht nach geschehe genau das „Gegenteil: [der Leser] verfällt der Illusion, sich selbst auf dem Schauplatz der Handlung zu befinden“ (Z. 17 f.). Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass Vogt anführt es läge kein auktorialer Erzähler als Vermittler der Handlung vor, sondern der Leser wäre so nahe am Geschehen, dass es so scheine, als würd er Teil der Handlung sein. Die epische Distanz, welche durch den auktorialen Erzähler in der Regel sehr groß ist, ist ohne diesen sehr gering, besonders dadurch, dass der Leser, laut Vogt, das Gefühl hat Teil der Handlung zu sein. Gemeinsam mit dem Beispiel bildet dieser erste Abschnitt (Z. 15 – 18) die Einführung in die Thematik und somit auch den ersten Sinnabschnitt des Textes. Der zweite Sinnabschnitt (Z. 19 – 27) knüpft nicht an die im ersten Sinnabschnitt angeführte These an. Der Autor greift hier einen neuen Aspekt auf. Er merkt an, dass die Erzählweise des Beispiels „an die Darbietungsform einer anderen Literaturgattung“ (Z. 19) erinnere. Diese Darbietungsform ist die szenische Darbietung der Dramatik. Während in der Dramatik die Handlung in direkter Rede oder durch Regieanweisungen wiedergegeben wird, wird in der Epik dazu in der Regel eine Instanz, wie zum Beispiel ein auktorialer Erzähler oder eine der Figuren, die die Handlung wiedergibt, benötigt. Vogt führt an, dass es im zu Beginn benannten Beispiel so wirkt, als würde „man eine Szene […] betrachten“ (Z. 21). Im weiteren Verlauf wird dies näher erläutert. Zum einen werden, nach Vogts Aussage „Raum und Requisiten […] recht sachlich beschrieben“ (Z. 21), was zunächst nichts heißen muss, da ein auktorialer Erzähler ebenso in der Lage ist Beschreibungen auf neutraler Basis zu vermitteln. Zum anderen gibt Vogt jedoch an, dass eben diese Beschreibungen an Regieanweisungen erinnern (vgl. Z. 22). Dieser Einschub steht in Klammern und wird zudem durch die Formulierung „man könnte“ (Z. 22) eingeleitet. Diese Formulierung verallgemeinert die Erkenntnis Vogts. Jedoch muss dies nicht heißen, dass dieser Umstand anderen Lesern ebenso aufgefallen ist, doch durch diesen Einschub werden sie darauf aufmerksam gemacht und unterstützen seine Behauptung. Darüber hinaus zählt Vogt weitere Merkmale, wie „Personen befinden sich auf dieser imaginären Bühne, die wie Dramenfiguren für sich selbst stehen und sprechen“ (Z. 22 f.), „die ausnahmslose Verwendung zur Wiedergabe des Gesprochenen“ (Z. 24 f.) und der daraus resultierende „Eindruck der Unmittelbarkeit“ (Z. 25), auf, welche seine These, dass die Art und Weise, wie die Handlung im Beispiel wiedergegeben wird, an die szenische Darbietung in Dramen erinnere, unterstützen. Besonders den direkten Dialog rückt er in den Vordergrund, da indirekte Rede hauptsächlich vom auktorialen Erzähler verwendet wird und dadurch „sehr viel deutlicher die Vermittlungsfunktion des Erzählprozesses hervor[gehen würde] (Z. 26 f.). Mit diesem Einschub, der ebenfalls in Klammern aufgeführt wird, schließt der zweite Sinnabschnitt. Den folgenden Sinnabschnitt leitet der Autor mit der These „Der Text enthält – zumindest in den ersten Absätzen – nichts, was nicht auch von einem Anwesenden wahrgenommen werden könnte“ (Z. 28 f.). Das Verb „könnte“ (ebd.) steht im Konjunktiv II und soll verdeutlichen, dass wenn man die Szene nachstellen würde eben diese These, nach der Aussage Vogts, zutreffen würde. Im Folgenden zählt der Verfasser auf, was der Leser seiner Ansicht nach wahrnehmen würde. Dazu zählen „lediglich Gegenstands- und Personenbeschreibungen, die sachlich gehalten sind und keine Einmischungen oder Wertungen des Autors/Erzählers aufweisen“ (Z. 29 f.), „Berichte von äußeren Vorgängen“ (Z. 31). Laut Vogt machen all diese Dinge den Eindruck […] einer erzählerischen ‚Objektivität‘ oder ‚Neutralität‘“ (Z. 32) aus, welcher jedoch eher als „‘Darstellung‘ im Sinne der Dramatik und nicht [als] ‚Erzählung‘“ (Z. 33) bezeichnet werden sollte. Weiterhin erkennt Vogt, dass „[d]ie Erzählsituation […] weitgehend auf Geschehenswiedergabe reduziert [ist]“ (Z. 33 f.) und somit „nicht den Anschein eines ‚fiktiven Erzählers‘“ (Z. 34 f.) erweckt. Um die Erzählsituation fachlich zu benennen verweist der Autor auf den Ausdruck „‘personale Erzählsituation‘“ (Z. 36 f.), welchen er aus dem Sachbuch „Typische Formen des Romans“, verfasst von Stanzel und veröffentlicht im Jahr 1981 in Göttingen, entnommen hat. In der personalen Erzählsituation wird „die Haltung, die eine der Handlungspersonen einnehmen würde, wollte sie über das Geschehen berichten“ (Z. 36 f.), wiedergegeben. Nach Vogt lässt sich das personale Erzählverhalten in zwei Kategorien gliedern: die Handlung kann sachlich von einer unbestimmten Person (vgl. Z. 38 ff.) oder „aus der Perspektive einer der anwesenden Personen“ (Z. 41 f.) wiedergegeben werden. Mit dieser Unterscheidung endet der dritte Sinnabschnitt (Z. 28 – 42). Da nun keine Instanz mehr vorhanden ist, die sichtlich über Allwissenheit verfügt, muss die Innen- und Außensicht der Figuren auf andere Weise angegeben werden. In den Zeilen 49 – 51 wird erneut ein Beispiel aus dem zu Beginn erwähnten Roman „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“ entnommen. Auf dieses bezieht sich der Autor, um die Darstellung der Innen- und Außensicht zu erläutern. Er gibt an, dass „[d]er Personenbezeichnung des Wirklichkeitsbereiches […] logischerweise nur die Außensicht, die Beschreibung und Schilderung einer Figur von außen, ohne Einblick in ihr Bewusstsein, zur Verfügung [steht]“ (Z. 53 ff.). Dementsprechend kann theoretisch gesehen nur die Außensicht wiedergegeben werden. Die Innensicht kann lediglich von Figuren selbst „verbunden mit wörtlicher Gedankenwiedergabe“ (Z. 56 f.) dargestellt werden. Dies „muss dementsprechend als deutliche Ausformung der Erzählfunktion, als Spur des Erzähltwerdens, Indiz erzählerischer ‚Allwissenheit‘ angesehen werden“ (Z. 57 f.). Aus diesem Grund handelt „es sich an dieser Stelle um ‚episches Präteritum und damit um fiktionales Erzählen‘“ (Z. 59). Allerdings gibt Vogt im letzten Abschnitt seines Textes an, dass durch die „Personendarstellung in Innensicht, die Erzählsituation ihren rein personalen Charakter verliert“ (Z. 61), da es nur dem auktorialen und dem Ich – Erzähler möglich ist, die Gedanken und Gefühle einer Figur wiederzugeben. Demnach deutet „[d]er Einblick ins Innere einer Figur […] bereits auf eine andere Erzählsituation“ (Z. 62) hin. Vogt schließt den Textauszug und somit den vierten Sinnabschnitt (Z. 44 – 64) mit der Erkenntnis „dass oft in einem Text verschiedene Erzählsituationen abwechseln oder sich vermischen und dass besonders der personale Typus fast nie in voller Reinheit zu finden ist“ (Z. 63 f.).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass laut Vogt die Handlung in der personalen Erzählsituation aus Sicht einer bestimmten oder unbestimmten Person wiedergegeben wird. Es gibt keinen auktorialen Erzähler und somit auch keine Innensicht. Weiterhin ähnelt die personale Erzählsituation der szenischen Darstellung in der Dramatik, was in Form von Aufzählungen und den in kursiver Schreibweise aufgeführten Beispielen aus dem Roman „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“ deutlich gemacht wird.
Aufgabe 2:
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Auszug aus der Novelle „Die Marquise von O…“, verfasst von Heinrich Kleist und veröffentlicht im Jahr 1808. Der Textauszug thematisiert das Verhalten zwischen dem Obristen und seiner Frau und seiner Tochter, nach der Rückkehr dieser. Die Marquise Julietta von O… lebt nach dem Tod ihres Mannes gemeinsam mit ihren beiden Kindern wieder bei ihren Eltern, dem Obristen und der Obristin von G… Die Handlung spielt zur Zeit der Koalitionskriege, was zur Folge hat, dass das Haus der Familie angegriffen wird. Während des Angriffs versuchen Soldaten die Marquise zu vergewaltigen. Nachdem diese von Graf F., einem russischen Offizier, gerettet wird, fällt sie in Ohnmacht. Nach bereits kurzer Zeit verlassen die Soldaten das Haus der Familie wieder und die Marquise hat keine Gelegenheit sich bei ihrem Retter persönlich zu bedanken. Graf F. stirbt zudem angeblich wenige Tage später auf dem Schlachtfeld. Nach einigen Wochen besucht er die Familie während einer Geschäftsreise und hält um die Hand der Marquise an. Die Marquise, welche sich eigentlich nach dem Tod ihres Mannes geschworen hatte nicht erneut zu heiraten, kann ihn erst überzeugen seine Reise fortzusetzen, als sie ihm das Versprechen gibt, bis zu seiner Rückkehr keinen anderen zu heiraten. Der Graf reist ab und die Marquise bemerkt einige Zeit später, dass sie schwanger ist. Da sie nicht weiß, wer der Vater des Kindes ist, wird sie von ihrer Familie verstoßen. Die Marquise gibt zudem eine Zeitungsannonce auf um den Vater des Kindes zu finden. Der unbekannte Vater antwortet auf die Annonce mit dem Vorschlag sie zu treffen. Die Obristin findet währenddessen mit einer List heraus, dass ihre Tochter wirklich nicht weiß, wer der Vater des ungeborenen Kindes ist und sie darf nach Hause zurückkehren und wird wieder in die Familie aufgenommen. Es stellt sich heraus, dass Graf F. der Vater des Kindes ist und auch, nachdem die Marquise sich zunächst gegen die Hochzeit sträubt, heiraten sie schließlich. Der Graf F. bezieht eine Wohnung in der Stadt und wird nach und nach in Familie aufgenommen. Auch die Marquise verzeiht ihm und sie heiraten ein zweites Mal. Im Folgenden wird die Erzählsituation des Textauszuges mit Hilfe von Belegen erläutert und deren Funktion dargestellt. Der zu analysierende Textauszug setzt ein mit der Beschreibung „sobald sie draußen war, wischte [sie] sich selbst die Tränen ab, dachte, ob ihm die heftige Erschütterung, in welche sie ihn versetzt hatte, nicht doch gefährlich sein könnte, und ob es wohl ratsam sei, einen Arzt rufen zu lassen?“ (Z. 1 ff.). Die hier handelnde Figur ist die Obristin. Der Umstand, dass die Gedanken und somit die Innensicht der Obristin wiedergegeben, was in rein personalem Erzählen nicht möglich ist. Da auch kein Ich – Erzähler im Textauszug zu erkennen ist, handelt es sich um einen auktorialen Erzähler. Diesem ist es möglich die Gedanken und Gefühle und somit die Innensicht einer Figur zu benennen und die Handlung ebenso wie der personale Erzähler zum Beispiel durch die Personalpronomen „er“ und „sie“ wiederzugeben. Die Textpassage wird fortgeführt mit der Handlung der Obristin „sie kochte ihm für den Abend alles, was sie nur Stärkendes und Beruhigendes aufzutreiben wusste, in der Küche zusammen, bereitete und wärmte ihm das Bett, um ihn sogleich hineinzulegen, sobald er, an der Hand der Tochter, erscheinen würde, und schlich, da er immer noch nicht kam, und schon die Abendtafel gedeckt war dem Zimmer der Marquise zu“ (Z. 3 ff.). Diese gesamte Handlung, die in der Realität mehr als eine Stunde an Zeit benötigt, kann hier in deutlich kürzerer Zeit nachgelesen werden. Dies deutet auf eine Zeitraffung hin, die meist von einem auktorialen Erzähler wiedergegeben wird. Zudem vergrößert sich durch die Zeitraffung die epische Distanz, was ebenso für einen auktorialen Erzähler spricht. Der auktoriale Erzähler wird weiterhin durch Gedanken der Marquise, wie beispielsweise „Gelispel, das, wie ihr schien, von der Marquise kam“ (Z. 8) oder „was er sonst in seinem Leben nicht zugegeben hatte“ (Z. 9 f.) dargestellt. Auch die Wiedergabe von Gefühlen, wie etwa „und das Herz quoll ihr vor Freude empor“ (Z. 10 f.), ist Aufgabe des auktorialen Erzählers.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein auktorialer Erzähler vorliegt, da er die Gedanken und Gefühle der Obristin wiedergeben kann. Dem auktorialen Erzähler ist es ebenso möglich, wie es auch im Textauszug zu erkennen ist, eine Zeitraffung wiederzugeben und die epische Distanz groß zu halte
Sprache
Definition Mehrsprachigkeit
Unter dem Begriff „Mehrsprachigkeit“ definieren die meisten Menschen die Fähigkeit sich in mehr als einer Sprache zu verständigen, sei es auf individueller, gesellschaftlicher oder staatlicher Ebene.
Dem Erlernen von mehr als einer Sprache können unterschiedliche Ursachen zu Grunde liegen. Beispielsweise werden Kinder, der Eltern aus verschiedenen Sprachkulturen stammen, meist Bilingual erzogen, um sich in beiden Kulturen heimisch zu fühlen. Es gibt selbst ganze Länder in denen zwei oder mehr Sprachen als Amtssprachen eingetragen sind, z. B. Luxemburg (Französisch, Deutsch, Luxemburgisch) oder Belgien (Niederländisch, Französisch, Deutsch).
Aber nicht nur im Kindesalter erlernen Menschen verschiedene Sprachen. Bei Flüchtlingen und Immigranten ist es sogar notwendig, dass sie die Sprache ihrer neuen Heimat erlernen, um sich zurecht zu finden und zu verständigen, sowie Teil der vorherrschenden Gesellschaft zu werden.
Ebenso spielt allerdings die Globalisierung eine bedeutende Rolle in der Mehrsprachigkeit. Der Austausch von Informationen beinhaltet auch die Verbreitung von Sprachen. Schüler erlernen in den Schulen dieser Welt unterschiedlichste Sprachen um sich mit anderen Menschen verständigen zu können. Die am meisten auf der Welt verbreitete Sprache ist Englisch, was eine Folge der intensiven Kolonialpolitik Großbritanniens ist. Viele Kinder erlernen diese Sprache daher als erste Fremdsprache, besonders da sie die offizielle Sprache der meisten internationalen Organisationen ist.
Alexandra Wölke: Was ist "Mehrsprachigkeit"?
Die Bedeutung des Themas:
- Zentrales Thema durch Globalisierung
- Allgemein erwünschte und akzeptierte Selbstverständlichkeit (Wirtschaft, Politik, Mobilität, Migration und internationale Kommunikationsnetzwerke)
Der Begriff „Mehrsprachigkeit“:
- Begriff ist nicht eindeutig festgelegt
- Differenzierung in drei Bereiche: individuelle, institutionelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit
- Individuelle Mehrsprachigkeit:
mehrsprachige Person, die in der täglichen Kommunikation mehr als eine Sprache flüssig spricht
„Sprache“ als bestimmtes System mit fest umrissener Größe
- Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit:
Geltung oder verbreitete Anwendung mehrerer Sprachen in einer Gesellschaft
Offizielle Mehrsprachigkeit: Kamerun, Belgien, Kanada und Singapur
- Hierarchie der Sprachen zur Abgrenzung: „Erstsprache“ (auch „Muttersprache“), „Zweit- und Drittsprache“ (auch „Fremdsprache“)
„Heteroglossie“ – als erweiterter Begriff von Mehrsprachigkeit:
- Sprachen haben keine feststehende Größe (Lebendigkeit und Prozesshaftigkeit des Sprechens)
- Sprachliche Vielfalt umfasst eine ganze Bandbreite sprachlicher und kommunikativer Ressourcen (Varietäten, Register, Jargons, Genres, Akzente, Stile; mündliche und schriftliche Ebene, Zuordnung zu mehreren Sprachsystemen)
- „Heteroglossie“ (Viele Zungen): Fähigkeit eines Sprechers sich der komplexen sprachlichen Vielfalt zu bedienen
Entwickelt sich oft in Räumen, in denen mehrere Sprachen zusammentreffen
Mehrsprachigkeit als „kommunikative Kompetenz“
Kommunikation als kreatives und reflektiertes Sprachhandeln im Sinne von sich selbst verständlich machen und andere verstehen
Sprachhandeln: Wissen vom System der Sprache, von Grammatik, Lexik und Stilistik
Äußere und innere Mehrsprachigkeit:
- „äußere Mehrsprachigkeit“: Kommunikation mit anderen Personen
- „innere Mehrsprachigkeit“: Differenzierung in vier Bereiche: Zeit (historische Varietäten), Raum (dialektale Varietäten), soziale Schicht (Gruppensprachen) und kommunikative und funktionelle Situation (situative Varietäten)
Uwe Hinrichs: Hab isch gesehn mein Kumpel - Wie Migration die deutsche Sprache verändert hat
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Hab isch gesehen mein Kumpel – Wie die Migration die deutsche Sprache verändert hat“, verfasst von Uwe Hinrichs und veröffentlicht im Jahre 2012, handelt es sich um einen Sachtext zum Thema Sprachverlust in Bezug auf das mehrsprachige Milieu. Ein möglicher Intentionsaspekt ist auf den drohenden Sprachverlust aufmerksam zu machen und die Leser dafür zu sensibilisieren.
Der Sachtext lässt sich in eine Einführung (Z. 1 – 20), einen Hauptteil (Z. 21 – 106) und ein Schlusswort (Z. 107 – 120) gliedern, wobei der Hauptteil ebenso aus zwei Komponenten besteht. Der zu analysierende Text setzt mit der Auffassung „Der deutsche Sprachraum ist seit je und von allen Seiten von fremden Sprachen und Kulturen umgeben“ (Z. 1 ff.) ein. Diese Auffassung wird zunächst nicht näher erläutert oder begründet, sondern als allgemein gültg hingestellt, da Deutschland an zahlreiche Länder mit anderen Sprachkulturen grenzt. Die nächste Aussage wird von der adversativen Konjunktion „[t]rotzdem“ (Z. 3) eingeleitet und steht somit im Kontrast zur vorherigen Auffassung. Die Aussage wird fortgeführt mit „haben die Deutschen in der Nachkriegszeit und zur Zeit des Wirtschaftswunders vor allem die weiche Variante des Sprachenkontakts kennengelernt – nämlich gesteuert, kulturell abgefedert und ohne wirkliche soziale Konsequenzen“ (Z. 3 ff.), was bedeutet, dass es sich um einen unbewusst ablaufenden Prozess gehandelt haben muss. Dies wird ebenfalls durch verschiedene Beispiele, wie „[m]an las englische Autoren, lernte in der Schule Französisch und Latein, reiste in den Ferien nach Ibiza und begegnete später allenfalls ein paar Gastarbeitern, die nur gebrochen Deutsch sprachen“ (Z. 8 ff.), aus dem Alltag der Menschen in der damaligen Zeit gestützt. Besonders in den siebziger Jahren wurde Deutschland, laut dem Autor, „tiefgreifend von fremden Menschen, Kulturen und Sprachen mitgeprägt und der Alltag auf eine unübersehbare Weise vielsprachig wird“ (Z. 15 ff.). Am Schluss dieser Einführung formuliert Hinrichs die Leitfrage seines Textes „Wie […] haben die jüngsten Sprachkontakte das Deutsche verändert?“ (Z. 19 f.), auf die er im anschließenden Hauptteil näher eingeht.
Der Hauptteil (Z. 21 – 106) lässt sich in zwei Abschnitte gliedern, in denen sich der Autor jeweils auf eine Quelle des Sprachverlustes bezieht. Der erste Abschnitt (Z. 21 – 57) thematisiert die Sprachveränderung durch die alltägliche Situation mit anderen Sprachen oder Sprechern. Im zweiten Abschnitt (Z. 58 – 106) wird die Vermischung der beiden Sprachen im Alltag dargelegt. Hinrichs leitet den ersten Abschnitt mit der These „Das Erste, was eine Sprache verliert, ist das, was sie für einfache Kommunikationszwecke mit fremden Sprechern am allerwenigsten benötigt: Das sind die Fälle, die Endungen und die Regeln ihrer Verknüpfung“ (Z. 21 ff.). Diese These stützt der Autor durch unterschiedliche Belege. Zunächst verweist er auf „Bastian Sicks Bestseller[.]“ (Z. 26 f.), die nach der Auffassung des Autors darlegen, dass „der Genitiv bereits einen aussichtslosen Kampf kämpft“ (Z. 27 f.). Bastian Sick ist ein deutscher Journalist, Autor und Entertainer, der durch seine Kolumne „Zwiebelfisch“ bei SPIEGEL ONLINE und die daraus entstanden Bücher, wie beispielsweise „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ oder „Happy Aua“, in denen er den Sprachverlust thematisiert, bekannt. Auffallend ist die Personifikation in Bezug auf den Genitiv, dass dieser einen „aussichtslosen Kampf kämpft“ (ebd.), was die Bedeutung des Verlustes verdeutlichen soll. Durch den Verweis auf die Ansicht eines Experten veranschaulicht der Autor die Unwiderlegbarkeit seiner These. Im weiteren Verlauf bemerkt er ebenso, dass „auch Dativ und Akkusativ […] Bastion räumen [müssen]“ (Z. 29 f.). Die Metapher „Bastion räumen“ (ebd.) greift die vorhergegangene Personifikation auf, da eine Bastion als Wehranlage im Kampf genutzt wird, und weist ebenso auf die Verschlechterung der Situation, in welcher sich die Deklination der Nomen befindet hin. Seine Aussage belegt er mit Beispielen, die einigen Lesern aus dem Alltag bekannt sein könnten, wie „‘mit diesen Problem‘“ (Z. 31) oder „‘aus den Lager heraus‘“ (Z. 31 f.). Zusätzlich korrigiert Hinrichs die Beispiele, die grammatikalisch korrekt „‘mit diesem Problem‘“ (Z. 38 f.) und „‘aus dem Lager heraus‘“ (Z. 39) lauten. Darüber hinaus erläutert der Autor, dass „[d]as mehrsprachige Milieu […] auf korrekte Deklination und genaue Endungen durchaus verzichten [kann]“ (Z. 41). Dies hängt nach der Auffassung Hinrichs damit zusammen, dass „diese Art Grammatik nur Kodierungsenergie frisst, die woanders viel dringender gebraucht wird, beispielsweise um Defizite im Wortschatz auszugleichen“ (Z. 43 ff.). Es handelt sich dabei um eine „Strategie, die Sprachstrukturen zu vereinfachen, um das Kommunizieren mit Nichtmuttersprachlern zu erleichtern“ (Z. 50 f.). Dies ist zudem auch der Grund weshalb „viele Schulkategorien wie Konjunktiv, Plusquamperfekt oder vollendetes Futur […] in naher Zukunft wahrscheinlich kaum noch gebraucht [werden]“ (Z. 54 ff.).
Den zweiten Abschnitt des Hauptteils leitet der Autor mit der These „[e]ine zweite Quelle für Sprachveränderungen liegt in den Herkunftssprachen der Migranten“ (Z. 58 f.) ein. Dies erläutert er damit, dass „Einwanderer […] auf Sprachstrukturen zurück[greifen], die sie aus ihrer Muttersprache mitbringen“ (Z. 60 ff.). Besagte Sprachstrukturen werden dann, nach Ansicht des Autors, „ins Deutsche kopiert und im zweisprachigen Milieu gefestigt“ (Z. 62 f.). Um seine These und Erläuterung zu bestätigen verweist Hinrichs auf die Potsdamer Linguistin Heike Wiese. Heike Wiese erforscht das großstädtische Kiezdeutsch, in welchem „es etwa eine Vielzahl von Satzmustern, die aus dem Arabischen oder Türkischen stammen“ (Z. 65 ff.), gibt. Als Beispiele dafür führt der Autor den Titel des Textes „Hab isch gesehen mein Kumpel“ (Z. 68 f.) auf und die Aussage „Ich geh Schule“ (Z. 70) an. Weiterhin gibt es nach Ansicht des Autors auch „in der Alltags-Umgangssprache […] bereits deutliche Tendenzen […], die von vielen Migrantensprachen gestützt werden“ (Z. 70 ff.). Zur Veranschaulichung dieser erwähnt er die „neue Steigerung mit ‚mehr‘“ (Z. 74), wie „‚mehr geeignet‘“ (Z. 74) oder „‚mehr zuständig‘“ (Z. 74 f.), und „die zahlreichen neudeutschen Ausdrücke mit ‚machen‘ wie ‚einen Film machen‘ [oder] ‚ein Tor machen‘“ (Z. 79 ff.), die ihren Ursprung in unterschiedlichen Migrantensprachen finden.
Die nächste These des Autors besagt, dass es „[i]n der heißen Phase des kontaktinduzierten Wandels der Sprachstrukturen […] es nun dazu [kommt], dass die ‚Fehler‘ der Migranten allmählich von den deutschen Muttersprachlern nachgeahmt werden“ (Z. 84 ff.), was in der Fachsprache auch „foreigner talk“ (Z. 88) genannt wird. Diesem Umstand ist zu schulden, dass die Grenzen zwischen den Sprachen verschwimmen und niemandem mehr klar ist, wer nun richtig oder falsch liegt (vgl. Z. 90 ff.), sodass „Sprachvermischungen und […] neue[.] Sprachstrukturen“ (Z. 92 f.) entstehen. Der letzte und somit der Schlussabschnitt des Textes setzt mit der These „[d]ie Wissenschaftler halten sich mit der Erforschung dieser Prozesse jedoch noch weitgehend zurück“ (Z. 107 ff.). Im weiteren Verlauf äußert der Autor die Vermutung, dass „[w]ahrscheinlich […] die Linguisten [befürchten], dass sie, wenn sie den Einfluss der Migrantensprachen auf das Deutsche analysieren, schnell in eine Diskriminierungsfalle geraten könnten“ (Z. 109 ff.). Dabei könnten nach Auffassung des Autors Sprachkontakte die Gelegenheit bieten „Deutsche und Migranten in Projekten zusammenzubringen und die Vision einer offenen Gesellschaft mit Leben zu füllen“ (Z. 115 ff.). Der Text endet mit einer Wiederholung aus dem ersten Abschnitt: „Was man nicht braucht, das schleift sich in der Sprache schnell ab“ (Z. 119 f.). Diese Wiederholung akzentuiert am Ende des Textes noch einmal das zentrale Thema des Sprachverlustes.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Uwe Hinrichs an Hand mehrer Thesen, Beispielen und der Meinung von Experten seine Ansichten zum Thema Sprachverlust nachvollziehbar schildert und die Bedeutsamkeit des Themas nachweist. Als zentrale sprachliche Mittel verwendet er dabei Metaphern und Personifikationen zur Veranschaulichung der sich verschlechternden Situation und die Wiederholung am Schluss, welche das Hauptthema noch einmal in den Vordergrund rückt.
Ralph Mocikat: Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben“, verfasst von Ralph Mocikat und veröffentlicht im Jahr 2011, handelt es sich um einen Sachtext, welcher die zunehmend geringe Nutzung der deutschen Sprache in der Wissenschaft thematisiert. Ein möglicher Intentionsaspekt ist der Verlust der deutschen Sprache.
Der zu analysierende Text lässt sich in zwei Sinnabschnitte gliedern. Der erste Sinnabschnitt (Z. 1 – 14) behandelt unterschiedliche Beispiele zum Thema Wissenschaftssprache in Deutschland, während im zweiten Sinnabschnitt (Z. 15 – 33) unterschiedliche Erklärungen zur Thematik dargelegt werden.
Der Text setzt ein mit der Behauptung „In der Wissenschaftskommunikation wird zunehmend auch im Inland ausschließlich die englische Sprache verwendet“ (Z. 1 f.). Weiterhin bemerkt der Autor, der selbst Professor an der Universität in München ist, dass besonders „für naturwissenschaftliche und technische Disziplinen“ (Z. 2 f.) die englische Sprache verwendet wird, sowie dass „[a]uf Kongressen mit ausschließlich deutschsprachigen Teilnehmern […] Vorträge fast immer nur noch auf Englisch gehalten [werden]“ (Z. 3 f.) und dass „Drittmittelgeber […] oft vor[schreiben], Förderanträge lediglich in englischer Sprache einzureichen“ (Z. 4 f.). Auffallend in diesem Abschnitt ist, dass der Autor seine These lediglich auf eigenen Erfahrungen stützt, die in keiner Weise belegt oder näher erläutert werden.
Der zweite Abschnitt setzt mit der These „Immer mehr Hochschulen stellen Studiengänge komplett auf Englisch um“ (Z. 6). Seine These belegt der Autor an nicht näher benannten „Studien aus den Niederlanden, Schweden oder Norwegen“ (Z. 7), welche nach Ansicht des Autors veranschaulichen, dass „das tiefere Verständnis deutlich eingeschränkt ist, wenn Studierende den Stoff in ihrer Disziplin nur in der Lingua franca aufnehmen“ (Z. 7 ff.). Der Umstand, dass die Studien nicht näher benannt, beziehungsweise erläutert werden macht ihre Funktion als Beleg fraglich und nicht überzeugend, wobei es darüber hinaus durchaus möglich wäre zu recherchieren wie viele Studiengänge in Deutschland auf Englisch ablaufen.
Den dritten Abschnitt leitet der Autor mit der Aussage „Auch bei uns erleben wir täglich, welche Konsequenzen es mit sich bringt, wenn Seminare oder wissenschaftliche Besprechungen nicht mehr in der Muttersprache abgehalten werden: Sie verflachen“ (Z. 10 ff.). Die Pronomen „uns“ (Z. 10) und „wir“ (ebd.) verdeutlichen dabei, dass er seine Ansicht für allgemein gültig hält und wiederholt nicht näher oder namentlich auf Belege eingeht. Unter „uns“ (ebd.) könnten die Mitglieder der Universität an der er tätig ist gemeint sein, aber auch die Mitglieder seines Arbeitskreises oder die gesamten Professoren in Deutschland. Wiederholt belegt er diese These mit seinen Erfahrungen, die nicht unbedingt nachweisbar sind. So ist die von ihm gezogene Konsequenz, dass die Seminare verflachen (vgl. Z. 12) mehr auf seine eigene Meinung zurückzuführen, als auf allgemein gültige Fakten. Weiterhin bemerkt Mocikat, dass „die Diskussionsbereitschaft [in vielen Seminaren] dramatisch schwindet, wenn die Fachsprache Englisch ist, selbst wenn alle Teilnehmer das Englische hervorragend beherrschen“ (Z. 12 ff.). Diese Aussage ist ebenfalls auf seine persönliche Ansicht zurückzuführen, da keine weiteren Angaben darüber gemacht werden, ob auch anderer Betroffene seine Ansicht teilen.
Wolfgang Krischke: Schreiben in der Schule
Analyse:
Bei dem vorliegenden Text „Schreiben in der Schule – booaaa mein dad voll eklich wg schule“, verfasst von Wolfgang Krischke und veröffentlicht im Jahr 2011, handelt es sich um einen Sachtext. Thematisiert werden die Ursachen der fehlerhaften Schreib- und Ausdrucksweise von Schülern in Bezug auf den Einfluss digitaler Kommunikationsformen.
Bereits der Titel des Textes „Schreiben in der Schule – booaaa mein dad voll eklich wg schule“ lässt den Kontrast zwischen formaler Sprache und Umgangssprache erkennen. Der formale Beginn „Schreiben in der Schule“ (ebd.) ist grammatikalisch, sowie sprachlich korrekt. Im Kontrast dazu steht, formal durch einen Gedankenstrich getrennt, die umgangssprachliche Aussage „booaaa mein dad voll eklich wg schule“ (ebd.). Mit dieser Aussage gibt der Autor ein Beispiel für viele charakteristische Fehler in der alltäglichen Kommunikation über elektronische Kommunikationsformen. Die Aussage setzt mit der Interjektion „booaaa“ (ebd.) ein. Die Interjektion, die in formalen Texten keine Verwendung finden würde, verdeutlicht, dass es sich hierbei die Schriftweise der Alltagssprache angeglichen wird. Zudem verdeutlicht der Anglizismus „dad“ (ebd.), den Einfluss anderer Sprachen auf die Muttersprache, der sich erheblich durch die differenzierte Orthografie, beispielsweise in Form der Groß- und Kleinschreibung, darstellt. Dieser Umstand wird besonders an den Nomen „dad“ (ebd.) und „schule“ (ebd.) veranschaulicht, die in der vorliegenden Aussage klein geschrieben wurden, obwohl sie als Nomen eigentlich groß geschrieben werden müssten. Weiterhin ist auch die Abkürzung „wg“ (ebd.) für die Präposition „wegen“ eine Darstellung des Sprachverlustes in elektronischen Kommunikationsformen. Insofern gibt der Titel bereits erste Vorausdeutungen auf die angeführten Argumente. Der Untertitel „Simsen macht Schüler nicht dumm. Aber ihre Texte sind heute fehlerhafter als früher“ (Z. 1) lässt sich als erste These des Textes auslegen. Mit der Behauptung „Simsen macht Schüler nicht dumm“ (ebd.) legt Krischke seine Ansicht in Bezug auf die elektronischen Kommunikationsformen dar. Er ist der Auffassung, dass die Nutzung von elektronischen Kommunikationsformen, hier am Beispiel der SMS dargestellt, keine direkten negativen Folgen auf die Bildung der Schüler hat, auch wenn er eingesteht, dass deren „Texte […] heute fehlerhafter als früher“ (Z. 1) seien. Seinen Text beginnt Krischke mit dem gesellschaftlichen Vorwurf „Kinder lesen zu wenig“ (Z. 2). Diesen Vorwurf formuliert der Autor als Frage, um den Leser dazu anzuregen sich seine eigene Meinung zu der Thematik zu bilden. Seine Meinung positioniert Krischke in der Antwort „[v]on wegen“ (Z. 2) auf die von ihm gestellte Frage. Darüber hinaus stellt er fest, dass Kinder „[w]ohl noch nie zuvor […] so viel gelesen und geschrieben [haben] wie heute“ (Z. 2 f.). Die Formulierung "[w]ohl noch nie" (ebd.) verdeutlicht die Möglichkeiten, die diese Generation in Bezug auf Kommunikation mit anderen hat. Seine Behauptung stützt Krischke durch eine Aufzählung an Beispielen aus dem alltäglichen Leben, wie „[t]äglich tippen sie Millionen von Wörtern auf ihren Handy- und Computertastaturen, verbringen Stunden mit der Lektüre von SMS-Nachrichten, Chat-Sprüchen, E-Mails und Internetinfos (Z. 2 ff.), welche ebenfalls die Möglichkeiten der Jugendlichen zur Kommunikation darstellen. Allerdings ergänzt Krischke wenig später, dass diese Form der Kommunikation als Plaudermedium dient (vgl. Z. 8) und somit „[v]on den Normen der Hochsprache […] Lichtjahre entfernt [ist]“ (Z. 8 f.). Die Metapher und Hyperbel „Lichtjahre entfernt“ (ebd.) verdeutlicht, dass eine Distanz zwischen Plaudersprache und Hochsprache vorhanden ist. In diesem Zusammenhang greift der Autor den Titel des Textes noch einmal als Beispiel auf. Seiner Ansicht lassen „Gebilde wie ‚booaaa mein dad voll eklich wg schule –stöhn* haste mo zeit? hdgdl [= hab dich ganz doll lieb]‘ lässt Freunde des Dudens und ganzer Sätze noch immer zusammenzucken“ (Z. 9 ff.). Diese Ansicht ist insofern nachvollziehbar, als dass das im Beispiel angeführte Satzgebilde in grammatikalisch korrekter Hochsprache ‚Mein Vater ist verärgert. Hast du morgen Zeit? Hab dich lieb‘ lauten müsste. Den zweiten Sinnabschnitt des Textes leitet der Autor mit der aus dem ersten Abschnitt resultierenden Frage „Können Jugendliche, die sich in diesen sprachlichen Trümmerlandschaften bewegen, überhaupt noch einen lesbaren Aufsatz, einen präzisen Bericht, ein angemessenes Bewerbungsschreiben verfassen?“ (Z. 12 ff.). Auffallend ist bei dieser Frage die Metapher „sprachliche Trümmerlandschaft“ (ebd.). Die Metapher verbildlicht das negative Bild des Autors von der von ihm als solche bezeichneten Plaudersprache. Weiterhin hat die Frage, insbesondere auch durch die spezifische Aufzählung, die Intention, dass der Leser sich seine eigene Meinung bilden muss und demnach angeregt wird den Text weiter zu verfolgen um sich über die Argumente und Sichtweisen des Autors zu informieren. Krischke argumentiert im Folgenden mit der Germanistik-Professorin Christa Dürscheid von der Universität Zürich, welche Laut dem Autor „dieser Frage auf den Grund gegangen ist“ (Z. 16). Er erläutert sie habe „[m]it ihrem Team […] fast 1000 Deutschaufsätze untersucht, verfasst von 16- bis 18-jährigen Schülern aller Schulformen aus dem Kanton Zürich“ (Z. 16 ff.). Verglichen wurden diese mit über 1100 Texten in Form von SMS, E-Mails, Chat-Beiträgen und Mitteilungen in sozialen Netzwerken, die in der Freizeit von denselben Jugendlichen verfasst wurden (vgl. Z. 18 ff.). In dieser Studie wurden neben „Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik [ebenso] Wortschatz, […] Stil und […] Aufbau der Texte“ (Z. 23) untersucht. Das Ergebnis der Studie stützt die These des Autors. Das Team rund um Christa Dürscheid hat herausgearbeitet, dass „die sprachlichen Eigenarten der Netzkommunikation [keine] nennenswerte[n] Spuren in den Schultexten hinterlassen [haben]“ (Z. 24 f.). Christa Dürscheid erläutert das Ergebnis in einem Zitat mit dem Fazit, dass Schüler „‘die Schreibwelten durchaus trennen [können]‘“ (Z. 26). Ebenfalls ergänzt sie, dass die Schüler „‘wissen, dass in der Schule und der formellen Kommunikationswelt andere Regeln gelten als beim Chatten mit Freunden‘“ (Z. 27 ff.). Das Zitat der Germanistik-Professorin in Bezug auf das Ergebnis ihrer Studie macht das Argument überzeugender, besonders da sie die These des Autors in einer wissenschaftlichen Studie belegt. Der Autor verwendet die Studie als Beweis dafür, dass seine These korrekt ist. Demnach befasst er sich im dritten und letzten Sinnabschnitt des Textes mit den Ursachen der fehlerhaften Texte. Auch wenn die „elektronische Kommunikation als Verursacher ausscheidet […] sind [die Texte] alles andere als fehlerfrei“ (Z. 31), so der Autor. Seiner Ansicht nach gibt es besonders „in der Rechtschreibung und Zeichensetzung […] deutliche Defizite“ (Z. 33 f.). Diese These wird nicht weiter erläutert, sondern als allgemein gültig abgetan. Krischke benennt, dass die Entwicklung der fehlerhaften Schreibweise in den siebziger Jahren begann (vgl. Z. 34 f.). In dieser Zeit forderten „Deutschleherer die Kinder stärker als zuvor zum freien, spontanen Schreiben“ (Z. 35 f.) auf, was zur Konsequenz hatte, dass die „[f]ormale Korrektheit […] an Bedeutung [verlor]“ (Z. 38).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Krischke in seinem Text die Schuld der elektronischen Kommunikationsmedien an der fehlerhaften Schreibweise der Jugendlichen ausschließt und diese auch an Hand einer Studie belegt. Weiterhin sieht er die Ursache für die fehlerhaften Texte in den Unterrichtsmethoden, die in den siebziger Jahren von den Deutschlehrern praktiziert wurden. Sprachlich-formal gestaltet Krischke seinen Text mit Metaphern wie beispielsweise „sprachlichen Trümmerlandschaften“ (Z. 13) zur Untermalung seiner Ansichten und Aufzählungen zur Verdeutlichung der Möglichkeiten, die die Jugendlichen heute haben.
Stellungnahme:
Wie alle anderen Sprachen auch, ist die deutsche Sprache einem stetigen Wandel unterzogen. In der modernen Welt bleibt es daher nicht aus, dass auch Begriffe aus anderen Sprachen in den deutschen Sprachgebrauch aufgenommen werden. Besonders häufig stammen diese Begriffe aus dem Englischen, sogenannte Anglizismen. Anglizismen sind schon lange keine Seltenheit mehr und gehören zum allgemeinen Wortschatz dazu. Begriffe wie Smartphone, Internet, joggen, Promi sind daher schon seit Langem keine Fremdwörter mehr, sondern allgemein bekannt. Die Hauptursache für die Übertragung der englischen Begriffe ins Deutsche liegt in der Globalisierung, oder konkreter gesagt in der Vernetzung der Welt. Durch den stetigen Austausch in Form von Kommunikation, Handel, aber auch Personen kommt es zu einer Vermischung der Kulturen und Sprachen. In der Kommunikation geschieht dies auf Grund der Tatsache, dass es sich bei Englisch um eine Weltsprache handelt. Eine Weltsprache, die viele Menschen beherrschen ermöglicht eine direkte Kommunikation, sodass keine Dolmetscher benötigt werden. Deutlich bemerkbar macht sich der Umstand, dass es eine Sprache gibt, in der es möglich ist vielen Menschen aus verschiedenen Kulturen den Zugang zu wichtigen Informationen schnell und verständlich möglich zu machen, in der Wissenschaft. Forschungsergebnisse, Erfahrungen und Bitten um Hilfe können in Englisch rund um die Welt verbreitet werden und somit zum einen die nationale Wissenschaft, aber auch die allgemeine Medizin und die Lebensweise der Menschen bereichern. Auch im Handel ist auf die englische Sprache nicht zu verzichten. Von kleinen Geschäften zwischen Privatpersonen, bis hin zu großen Konzernaufträgen, laufen Gespräche, Verträge und Transport auf Englisch ab. Aber nicht nur der Transport der Waren ist eine Ursache für die Aufnahme von Anglizismen ins Deutsche, sondern auch die Waren an sich. Beispielsweise gibt es Produkte für die es gar keine deutsche Bezeichnung gibt, wie beispielsweise „Tablet“. Weiterhin werden englische Begriffe aber auch durch die Wanderbewegung der Menschen verbreitet. Es ist heute völlig normal, dass ein Engländer in Deutschland lebt. Er arbeitet hier, hat einen Freundeskreis, hält sich an die geltenden Konventionen und Traditionen. Allerdings bringt er seine Kultur und somit auch seine Sprache in sein neues Heimatland mit. Besonders in der Gastronomie wird dies deutlich. In einem Restaurant ist es durchaus üblich ein Steak zu bestellen oder in einem Café einen Tee zu trinken. Beides Bezeichnungen und Gerichte bzw. Getränke die aus englischsprachigen Ländern stammen. Als letzter Punkt wären ebenso die sozialen Medien zu nennen, die heute von mehreren Millionen Menschen genutzt werden. Facebook, Instagram und Twitter sind in der modernen Zeit stetige Wegbegleiter und nicht mehr aus dem gesellschaftlichen Miteinander wegzudenken. Der Kontakt mit anderen Menschen war noch nie zuvor so leicht herzustellen, genauso wie sich über die aktuellen Geschehnisse in der Welt zu informieren. Die Einführung der Anglizismen brachte jedoch einige Konsequenzen mit sich. Zum einen ist der Sprachverlust zu nennen. Es wird heute nicht mehr als nötig empfunden für englische Produkte eine deutsche Bezeichnung zu erfinden. Im Gegenteil, es werden sogar eher englische Begriffe verwendet, als Deutsche. Besonders deutlich wird dies an den Substantiven „Team“ und „Trainer“. Es ist, besonders bei Jugendlichen, da diese stärker im Kontakt mit der englischen Sprache stehen, selbstverständlich den Begriff „Team“ anstelle des deutschen Begriffs „Mannschaft“ zu verwenden. Für die Bezeichnung „Trainer“, die ebenso aus dem Englischen stammt, gibt es noch nicht mal mehr ein deutsches Synonym. Eine weitere Konsequenz für die Sprache ist nicht nur die Überführung einzelner Begriffe ins Deutsche, sondern ganzer Satzstrukturen, die die geltende Grammatik und Rechtschreibung in Frage stellen. Ein anderer Aspekt ist darüber hinaus die Sprachbarrieren die zwischen den einzelnen Generationen entstehen. Während die Jugend sich schnell an die neuen Begrifflichkeiten gewöhnt und diese im Alltag einsetzt, so ist dies bei deren Eltern schon seltener und es treten oftmals Verständnisschwierigkeiten auf. Besonders schwerwiegend sind diese dann zwischen Enkeln und Großeltern, da diese in der Schule meist kein Englisch gehabt hatten und es auch im privaten Gebrauch nur selten relevant war.
Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass Anglizismen die moderne Welt in der Wissenschaft, im Handel und allgemein im Zusammenleben der Menschen bereichert haben. Allerdings sind auch die schwerwiegenden Konsequenzen für die nationale Sprache zu beachten. Somit stehen negative Aspekte wie Sprachverlust, Grammatikverfall und fehlerhafte Rechtschreibung den positiven Seiten der Anglizismen gegenüber.
Abschrift 1. Klausur
Analyse:
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Hallo?“, verfasst von Georg Diez und veröffentlicht im Jahr 2013 als Artikel in der 28. Ausgabe des Magazins „Der Spiegel“, handelt es sich um einen Sachtext zum Thema Auswirkungen der digitalen Kommunikation auf ein Individuum.
Bereits der Titel des Textes „Hallo?“ gibt Aufschluss über die Thematik. Die Frage „Hallo?“ wird in der täglichen Kommunikation genutzt um beispielsweise zu erfragen ob jemand am anderen Ende der Telefonleitung, des Mail-Eingangs oder im sozialen Netzwerk noch anwesend bzw. aufmerksam ist und plant auf die gestellte Frage oder Aussage zu reagieren. Im Untertitel „Warum man als Mensch, der E-Mails schreibt, einsam wird“, wird ebenfalls der Bezug zur Thematik geschaffen, aber weiterhin ist dies auch die erste These des Textes.
Allgemein lässt sich der Text in drei Sinnabschnitte einteilen. Der erste Sinnabschnitt (Z. 1 – 26) befasst sich mit einem Erfahrungsbericht des Autors wie er die digitale Kommunikation im Alltag nutzt. Der zweite Sinnabschnitt (Z. 27 – 53) thematisiert die Konsequenzen der Nutzung. Der dritte Sinnabschnitt (Z. 54 – 73) gibt eine Erklärung für die Thematik des Textes und spiegelt die persönliche Meinung des Autors wider.
Der zu analysierende Text setzt mit der Vorstellung des Autors „[e]s gibt ein Loch in meinem leben, in das schaufle ich täglich Worte hinein, Ideen, Gedanken, ich schaue ihnen nach, wie sie fallen und warte, ob ich etwas höre, einen Ton, einen Hall, eine Reaktion, aber das Loch bleibt schwarz und stumm“ (Z. 1 ff.) ein. Diese philosophische Vorstellung lässt sich auf den Titel des Textes beziehen. Die im Titel gestellte Frage „Hallo?“ erwartet eine Reaktion, die jedoch wie in der hier dargestellten Vorstellung ausbleiben kann. Auch die im Untertitel erwähnte Einsamkeit lässt sich in die Metapher „das Loch bleibt schwarz und stumm“ (Z. 3) wiederfinden, da es keine Reaktion gibt und folglich Stille herrscht. Im weiteren Verlauf beschreibt der Autor die Formen, in der er persönlich digitale Kommunikation im Alltag benutzt. Er beschreibt, wie er seinen Freund A anruft und ihm auf die Mailbox spricht, da dieser nicht an sein Handy gegangen ist (vgl. Z. 4 f.). Die Beschreibung endet mit der Feststellung „und höre nichts zurück“ (Z. 5) in Bezug auf die hinterlassene Benachrichtigung auf der Mailbox. Weiterhin erwähnt der Autor er schicke seiner Kollegin B eine SMS mit Anregungen für Themen (vgl. Z. 6), doch auch auf diese Beschreibung folgt die Feststellung des Autors „ich höre nichts zurück“ (Z. 6 f.) in Bezug auf die versendete SMS. Dieser Ablauf sowie die Feststellung werden ein drittes Mal wiederholt, wenn der Autor seinem Freund C eine Mail schreibt, auf die er wiederrum keine Antwort oder Reaktion erhält. Das Beispiel ist in Form eines Trikolons aufgebaut, es gibt zwei Freunde und eine Kollegin, mit denen der Autor versucht in Kontakt zu treten. Diese Handlungen sind in einer Antiklimax angeordnet, da in einem Telefonat zwei Menschen noch mündlich miteinander sprechen, in einer SMS zwar keine direkte mündliche Kommunikation mehr herrscht, allerdings ist diese schneller und oftmals unförmlicher zu beantworten als eine E-Mail. Die Tatsache, dass der Parallelismus „höre nichts zurück“ (Z. 5) nach allen drei Beispielen zu finden ist, drückt die in der ersten These erwähnte Einsamkeit aus. Auch die Antiklimax, die einen Verfall von persönlicher Kommunikation zu unpersönlicher Kommunikation darstellt sowie die distanzierten Bezeichnungen der Freunde mit den Buchstaben A, B und C verdeutlichen die Einsamkeit und besonders die Unpersönlichkeit der digitalen Kommunikation. Die Zeit, die auf dass Hinterlassen einer Nachricht bis hin zur Reaktion des Empfängers folgt, bezeichnet der Autor als „Dramaturgie von Ärger, Geduld und Selbstbefragung (Z. 9). Die Hyperbel „Dramaturgie“ (ebd.) verdeutlicht das Ausmaß bzw. die Erwartungen an die digitale Kommunikation. Es wird verlangt, dass so schnell wie möglich eine Antwort in Form einer Reaktion eintrifft. Eine „stockende Unterhaltung“ (Z. 12) sei, laut Ansicht des Autors, nur schwer aufrecht zu erhalten, was demnach die Erwartungshaltung an die andere Person erklärt und das Gefühl der Einsamkeit nach dem Kommunikationsvorgang noch einmal aufgreift. In dieser Einsamkeit stellt sich der Autor nach eigenen Angaben, Fragen darüber, weshalb die betroffenen Personen nicht antworten, ob es an ihm läge oder ob sie sauer seien (vgl. Z. 15 ff.). Folglich resultieren aus der Einsamkeit Selbstzweifel und Gedanken, die „keine Grundlage sein [können] für weitere Freundschaft, Freude, Zusammenarbeit“ (Z. 23). Demnach folgt nach der Einsamkeit durch die ausbleibende Antwort im schlimmsten Fall die Entfremdung und der Abbruch der Freundschaft. Mit dieser Erkenntnis endet der erste Sinnabschnitt.
Der zweite Sinnabschnitt (Z. 27 – 53) setzt mit der Aussage des Autors „Ich bin nun ganz auf mich zurückgeworfen“ (Z. 27) ein. Diese Aussage ist eine Schlussfolgerung aus dem zuvor genannten Beispiel und stellt wiederholt die Einsamkeit des Individuums dar. An diese Aussage schließt sich die zweite These des Autors an. Diese lautet: „Je mehr geredet, geschrieben und getwittert wird, desto gellender ist die Stille, desto epischer entfaltet sich die Ruhe“ (Z. 28 f.). Der Autor sagt mit dieser These aus, dass die digitalen Kommunikationsformen in der heutigen Zeit stetig präsent sind und es dadurch umso seltener und besonders ist, wenn Stille herrscht. Die Präsenz der digitalen Kommunikationsformen wird in der These durch die Aufzählung „geredet, geschrieben und getwittert“ (ebd.), insbesondere durch die letzten beiden, dargestellt. Der Parallelismus „desto gellender die Stille, desto epischer entfaltet sich der Raum“ (Z. 29) untermauert durch die gleiche Abfolge von „desto“ (ebd.) sowie einem Adjektiv und Verb in Kombination mit den Substantiven „Stille“ (ebd.) und „Ruhe“ (ebd.) im Kontrast zur Aufzählung die Besonderheit und Seltenheit der Einsamkeit. Im Folgenden erwähnt der Autor, dass er seine Freunde gebeten hatte auf seine Nachrichten schneller zu reagieren, doch er sei sich dabei vorgekommen, „wie ein Zwölfjähriger, der Professor spielt“ (Z. 37). Dieser Vergleich ist ironisch zu verstehen, da er angibt ihnen diese Aufforderung „meist auf die Mailbox [gesprochen] oder […] die Anregung als SMS oder als Mail [geschickt habe]“ (Z. 38). Eine Erklärung dafür gibt der Autor in der Wiedergabe eines Gespräches mit einem befreundeten Journalisten, der zugibt, er bekomme jeden Tag so viele Mails, dass er sie gar nicht mehr lese (vgl. Z. 39 ff.). Hier ist ein Kontrast zur Ansicht des Autors zu finden. Während der Autor die Einsamkeit durch die eintreffenden Antworten als negativ abtut, sind Menschen wie der befreundete Journalist bereits so weit, dass sie Nachrichten, in diesem Fall Mails, gar nicht mehr lesen, um etwas Einsamkeit und somit Ruhe zu erhalten. Der Autor führt in diesem Zusammenhang den Neologismus „i-crazy“ (Z. 42) an, den er dadurch definiert, dass er behauptet wir Menschen würden verrückt werden „vor lauter Smartphones, Facebook, SPIEGEL ONLINE, dass unser Hirn das alles nicht mehr schafft“ (Z. 42 f.). Diez ist allerdings der Ansicht, dass es sich dabei um eine Ausrede handle (vgl. Z. 45). Er räumt jedoch ein, dass die Art der Kontaktaufnahme sich geändert, das Konzept der Präsenz sich gewandelt hat und es auch extreme Beispiele für digitale Kommunikation gibt (vgl. Z. 45 ff.). Der Umstand, dass er die Anapher „[s]icher“ (Z. 45, Z. 46, Z. 48) nutzt, um die Einwände einzuleiten, verdeutlicht durch die stetige Wiederholung, dass diese durchaus berechtigt sind, aber er dennoch an seiner Ansicht festhält. Am Ende des zweiten Sinnabschnittes stellt Diez die Frage: „Aber erklärt die angebliche Überforderung wirklich schon die Unhöflichkeit, den beiläufigen Narzissmus und die in der Konsequenz stumme Verachtung, die darin liegt, in diesem Fall mich so lange auf eine Antwort warten zu lassen?“ (Z. 51 ff.). Diese Frage regt den Leser dazu an sich seine eigene Meinung zu bilden, doch diese wird durch die negativ behafteten Substantive, wie „Unhöflichkeit“ (ebd.), „Narzissmus“ (ebd.) oder „Verachtung“ (ebd.), beeinflusst.
Im dritten Sinnabschnitt (Z. 54 – 73) behauptet der Autor, dass er „eine andere Theorie“ (Z. 54) habe. Er ist der Ansicht, „dass die Menschen die Logik der Technik in ihr Leben gelassen haben und nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was sie denken und dem, was sie tun“ (Z. 54 ff.). Um seine Theorie zu erklären, gibt der Autor im weiteren Verlauf en Beispiel an. Er erläutert, dass „[w]enn A also meinen Anruf abhört, denkt er, er sollte mich zurückrufen, und indem er das denkt, hat er im Grunde schon mit mir gesprochen“ (Z. 57). Seine These lässt sich laut Diez selbst kompakt in der Feststellung „Der Gedanke hat die Tat ersetzt“ (Z. 58 f.) festhalten. Resultierend aus dieser Feststellung bzw. seiner Theorie generell wirft er die Frage auf, ob „wir nicht alle längst im Kopf unserer Mitmenschen [sitzen]“ (Z. 59). Diese Frage regt den Leser zum Nachdenken an und wird durch die Leerzeile (Z. 60) formal veranschaulicht. Das Ende des Textes nutzt der Autor, um die Auswirkungen der Technik auf die Menschen darzulegen. Zu den negativen Auswirkungen werden die natürlichen Eigenschaften des Menschen gezählt, die durch die Technik besonders hervorgehoben werden, wie „Müdigkeit“ (Z. 66), „Zerstreutheit“ (Z. 67) und „Faulheit“ (ebd.). Auf der anderen Seite stehen die positiven Eigenschaften, die in den Menschen durch die Technik hervorgerufen werden, wie beispielsweise der „rücksichtsvoll[e], höflich[e], respektvoll[e]“ (Z. 70) Umgang miteinander, der verdeutlicht, dass „die Technik […] nicht der Feind [ist]“ (Z. 70 f.), sondern als Mittel für den Menschen“ (Z. 71) funktioniert. Der Text endet mit der Aussage des Autors „Im Grunde, das haben Sie schon richtig verstanden, würde ich mich freuen, wenn A mal wieder anruft (Z. 72 f.). Durch das Personalpronomen „Sie“ (Z. 72) wird der Leser ein letztes Mal explizit angesprochen und somit auch zum Ende hin in den Text eingebunden und zum Nachdenken angeregt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Georg Diez in seinem Artikel versucht die Leser von seiner negativen Ansicht die Auswirkungen der digitalen Kommunikation betreffend zu überzeugen. Dazu verwendet er neben eigenen Erfahrungen, einem Gespräch mit einem befreundeten Journalisten, Beispiele aus dem Alltag, wenig Fachsprache und hypotaktischem Satzbau stilistische Mittel wie Aufzählungen, Metaphern oder Parallelismen, die den Text für die Leser einfach, verständlich und somit auch nachvollziehbar machen.
2. Aufgabe:
Durch die Einführung von digitalen Kommunikationsformen hat sich auch die allgemeine Kommunikation verändert. Dies soll im Folgenden an unterschiedlichen Beispielen verdeutlicht werden.
Mit der Verbreitung digitaler Kommunikationsformen ist es heute einfacher und schneller mit anderen in Kontakt zu treten. E-Mails, SMS und soziale Netzwerke bieten die Möglichkeit Fragen zu stellen, Meinungen zu teilen oder einfach Alltägliches zu besprechen. Weiterhin bieten sie die Möglichkeit mit Menschen rund um den Globus in Kontakt zu treten und mit diesen Freundschaften zu schließen. Auch im späteren Leben kann man durch digitale Kommunikationsmittel einfacher den Kontakt zu alten Klassenkameraden oder Kindheitsfreunden halten, als durch Briefe oder Telefonate. Es geht schneller, man hat heute schließlich jederzeit ein Handy bei sich und ist somit sofort und einfach zu erreichen. Positiv ist ebenso, dass viele Menschen innerhalb kurzer Zeit informiert werden können. Beispielsweise ist dies bei Unwettern sehr nützlich, da die Menschen sich dann darauf vorbereiten können. Allerdings ist die ständige Erreichbarkeit geprägt von zwei Seiten: einer positiven und einer negativen. Die positive Seite wurde zuvor ausreichend erläutern. Auf der negativen Seite stehen jedoch der Zeitaufwand und die fehlende Ruhe. Während in der Zeit, als es lediglich Briefe als indirekte Kommunikationsform gab, Menschen oftmals mehrere Tage oder Wochen auf eine Antwort gewartet haben, ist es heute so, dass manche bereits gereizt sind, wenn nach ein paar Minuten noch keine Antwort gekommen ist. Mittlerweile ist eine Abhängigkeit von den digitalen Medien festzustellen. Menschen benutzen sie mehrfach, wenn nicht sogar dauerhaft am Tag, um sich das Leben zu erleichtern. Kinder ohne Handy, Laptop oder anderen Zugang zu digitalen Kommunikationsformen oder sozialen Netzwerken werden oftmals von ihren Mitschülern ausgeschlossen oder finden keinen Anschluss. Dabei birgt die frühe Konfrontation mit digitalen Kommunikationsformen viele Gefahren und Risiken für junge Menschen. Besonders Kinder sind sehr naiv und geben unbedacht private Informationen, Bilder und Daten im Netz preis. Die digitale Kommunikation bietet ebenso die Möglichkeit selbst zu kontrollieren, wie man sich präsentiert. Dies kann sowohl positiv, als auch negativ sein. Besonders negativ ist es bei sogenannten Fake-Profilen oder unseriösen Unternehmen, die sich hinter aufwendig gestalteten Webseiten verbergen. Daraus ergeben sich große Distanzen, die in der direkten und persönlichen Kommunikation nicht zwangsweise auftreten würden. Aus diesem Grund ist auch die Verbindlichkeit von Aussagen, sowie Angaben oder Daten gegeben. Jeder kann Informationen ins Internet stellen, die von anderen oder vorherige Prüfung als Richtig angesehen werden. Aber auch abgesprochene Termine können problemlos kurz vorher abgesagt werden ohne sich zwangsweise in irgendeiner Form dazu äußern zu müssen, oder gar nicht auf Mitteilungen oder Fragen reagieren. Georg Diez führte in seinem Text „Hallo?“ als Erklärung dessen den Begriff „digitale Unverbindlichkeit“ (Z. 64) ein. Der Begriff beschreibt Menschen, die bewusst digitale Nachrichten oder Mitteilungen nicht lesen, da ihnen die Zeit fehlt darauf zu antworten, sie deren Inhalt als unwichtig erachten oder schlicht und einfach ihre Ruhe haben möchten. Georg Diez gehört zu der Gruppe von Menschen, die erwarten so schnell wie möglich eine Antwort zu erhalten. Dies macht er in seinem Text mehr als deutlich. Er versucht die Leser durch persönliche Schilderungen sowie Fragen und direkte Ansprache von seiner Ansicht zu überzeugen. Er nutzt weiterhin Assoziationen, sowie Aufzählungen in Form einer Klimax, Trikolons, Parallelismen, eine Anapher oder Metaphern um seinen Text leichter verständlich zu machen.
Alles in allem ist der Text von Georg Diez durchaus überzeugend, auch wenn er sich in erster Linie mit der negativen Seite befasst hat und nur wenige Einschübe der anderen Sichtweise bringt.
Lyrik
Andreas Gryphius: Es ist alles eitel
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Es ist alles eitel“, geschrieben von Andreas Gryphius und verfasst im Jahr 1637, handelt es sich um ein Gedicht aus der Zeit des Barock. Thematisiert wird die Vergänglichkeit des Irdischen. Inhaltlich handelt das Gedicht von der Zerstörung des 30-jährigen Krieges und den Folgen der Zerstörung.
Das Gedicht umfasst 14 Strophen und ist in der Form eines Sonettes gegliedert. Als Reimschema liegen in den Quartetten umschließende Reime vor, während die Terzette durch Paarreime gekennzeichnet werden. Als Metrum liegen durchgehend sechs-hebige Jamben vor, die 12 bis 13 Silben beinhalten und durch eine Mittelzäsur geteilt werden vor. Es liegen sowohl stumpfe als auch klingende Kadenzen vor, die sich dem Reimschema des Gedichtes anpassen.
Der zu analysierende Text setzt mit der Aussage „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V. 1) ein. Die „Eitelkeit“ (ebd.), die bereits im Titel des Gedichtes Erwähnung findet, ist in diesem Fall als veraltetes Synonym für Vergänglichkeit zu verstehen. Der Inhalt des Verses spiegelt die Situation in der Entstehungszeit des Gedichtes wieder. Das Gedicht ist während des 30-jährigen Krieges entstanden, in welchem viele Städte und Gebiete zerstört wurden und in dem die Lebensbedingungen der Menschen sehr schlecht waren. Das lyrische Ich beschreibt, dass egal wohin man sich wendet, überall nur Vergänglichkeit zu sehen ist. Die Repetitio der Formulierung „du siehst“ (ebd.) veranschaulicht die allgemeine Gültigkeit der Aussage des Lyrischen Ichs. Generell lässt bereits der erste Vers des Gedichtes eine resignative Stimmung erschließen, da der Krieg in dieser Zeit für die Bevölkerung sehr belastend war. Dies wird ebenfalls durch die antithetische Struktur der nächsten Verse verstärkt. Das Lyrische Ich beschreibt „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V. 2). Auffällig sind neben der Kontrastierung zwischen den Zeitangaben „heute“ (ebd.) und „morgen“ (ebd.), auch die Pronomen „dieser“ (ebd.) und „jener“ (ebd.), welche auf jede Person zu beziehen sind und die Aussage somit verallgemeinern. Auch hier wird wieder die Situation während des Krieges in Bezug auf die Vergänglichkeit aufgegriffen. Was die Menschen an einem Tag bauen oder bereits vor geraumer Zeit gebaut haben, kann am nächsten Tag schlagartig zerstört werden. Im folgenden Vers veranschaulicht das Lyrische Ich die Aussage durch das Beispiel „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3). Das Beispiel ist durch das Reimschema formal mit dem vorhergehenen Vers verbunden und verdeutlicht zum einen die Vergänglichkeit, zum anderen aber auch ein Anzeichen für die Zerstörung während des Krieges. Die antithetische Struktur, die in den ersten drei Versen des Textes verwendet wird, wird durch das Versmaß verstärkt. Als Versmaß liegen Alexandriner vor, die durch eine Mittelzäsur geteilt werden. Der monotone Rhythmus des Alexandriners verstärkt die ohnehin resignative Stimmung des Gedichtes, während die Mittelzäsur die genannten Gegensätze voneinander separieren. Diese Trennung wird formal durch ein Komma verbildlicht und somit hervorgehoben. An das Beispiel im dritten Vers knüpft der vierte Vers unmittelbar an. Es ist erneut die Rede von der Wiese „[a]uf der ein Schäfers-Kind wird spielen mit den Herden“ (V. 4). Die Metapher des „Schäfers-Kind“ (ebd.) auf einer Wiese, verdeutlicht die Sehnsucht nach der friedlichen Zeit, wie sie vor dem Krieg war, und wiederholt die Vergänglichkeit bzw. die Nichtigkeit des vom Menschen Erschaffenen. Auffällig ist, dass in diesem Vers, nicht wie in den übrigen, die Mittelzäsur durch ein Komma dargestellt wird. Der Vers wirkt somit trostlos, was durch die stumpfe Kadenz am Versende verstärkt wird.
Die zweite Strophe des Gedichtes setzt mit der Feststellung „[w]as jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5) ein. Erneut ist die Kontrastierung zwischen dem gegenwertigen Zustand und dem zukünftigen Geschehen zu erkennen, somit wird neben der allgemeinen Vergänglichkeit des Irdischen insbesondere die Vergänglichkeit der Natur hervorgehoben. Die antithetische Darstellung wird wiederholt durch eine Mittelzäsur und das Komma formal getrennt, was die Kontrastierung des Inhalts innerhalb des Verses veranschaulicht. Das Adverb „jetzund“, welches zuletzt im 18. und 19. Jahrhundert verwendet wurde, verdeutlicht das Alter des Gedichtes und bestätigt, neben der Sonett-Form und der Verwendung des Alexandriners, dass das Gedicht aus der Epoche des Barock stammt, da dies typische Merkmale für diese Literaturepoche sind. Im zweiten Vers der Strophe „Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V. 6) wird wiederrum die antithetische Struktur des Gedichtes aufgeführt. Die Verben „poch[en]“ (ebd.) und „trotz[en]“ (ebd.) charakterisieren ein lebendiges Wesen. Das Verb „poch[en]“ (ebd.) beschreibt den Herzschlag eines Lebewesens, während „trotz[en]“ (ebd.) als Abwehrhaltung für herannahende Gefahren verstanden wird, die die Existenz des Lebewesens gefährden. Im weiteren Verlauf des Verses wird allerdings auch wider die Nichtigkeit dargestellt, wenn es in Bezug auf das Lebewesen heißt es, es sei „morgen Asch und Bein“ (V. 6). Die Formulierung „Asch und Bein“ (ebd.) steht metaphorisch für den Tod des Lebewesens und verbildlicht somit die Vergänglichkeit des Lebens. Hier lässt sich wieder ein Rückbezug auf die historische Situation vornehmen, da während des Krieges viele Menschen und auch Tiere getötet wurden, die möglicherweise ohne den Krieg noch ein langes Leben geführt hätten. Dieser Umstand verstärkt die resignative Stimmung und deutet bereits eine klimaxartige Steigerung zur ersten Strophe an, da in der ersten Strophe nur die Nichtigkeit des von Menschen Erschaffenen beschrieben wurde, während nun die Vergänglichkeit der Lebewesen Thema ist, auf die der Mensch nicht immer direkten Einfluss hat. Das Lyrische Ich fasst diese Erkenntnis mit dem Befund „Nichts ist, das ewig sei“ (V. 7) zusammen. Unter diesen Befund fallen laut des Lyrischen Ichs auch Materialien wie Erz und Marmorstein (vgl. V. 7), welche im 17. Jahrhundert, in der Zeit als das Gedicht verfasst wurde, noch als unzerstörbar galten und somit wiederholt die Nichtigkeit dessen, was als unzerstörbar galt und des Irdischen im allgemeinen darstellt. Die Strophe endet mit einem Vers in derselben antithetischen Struktur, die bereits in den ersten Versen des Gedichts verwendet wurde. Das Lyrische Ich erklärt „Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden“ (V. 8). Die Personifikation des Glücks steht in diesem Vers der Synästhesie der donnernden Beschwerden gegenüber (vgl. V. 8). Im Zusammenhang mit dem historischen Hintergrund verdeutlicht die Personifikation, dass was die Bevölkerung sich am meisten Wünscht: „Glück“ (V. 8) um zum einen den Krieg zu überleben und zum anderen, dass der Krieg, der sich zu diesem Zeitpunkt schon seit fast 20 Jahren zuträgt, bald endet. Der Krieg wird in diesem Vers durch die donnernden Beschwerden (vgl. V. 8) dargestellt. Das Verb „donnern“ (ebd.) verdeutlicht in der Synästhesie den Beschuss während des Krieges, wohingegen die „Beschwerden“ (ebd.) eine Folge des Beschusses.
Mit der dritten Strophe erfolgt sowohl ein inhaltlicher, als auch ein formaler Umbruch. Während in den ersten beiden Strophen noch vier Verse verwendet wurden und der Kontrast zwischen der gegenwärtigen Situation und den zukünftigen Gegebenheiten in Bezug zur Vergänglichkeit thematisiert wird, werden in der dritten und vierten Strophe nur noch drei Verse verwendet und die Vergänglichkeit des Individuums dargelegt. Die dritte Strophe beginnt mit der Feststellung „Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn“ (V. 9), was soviel heißt wie, die Erfolge, die ein Individuum erzielt hat sind in zum einen in der Zeit des Krieges nichts mehr wert, aber auch im allgemeinen nichts wert, da alles Irdische vergänglich ist. Markant an diesem Vers ist die Verwendung des Metrums in Kombination mit dem Adjektiv „ho[ch]“ (ebd.) in Bezug auf die zustande gebrachten Taten. Zum einen liegt auf dem Adjektiv „ho[ch]“ eine Betonung, welche die Bedeutung des Wortes beim Lesen hervorhebt, aber auch der durch die Zäsur verursachte Anstieg der Stimme bis zum Einschnitt, auf welchen sowohl der Fall der Stimme, als auch der Verfall der Taten folgt. Im folgenden Vers wir das Lyrische Ich, das zuvor nur eine betrachtende und somit eher passive Rolle erfüllte aktiv. Es wirf die rhetorische Frage „Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehn?“ (V. 10). Die rhetorische Frage bezieht sich auf die Vergänglichkeit der Menschen, was an der Metapher „Spiel der Zeit“ (ebd.) deutlich wird. Die Menschen werden mit ihrem Leben als Spielfiguren betrachtet, die nach einer bestimmten Zeit vom Spielbrett gestoßen werden. Der Umstand, dass das Lyrische Ich die Formulierung „der leichte Mensch“ (ebd.) verwendet gibt zum einen Aufschluss über den allgemeinen Wert des Menschen und seines Lebens als Spielfigur und zum anderen wirft es die Frage auf, wer mit den Menschen spielt. Die Antwort auf diese Frage ist nur im Überirdischen zu finden und lässt sich somit mit Gott als Spieler des Spiels beantworten. Er entscheidet darüber in welche Richtung sich die Figuren bewegen, welche Figuren das Spielfeld verlassen und welche bleiben. Der Schlussvers dieser Strophe wird mit der Interjektion „Ach!“ (V. 11) eingeleitet. Dieser Ausruf verdeutlicht die Verzweiflung bzw. die Resignation des Lyrischen Ichs über die gewonnene Erkenntnis bezüglich der Vergänglichkeit. Weiterhin stellt das Lyrische Ich die Frage „was ist alles dies, was wir für köstlich achten“ (V. 11). Das, „was wir für köstlich achten“ (ebd.), sind die irdischen Bestandteile des Lebens der Menschen. Diese vergleicht das Lyrische Ich dann zu Beginn der letzten Strophe des Textes „[a]ls schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind“ (V. 12). Das Wortfeld der verwendeten Substantive stammt aus der Vergänglichkeit, deren Bedeutung auch durch die Aufzählung bzw. durch den Parallelismus in Form eines Trikolons bekräftigt wird. Somit haben die irdischen Bestandteile, die den Menschen wichtig sind, genau wie die Menschen selbst eine zeitliche Begrenzung. Dies wird ebenso im letzten Teil des Vergleiches, der zeitgleich auch der letzte Bestandteil des Trikolons ist, deutlich. Die irdischen Bestandteile des Lebens werden mit einer „Wiesen-Blum“ (V. 13) verglichen, welche „man nicht wider find’t“ (ebd.). Die Lebenszeit der, als Metapher für das Leben der Menschen und der irdischen Bestandteile verwendeten, Blume ist abgelaufen und sie lässt sich nicht wieder zurückholen bzw. der Verfall lässt sich nicht rückgängig machen. Der Vers veranschaulicht somit die Unumgänglichkeit der Vergänglichkeit und stellt somit das Verhalten der Menschen, die die irdischen Bestandteile wertschätzen in Frage. Das Lyrische Ich beendet das Gedicht mit der Aussage „Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten“ (V. 14). Hierbei werden die Erkenntnisse aus dem vorangehenden Vers noch einmal aufgegriffen und beantwortet. Da das irdische vergänglich ist, ist das einzige, das Überirdisch ist gleichzeitig auch das einzige das „ewig ist“ (ebd.). Nach den Vorstellungen der damaligen Zeit (Absolutismus), ist das einzige das Überirdisch ist Gott, gefolgt von den obersten Herrschern. Das Lyrische Ich macht somit zum Ende des Gedichtes klar, dass nur der Glaube an Gott zählt und nicht das Vertrauen an irdische Bestandteile. Graphisch wird diese Aussage, da die finale Erkenntnis des Gedichtes thematisiert wird, mit einem Ausrufezeichen untermauert.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Lyrische Ich die Leser darauf aufmerksam macht, dass alles Irdische vergänglich und somit nichts wert ist. Letzten Endes zählt somit der Glaube an Gott, was den Menschen jedoch nicht in dieser Form benutzt wird. Zentrale formale Elemente des Textes sind die charakteristischen Merkmale des Barocks, wie beispielsweise das monotone Metrum, die Mittelzäsur, die besonders in den ersten beiden Strophen eine Rolle spielt, aber auch die Form des Sonetts selbst, welches durch die klare Struktur und die formale Gliederung das Verständnis des Textes und insbesondere des Umbruchs formal deutlich macht.
Gottfried Benn: Kleine Aster
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Kleine Aster“, verfasst von Gottfried Benn und veröffentlicht im Jahr 1912, handelt es sich um ein Gedicht aus der Zeit des Expressionismus. Thematisiert wird die Unbedeutsamkeit des Individuums in der Zeit des Expressionismus.
Das Gedicht umfasst eine Strophe, bestehend aus 15 Versen. Es ist kein Reimschema auszumachen, zu finden sind ein einzelner Kreuzreim und ein Paarreim. Ebenso lässt sich das Gedicht durch einen freien Rhythmus kennzeichnen.
Der zu analysierende Text setzt mit der Aussage „Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt“ (V. 1) ein. Die Einleitung durch den unbestimmten Artikel „[e]in“ (ebd.) in Bezug auf den ersoffenen Bierfahrer deutet auf eine emotionslose Atmosphäre hin. Diese wird durch die umgangssprachliche Bezeichnung „ersoffen[…]“ (V. 1) anstelle der formaleren und fachlichen Betitelung ertrinken. Weiterhin spielt auch der Umstand, dass die Leiche „auf den Tisch gestemmt“ (V. 1) wurde, was auf einen pietätlosen Umgang mit der Leiche hinweist, darauf an, dass die Atmosphäre, in der sich das lyrische Ich befindet sehr kalt und emotionslos ist. Im weiteren Verlauf beschreibt das lyrische Ich „Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhelllila Aster / zwischen die Zähne geklemmt“ (V. 2 f.). Parallel zum ersten Vers ist hier die Einleitung, in diesem Fall durch das Indefinitpronomen „Irgendeiner“ (V. 2), welches gleichermaßen, wie der unbestimmte Artikel, Unpersönlichkeit und somit Emotionslosigkeit verdeutlicht. Die bisher sehr sachliche Beschreibung des lyrischen Ichs wird durch das Paradoxon „dunkelhelllila“ (V. 2) in Bezug auf die Farbe der Aster unterbrochen. Das Paradoxon legt den Fokus des Lesers auf die Aster, welche einen Kontrast zu der Leiche bildet. Die Aster, die bereits im Titel des Textes erwähnt wird, ist eine Blume die vorzugsweise im Herbst blüht. Dieser Umstand zeigt auf, dass es sich bei der Aster um ein Symbol für Vergänglichkeit handelt. Der Titel „Kleine Aster“ lässt sich daher wie folgt interpretieren. Die Verniedlichung der Aster durch das Adjektiv „[k]lein[…]“ steht im Kontrast zu den ersten Versen des Gedichts. Die Verniedlichung stellt eigentlich eine emotionale Atmosphäre da, die einen Gegensatz zu der abstrakten Beschreibung des Lyrischen Ich zu Beginn des Gedichtes. Der dritte Vers des Textes beendet die Aussage mit der Formulierung „zwischen die Zähne geklemmt“ (V. 3) in Bezug auf den Aufenthaltsort der Aster. Die gedankliche Vorstellung dieses Bildes wirkt paradox und geradezu unpassend in einem Obduktionsraum. Formal ist die Textstelle durch einen Kreuzreim mit dem ersten Vers verbunden. Das Reimschema ist eine formale Verbildlichung des Ausdrucks „geklemmt“ (ebd.) da der Vers, in welchem die Aster erwähnt wird zwischen den beiden sich reimenden Versen steht. Die ersten drei Verse bilden den ersten Sinnabschnitt des Gedichts. Der zweite Sinnabschnitt (Z. 4 – 15) setzt ein mit der Beschreibung „Als ich von der Brust aus / unter der Haut / mit einem langen Messer / Zunge und Gaumen herausschnitt“ (V. 4 ff.) ein. Auffällig ist hier der Umbruch, welcher die Sinnabschnitte inhaltlich voneinander unterscheidet. Im ersten Abschnitt beschreibt das lyrische Ich die die Umgebung und die Leiche, während es im zweiten Sinnabschnitt selbst beginnt zu agieren. Darüberhinaus stammt das Wortfeld der Substantive „Brust“ (V. 4), „Haut“ (V. 5), „Zunge“ (V. 7) und „Gaumen“ (ebd.) aus der Anatomie des menschlichen Körpers. Ergänzt wird dies mit dem Substantiv „Messer“ (V. 6), das zu den Arbeitsinstrumenten des lyrischen Ichs zählt. Das Wortfeld, bzw. die gesamte Situation, sind sehr kalt und emotionslos beschrieben, weshalb der zweite Sinnabschnitt zunehmend bedrohlich wirkt. Dies lässt sich dadurch ergänzen, dass weder ein Rhythmus, noch ein Reimschema oder eine Interpunktion zwischen den vier Versen zu finden ist, was die Situation klimaxartig bedrohlicher wirkt. Im Anschluss daran gibt das lyrische Ich an es „muß […]sie angestoßen haben, denn sie glitt / in das nebenliegende Gehirn“ (V. 8 f.). Es bezieht sich hierbei auf die Aster, die sich im Mund der Leiche befindet. Die gesamte Situation wirkt skurril, da das Beschriebene anatomisch nicht möglich ist, was den paradoxen Kontext des Gedichtes untermauert. Im weiteren Verlauf erklärt das lyrische Ich „Ich packte sie ihm in die Brusthöhle“. Der Umstand, dass sich das lyrische Ich mehr mit der Blume befasst, verdeutlicht dass sein Verhältnis zu der Blume emotionaler ist als zu der Leiche. Dies wird ebenso durch die Tatsache, dass das lyrische Ich die Aster „zwischen die Holzwolle [legte], als man zunähte“ (V. 10 f.) ist mit dem Ablauf einer Beerdigung vergleichbar. Wird das Verhältnis zwischen dem lyrischen Ich und der Leiche analysiert, so ist dies kalt und distanziert, während das Verhältnis zur Aster eher als emotional bezeichnet werden kann. Als Pathologe hat das lyrische Ich täglich mit dem Tod zu tun und somit einen sehr belastenden Beruf. Es distanziert sich von der Leiche und konzentriert sich stattdessen auf die Aster, die es symbolisch für die Leiche beerdigt. Dies wird ebenso durch den gedanklichen Ausruf „Trink dich satt an deiner Vase!“ (V. 12) untermauert. Das lyrische Ich bezeichnet die Leiche als „Vase“ (ebd.), was einer leblosen Hülle, die auch dem Verständnis des lyrischen Ichs für eine Leiche, gleichkommt. Das Gedicht endet mit dem Abschied „Ruhe sanft, / kleine Aster!“ (V. 13 f.) womit das lyrische Ich einen Rückbezug zum Titel schafft und zeitgleich das Sinnbild der Beerdigung untermauert.
Zusammenfassen lässt sich festhalten, dass das lyrische Ich in seinem Beruf schweren psychischen Belastungen ausgesetzt wird und daher emotional kühl, kontrolliert und distanziert reagiert. Die Aster bildet einen Mittelpunkt auf den das lyrische Ich seine Emotionen zentriert. Dies wird durch die Interpunktion, das Wortfeld sowie durch die formale Gestaltung des Gedichts und die verwendeten stilistischen Mittel wie Metaphern, Ellipsen oder Paradoxons gestützt.
August Stramm: Untreu
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Untreu“, verfasst von August Stramm und veröffentlicht im Jahr 1915, handelt es sich um ein Gedicht aus der Literaturepoche des Expressionismus. Thematisiert wird die Treulosigkeit der Partnerin des lyrischen Ichs.
Das Gedicht umfasst eine Strophe mit 12 Versen, welche sich jedoch in zwei Sinnabschnitte gliedern lässt. Im ersten Sinnabschnitt (V. 1 – 3) ist keine eindeutige Anordnung zu erkennen, während im zweiten Sinnabschnitt (V. 4 – 12) jeder zweite Vers lediglich aus einem Wort besteht. Auch inhaltlich unterscheiden sich die beiden Sinnabschnitte. Im ersten beschreibt das lyrische Ich sein Verhalten seiner Partnerin gegenüber, wohingegen es im zweiten Sinnabschnitt die Reaktion seiner Partnerin beschreibt. Es liegen weiterhin ein freier Rhythmus, keine einheitlichen Kadenzen und Reimlosigkeit vor.
Bereits der Titel des Gedichtes „Untreu“ legt das Thema des Textes dar, da das lyrische Ich seine Partnerin bereits damit konfrontiert hat und nun in der Handlung des Gedichtes ihre Reaktion darauf beschreibt. Der Umstand, dass es sich bei der untreuen Person um eine Frau handelt, wird jedoch erst in Vers 10 an Hand des Substantives „Kleidersaum“ (V. 10) bestätigt.
Der zu analysierende Text setzt mit der Bemerkung „Dein Lächeln weint in meiner Brust“ (V. 1) ein. Bereits der Einstieg durch das Possessivpronomen „Dein“ (ebd.) lässt auf eine persönliche oder auch emotionale Atmosphäre hindeuten, da das lyrische Ich seine Partnerin direkt anspricht. Allerdings erscheint die Tatsache, dass ihr „Lächeln weint“ (V. 1) paradox, da das Substantiv „Lächeln“ (ebd.) gewöhnlich mit Freude assoziiert wird, während das Verb „wein[en]“ (ebd.) meist mit Trauer oder Frustration in Verbindung gebracht wird. Das Paradoxon wird in der Metapher „weint in meiner Brust“ (V. 1) weiter ausgeführt. Alles in allem lässt sich der erste Vers insofern interpretieren, als dass das lyrische Ich die Treulosigkeit seiner Partnerin sehr getroffen hat. Mit der Formulierung „Dein Lächeln“, deutet das lyrische Ich an, dass seine Partnerin sich dem lyrischen Ich gegenüber wie zuvor verhält und ihm ihre Untreue nicht beichtet, bzw. sie sich nicht anmerken lässt. Neben der eigentlichen Untreue ist das lyrische Ich von diesem Umstand am meisten getroffen, da seine Partnerin, neben ihrer Treulosigkeit, nicht ehrlich zu ihm ist. Im weiteren Verlauf heißt es „Die glutverbissenen Lippen eisen“ (V. 2). Der Neologismus „glutverbissen[…]“ (ebd.) in Bezug auf die eben erwähnten Lippen, deutet auf eine gefühlvolle Beziehung hin, die nach der Treulosigkeit der Partnerin des lyrischen Ichs nun nicht mehr wie zuvor zu sein scheint. Das aktuelle Verhältnis des Paares wird durch das Adjektiv „eisen“ (V. 2) beschrieben. Mit „eisen“ (V. 2) werden Kälte und Gefühllosigkeit assoziiert, was somit einen Kontrast zum Neologismus „glutverbissen[…]“ (ebd.) darstellt. Der Sinnabschnitt endet mit dem Ausruf „Im Atem wittert Laubgewelk!“ (V. 3). Auch dieser Vers ist von einer Antithese geprägt. Der „Atem“ (ebd.) symbolisiert das Leben während „Laubgewelk“ (ebd.), obwohl es ein Neologismus ist, für Vergänglichkeit und Tod steht, da Blätter die Welken verfallen und somit sterben. Die Interpunktion in Form eines Ausrufezeichens gestaltet ebenso formal das Ende, auch wenn es in diesem Fall lediglich das Ende der Zeile ist. Allgemein ist der erste Sinnabschnitt in Form einer Antiklimax angeordnet. Während im ersten Vers die Gefühle des lyrischen Ichs verletzt wurden, so beeinflusst dies die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und seiner Partnerin bis zuletzt das Ende durch den Tod erwähnt wird.
Der zweite Sinnabschnitt setzt mit der Schilderung „Dein Blick versargt“ (V. 4) ein. Auffällig ist hier erneut ein Neologismus. Die Wortneuschöpfung „versargt“ (ebd.) stellt ein Verb zum Substantiv Sarg dar. Mit einem Sarg wird meist der Tod assoziiert, da die Leiche in einem Sarg in die Erde hinabgelassen wird. Die Verbindung zwischen einem Sarg und einem Blick wirkt paradox, doch es lässt sich so interpretieren, als dass die Partnerin des lyrischen Ichs ihm ihn anblickt nachdem er sie mit ihrer Untreue konfrontiert hat und er nichts weiter als dunkle Leere, ähnlich wie ein Grab für sie empfindet. Der fünfte Vers besteht aus der Konjunktion „Und“ (V. 5), welche den vierten und den sechsten Vers miteinander verbindet und zugleich einen Umbruch in der Struktur des Gedichtes deutlich macht. Der Umbruch erfolgte bereits im Vers zuvor und überspringt die Konfrontation des lyrischen Ichs gegenüber seiner Partnerin.
Joseph von Eichendorff: Die blaue Blume
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Die blaue Blume“, verfasst von Joseph von Eichendorff und veröffentlicht im Jahr 1818, handelt es sich um ein Gedicht aus der Literaturepoche der Romantik. Thematisiert die Sehnsucht nach Glückseligkeit.
Das Gedicht ist in drei Strophen zu je vier Versen gegliedert. Es liegt zunächst ein unregelmäßiges Metrum vor, welches im dritten Vers von einem dreihebigen Jambus sowie betonte und unbetonte Kadenzen. Das Reimschema lässt sich durch unterbrochene Kreuzreime kennzeichnen.
Bereits der Titel des Gedichtes „Die blaue Blume“ greift das zentrale Symbol des Textes auf. Die Blume steht insbesondere durch die Farbsymbolik in Form der Farbe „blau[…]“ (V. 1) als Metapher für die Unendlichkeit oder in diesem Fall das geheimnisvolle Unerreichbare. Bereits im ersten Vers des Gedichtes heißt es „Ich suche die blaue Blume“ (V. 1). Der Umstand, dass der Vers mit dem Personalpronomen „Ich“ (V. 1) beginnt, veranschaulicht eine Betonung in Bezug auf die Person des lyrischen Ichs. Die vorangehenden Epochen waren von einem sogenannten Ich-Verlust gekennzeichnet, welcher jedoch in der Romantik umgekehrt wurde und somit ein charakteristisches Merkmal dieser Epoche darstellt. Die Tatsache, dass das lyrische Ich nach der blauen Blume sucht (vgl. V. 1), verdeutlicht, dass es sich nach dem Unerreichbaren sehnt. Dieses wird jedoch nicht genauer definiert und verbirgt sich hinter dem Mysterium der „blaue[n] Blume“ (V. 1). Die Anapher des Ausdrucks „Ich suche“ (V. 2) im folgenden Vers veranschaulicht durch die Wiederholung die Sehnsucht des lyrischen Ichs nach diesem Mysterium. Allerdings ergänzt es im Bezug dazu die Feststellung „und finde sie nie“ (V. 2). Diese Feststellung deutet darauf hin, dass das lyrische Ich sich durchaus bewusst ist, dass es das Geheimnis nie lüften wird, jedoch sehnt es sich dennoch danach. Am Ende der ersten Strophe erwähnt es „Mir träumt, dass in der Blume / Mein gutes Glück mir blüh“ (V. 3 f.). Das lyrische Ich hat im Traum eine Möglichkeit gefunden dem Geheimnis näher zu kommen, was die Sehnsucht nach der Vollkommenheit, die es seiner Ansicht nach durch die Lösung erfahren würde, verstärkt. Der Traum ist ebenfalls ein spezifisches Merkmal der Literaturepoche der Romantik. Viele Autoren fanden im Traum die Zuflucht, die ihnen in der Realität verwehrt war, weshalb der Traum als Motiv in vielen Gedichten zu finden ist. In diesem Fall kommt das lyrische Ich in seinen Träumen seiner Sehnsucht ein Stück näher. Auffällig ist ebenso der Pleonasmus „gutes Glück“ (V. 4) im letzten Vers der Strophe, der zugleich eine Alliteration darstellt. Das „gute[…] Glück“ (ebd.) verdeutlicht die Vollkommenheit, die das lyrische Ich vermutet mit der Lösung des Geheimnisses zu finden. Durch die Alliteration ist der Ausdruck, der für die Interpretation des Gedichtes von Bedeutung ist, leicht einprägsam, ebenso wie der Titel „blaue Blume“, welcher ebenfalls eine Alliteration ist.
Die zweite Strophe setzt ebenfalls mit dem Personalpronomen „Ich“ (V. 5) ein und legt erneut den Fokus auf die Person des lyrischen Ichs, welches die einzige handelnde Person im gesamten Gedicht darstellt. Die Strophe setzt ein mit der Beschreibung „Ich wandre mit meiner Harfe“ (V. 5). Das Verb „wand[ern]“ (ebd.) steht in Verbindung zu der in der ersten Strophe beschriebenen Suche. Der Umstand, dass das lyrische Ich mit seiner „Harfe“ (ebd.) auf die Suche geht demonstriert ein weiteres Merkmal der Epoche. Die Musik, hier dargestellt durch die „Harfe“ (V. 5), ist gleicherweise ein für die Romantik typisches Motiv, das einen Fluchtort für die Autoren repräsentiert. Die Aufzählung „Durch Länder, Städt und Au’n“ (V. 6) im folgenden Vers visualisiert insbesondere durch den Antiklimax die Sehnsucht von der das lyrische Ich getrieben wird, obwohl es sich bewusst ist, dass es das Geheimnis nie aufdecken wird. Dies wird im Folgenden erneut durch die Verwendung der Metapher der blauen Blume deutlich gemacht. Am Ende der Strophe wird hervorgebracht, dass es dem lyrischen Ich nicht Möglich ist „nirgends in der Runde / die Blum zu schaun“ (V. 7 f.). Das Adverb „nirgends“ (ebd.) greift die Aufzählung im vorangehenden Vers erneut auf und verstärkt die Bedeutung dessen. Das lyrische Ich ist sich, wie bereits in der ersten Strophe erwähnt, bewusst, dass es das Geheimnis nie aufdecken wird.
Mit dem Beginn der dritten Strophe erfolgt ein Umbruch in der Stimmung des lyrischen Ichs. Zuvor war es sich zwar bewusst, dass es das Geheimnis und somit die Vollkommenheit nie erreichen kann, doch es strebte dennoch danach. In der dritten Strophe wirkt der Gemütszustand des lyrischen Ichs resignativ.
Abschrift 2. Klausur
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Meine Zeit“, verfasst von Wilhelm Klemm und veröffentlicht im Jahr 1916 in der Gedichtsammlung „Verse und Bilder“, handelt es sich um ein Gedicht aus der Literaturepoche des Expressionismus. Thematisiert wird die apokalyptische Stimmung während des Ersten Weltkriegs.
Das Gedicht umfasst 14 Verse und ist in vier Strophen gegliedert, die in Form eines Sonetts (zwei Quartette, zwei Terzette) vorliegen. Es liegt durchgehend ein fünfhebiger Jambus vor.
Bereits der Titel des Gedichts „Meine Zeit“ deutet auf eine Beschreibung der vorliegenden Verhältnisse während der Entstehungszeit des Gedichtes hin. Das Gedicht wurde 1916 veröffentlicht, was nahelegt, dass es in der Zeit des Ersten Weltkriegs (1914 – 1918) entstanden ist. Das zu analysierende Gedicht setzt ein mit der Aufzählung „Gesang und Riesenstädte, Traumlawinen, / Verblaßte Länder, Pole ohne Ruhm“ (V. 1 f.). Bereits im Beginn der Aufzählung „Gesang und Riesenstädte“ (V. 1) ist ein charakteristisches Merkmal des historischen Hintergrunds der Literaturepoche des Expressionismus zu finden. Die erwähnten „Riesenstädte“ (ebd.) sind durch den Prozess der Verstädterung entstanden, der insbesondere durch den Ersten Weltkrieg vorangetrieben wurde, da in den Städten Nahrungsmittel und Kleidung zu erhalten waren. Mit dem Substantiv „Gesang“ (V. 1) werden meistens Gefühle wie Freude assoziiert. In diesem Fall lässt sich diese Freude als Enthusiasmus für den Krieg auslegen. Somit stellt der Beginn der Aufzählung die Zeit vor dem Krieg dar, da die Menschen noch freudig gestimmt waren. Ergänzt wird dies durch den Neologismus „Traumlawinen“ (V. 1). Die Wortneuschöpfung setzt sich aus den Substantiven „Traum“ und „Lawinen“ zusammen. Der Neologismus ist geprägt von der Antithetik dieser begriffe. Mit dem Substantiv „Traum“ wird meist eine friedliche und vollkommene Welt in Verbindung gebracht, während der Begriff „Lawinen“ Gefahr und Zerstörung zum Ausdruck bringt. Neologismen sind insofern kennzeichnend für die Literaturepoche des Expressionismus, als dass die Menschen sich Wortneuschöpfungen bedienen mussten, da ihr vorhandener Wortschatz nicht ausreichte um Gefühle, Gedanken oder Eindrücke zum Ausdruck zu bringen. Der Neologismus „Traumlawinen“ (V. 1) beschreibt somit die Zerstörung der zu Beginn des Krieges begeisterten Stimmung. Im nächsten Vers heißt es „Verblaßte Länder, Pole ohne Ruhm“ (V. 2), was bereits die Folgen der kriegerischen Auseinandersetzung beschreibt. Das Adjektiv „[v]erblaßt[…]“ (ebd.) in Bezug auf die Länder verdeutlicht die durch den Krieg schwindende Bevölkerung. Die Metapher „Pole ohne Ruhm“ (V. 2) deutet darauf hin, dass die Menschen sich nicht mehr bewusst sind, was richtig oder falsch ist. Hinter dem Begriff „Pole“ (ebd.) können sich unterschiedliche Wahrnehmungen verbergen, beispielsweise der Nord- und der Südpol oder das positiv bzw. negativ geladene Ende eines Magneten. Allerdings wird immer ein Gegensatz verdeutlicht, der in diesem Fall mit der moralischen Frage im Krieg, was ist richtig und was ist falsch, in Verbindung gebracht werden kann, da während des Krieges die Grenzen zwischen Richtig und Falsch verschwimmen und es nur wenige gibt, die ihre moralischen Ansichten aufrecht halten. Der Zusatz „ohne Ruhm“ (V. 2) verdeutlicht allerdings, dass ihre Ansichten keine Beachtung finden. Im weiteren Verlauf wird beschrieben, „Die sündigen Weiber, Not und Heldentum“ (V. 3). Unter dem Begriff „sündige[…] Weiber“ (ebd.) sind Frauen zu verstehen, die während des Krieges ihre Männer verloren haben und nun ihren Körper verkaufen um sich Geld zum Überleben zu sichern. Der zweiter Teil des Verses „Not und Heldentum“ (V. 3) verdeutlicht den zwiegespaltenen Alltag während des Krieges. Entweder die Soldaten oder die Bevölkerung sind in Not oder sie werden als Helden gefeiert. Das Quartett endet mit dem Vers „Gespensterbrauen, Sturm auf Eisenschienen“ (V. 4). Der Neologismus „Gespensterbrauen“ (ebd.) verdeutlicht insbesondere durch das Substantiv „Gespenst“ die apokalyptische Stimmung, die während des Krieges die Bevölkerung ergreift. Die Metapher „Sturm auf Eisenschienen“ (V. 4) macht insbesondere auf die Gefahr des Krieges, aber auch auf die Vergänglichkeit aufmerksam, da beides mit „Sturm“ (ebd.) assoziiert wird. Die Eisenbahnschienen stehen metaphorisch für die Eisenbahn, da diese das Haupttransportmittel zu dieser Zeit war und die Soldaten zur Front brachte. Allgemein ähnelt bereits die Gesamtform des Gedichtes dem Stil des Barock, was durch die Mittelzäsur, dem regelmäßigen Rhythmus, die Antithetik, das Reimschema (umarmender Reim) und de an das Reimschema angepassten Kadenzen deutlich gemacht wird. Die Mittelzäsur, die formal durch die Kommas hervorgehoben wird, unterstützt die Aufzählungen und macht die Antithetik, die in vielen Ausdrücken zu finden ist, deutlich.
Das zweite Quartett setzt ein mit der Aussage „In Wolkenfernen trommeln die Propeller“ (V. 5). Gemeint sind mit der Bezeichnung „Propeller“ (ebd.) die Kriegsflugzeuge, durch die meist Gefahr drohte. Untermauert wird dies ebenso durch das Verb „trommeln“ (V. 5) in Beug auf die Propeller. Insgesamt greift der Einstieg in das zweite Quartett die apokalyptische Stimmung vom Ende des ersten Quartettes wieder auf. Verdeutlicht wird dies ebenso durch den Ausdruck „Völker zerfließen“ (V. 6), der dazu benötigt wird, die Flucht der Menschen auf Grund des Krieges darzustellen. Weiterhin wird beschrieben „Bücher werden Hexen“ (V. 6), was eine Anspielung auf die Hexenverfolgung darstellt. Die „Bücher“ (ebd.) stehen metaphorisch für gebildete Menschen, die das Ausmaß des Krieges erkennen und versuchen ihre Sichtweise zu verbreiten. Allerdings werden sie dafür verfolgt. Es heißt weiterhin „Die Seele schrumpft zu winzigen Komplexen“ (V. 7), was eine Verbindung zum vorherigen Vers darstellt, da die gebildeten Menschen verfolgt werden und sich nicht mehr frei entfalten können. As lyrische Ich geht sogar so weit, dass es behauptet „Tot ist die Kunst“ (V. 8) als Metapher für die gebildeten Menschen, die verfolgt werden, weil sie an ihrer kritischen Haltung gegenüber dem Krieg festhalten. Das zweite Quartett endet mit der Aussage „Die Stunden kreisen schneller“ (V. 8), welche die Vergänglichkeit in Bezug auf den Krieg ausdrückt. Im zweiten Quartett wird die Form, die im ersten Quartett der des Barocks sehr nahe kam, unterbrochen. Anstelle von Kommas wurden im zweiten im zweiten Quartett Punkte verwendet, die Endgültigkeit ausdrücken. Das Reimschema wurde beibehalten, genauso wie die Mittelzäsur, doch die Kadenzen sind alle unbetont und unterstützen somit die Interpunktion und die damit in Verbindung gebrachte Endgültigkeit.
Es erfolgt sowohl formal als auch inhaltlich ein Umbruch mit dem Anfang des ersten Terzettes. Das Terzett setzt ein mit der Klage „O meine Zeit“ (V. 9). Der Umstand, dass es sich um eine Klage handelt, ist am Laut „O“ (ebd.) und an der Interpunktion in Form eines Ausrufezeichens festzumachen. Weiterhin beschreibt das lyrische Ich die Zeit, in der es lebt, als „So namenlos zerrissen, / So ohne Stern, so daseinsarm im Wissen“ (V. 9 f.). Der Umstand, dass das lyrische Ich die Zeit als „namenlos zerrissen“ (ebd.) bezeichnet, verdeutlicht, dass es die Zeit als unbedeutsam und gespalten empfindet. Dies wird ebenso durch den Ausdruck „ohne Stern“ (V. 10) untermauert, der verdeutlicht, dass den Menschen ein Orientierungspunkt zu einem geordneten Leben fehlt. Das Trikolon wird beendet mit der Beschreibung „daseinsarm im Wissen“ (V. 10). Das Terzett endet mit dem Vergleich „Wie du, will keine, keine mir erscheinen“ (V. 11). Die Wiederholung der Bezeichnung „keine“ (ebd.) veranschaulicht das Ausmaß, in dem das lyrische Ich spricht. Der Vergleich, der sich auf die Anapher „So“ (V. 9; V. 10) stützt, endet mit einem Punkt, der erneut die Endgültigkeit des Gesagten darstellt.
Das zweite Terzett setzt ein mit der Aussage „Noch hob ihr Haupt so hoch niemals die Sphinx“ (V. 12). Die Sphinx wurde in der griechischen Mythologie als Dämon des Unheils und der Zerstörung betrachtet. Somit passt deren Erwähnung in das Bild, das durch die apokalyptische Stimmung hervorgerufen wird. Der Umstand, dass diese ihr Haupt noch niemals so hoch hob (vgl. V. 12), veranschaulicht metaphorisch, dass es noch nie zuvor so viel Zerstörung gegeben hat. Im nächsten Vers spricht das lyrische Ich die Zeit in der es lebt, mit dem Personalpronomen „Du“ (V. 13) an und personalisiert diese somit. Das lyrische Ich beschreibt, die Zeit sieht „am Wege rechts und links / Furchtlos vor Qual des Wahnsinns Abgrund weinen“ (V. 13 f.). Mit dieser Metapher wird zum Ende des Gedichts erneut deutlich gemacht, von welcher Zerstörung und welchen Qualen die Zeit geprägt ist und deutet auch noch einmal auf die apokalyptische Stimmung hin, die im gesamten Gedicht zu finden ist. Die beiden Terzette sind formal wieder im Stil des Barock verfasst. Allgemein lässt sich die Verwendung der formalen Charakteristika aus der Epoche des Barock so deuten, dass das lyrische Ich sich nach der Zeit vor dem Krieg, in der Ordnung herrschte, zurücksehnt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das lyrische Ich die Verhältnisse in der Zeit des Ersten Weltkriegs beschreibt und besonders die Situation der Menschen mit kritischer Haltung gegenüber dem Krieg hervorhebt. Dies wird besonders durch die verwendeten formalen Charakteristika aus der Literaturepoche des Barock (Sonett, Reimschema, Kadenzen), aber auch durch die Interpunktion hervorgehoben.
Aufgabe 2:
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Schluss des 1648sten Jahres“, verfasst von Andreas Gryphius und veröffentlicht im Jahr 1698 von Gryphius‘ Sohn, handelt es sich um ein Gedicht aus der Literaturepoche des Barock. Thematisiert wird das Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648.
Das vorliegende Gedicht soll im Folgenden analysiert und mit dem expressionistischen Gedicht „Meine Zeit“, verfasst von Wilhelm Klemm und veröffentlicht im Jahr 1916, verglichen werden.
Das vorliegende Gedicht umfasst 14 Verse und ist ebenso wie Klemms Gedicht in der Form eines Sonetts gegliedert.
Der zu analysierende Text setzt ein mit dem Ausruf „Zeuch hin, betrübtes Jahr!“ (V. 1). Im Jahr 1648 endete der Dreißigjährige Krieg und somit die Jahre der Angst und Zerstörung, was ebenso durch die Ausrufe „Zeuch hin mit meinen Schmerzen!“ (V. 1) und „Zeuch hin mit meiner Angst und überhäuften Weh!“ (V. 2) deutlcih wird. Die Ausrufe, die alle mit der Anapher „Zeuch hin“ (V. 1; V. 2) beginnen, sind Ausdruck der Freude über das Ende des Krieges. Dieser Umstand steht im Kontrast zu Klemms Gedicht, da dieses von der Euphorie vor und der schweren Zeit während des Krieges handelt. Eine Aufzählung in Form einer Anapher ist bei Kleimm in der dritten Strophe des Gedichtes zu finden, doch diese thematisiert die Bedeutungslosigkeit und die Vergänglichkeit der Zeit während die hier vorliegende Metapher die Euphorie über das Ende des Krieges darstellt. Im zweiten Teil des Quartettes heißt es „Zeuch so viel Leichen nach! Bedrängte Zeit vergeh / Und führe mit dir weg die Last von diesem Herzen“ (V. 3 f.). Insgesamt ist das lyrische Ich froh über das Ende des Krieges und wünscht sich die Zeit und die Erlebnisse zu vergessen.
Das zweite Quartett setzt ein mit der Ansprache „Herr“ (V. 5). Mit „Herr“ (ebd.) ist in diesem Fall Gott gemeint, zu dem das lyrische Ich spricht. Dieser Umstand ist ein weiterer Kontrast zu Klemms Gedicht, da dort keine religiösen Ansichten zu erkennen sind. Das lyrische Ich erläutert weiterhin, dass es der Ansicht ist, dass das Jahr 1648 vor Gott „als ein Geschwätz und Scherzen“ (V. 5) wirkt und spricht somit die Bedeutungslosigkeit dieses Jahres für Gott aus. Die Bedeutungslosigkeit der Zeit ist auch ein Motiv für Klemms Gedicht, beispielsweise wenn es heißt „Die Stunden reisen schneller“ (Meine Zeit, V. 8), was die Vergänglichkeit und Nichtigkeit er Zeit untermauert. Durch die rhetorische Frage „ Fällt meine Zeit nicht hin wie ein verschmelzter Schnee?“ (V. 6) wird allerdings deutlich, auf welche Zeit das lyrische Ich hindeutet. Während das lyrische Ich in Klemms Gedicht von der Zeit, in der das lyrische Ich lebt, spricht, spricht das lyrische Ich in Gryphius‘ Text von der eigenen Lebzeit. Mit der rhetorischen Frage und der Metapher „verschmelzter Schnee“ (V. 6)deutet das lyrische Ich auf die Vergänglichkeit seiner eigenen Lebzeit hin. Die rhetorische Frage und die Metapher werden im weiteren Verlauf der Strophe erneut aufgegriffen, wenn das lyrische Ich Gott bittet, „Laß doch, weil mir die Sonn gleich in der Mittagshöh, / Mich noch nicht untergehn gleich ausgebrenten Kerzen“ (V. 7 f.). Das lyrische Ich bezeichnet sich selbst und somit seine Lebzeit als „verschmelzter Schnee“ (V. 6). Es ergänzt in seiner Bitte, dass die Sonne gleich in der Mittagshöhe steht (vgl. V. 6), also die Stelle, an der sie am hellsten und wärmsten scheint, was Schnee in der Regel schneller schmelzen lässt. Zusammengefasst deutet das lyrische Ich somit auf das Ende seiner Lebzeit in Form des Todes hin. Der Tod wird hier metaphorisch als „ausgebrennte[…] Kerze[…]“ (V. 8) bezeichnet. Der Umstand, dass die Bitte eindringlich ist, ist an dem Ausrufezeichen am Versende zu erkennen. Auf formaler Ebene fällt im zweiten Quartett auf, dass das Reimschema unterbrochen wurde. Wie es bei einem umarmenden Reim üblich ist reinem sich der erste und vierte Endreim, jedoch reimen sich der zweite und dritte Endreim nicht, was den inhaltlichen Umbruch von Euphorie zu Todesstimmung formal untermauert.
Das erste Terzett knüpft unmittelbar an die Bitte vom vorherigen Quartett an und wird ebenso durch die Ansprache „Herr“ (V. 9) eingeleitet. Anschließend heißt es „es ist genung geschlagen“ (V. 9). Diese Aussage ist in Bezug zum vergangenen Krieg zu stellen, da das lyrische Ich die Schlachten und die Zerstörung erlebt und überlebt hat. Ergänzt wird dies durch den folgenden Vers „Angst und Ach genung getragen“ (V. 10), welcher verdeutlicht, dass das lyrische Ich in den vergangenen Jahren unter den Folgen des Krieges gelitten hat. Das Leid, das durch den Krieg entstanden ist, wird auch bei Klemm thematisiert. Insbesondere durch die Aussage „In Wolkenfernen trommeln die Propeller“ (Meine Zeit, V. 5) wird dargestellt, welcher Angst und welcher Gefahr die Bevölkerung ausgesetzt war. Das Terzett endet mit der Bitte des lyrischen Ichs an Gott „Gib doch nun etwas Frist, daß ich mich recht bedenke“ (V. 11). Der Umstand, dass das lyrische Ich über seine Person nachdenken will, ist dem Krieg geschuldet, da in dieser Zeit selten Ruhe zum Nachdenken einkehrte.
Das zweite Quartett ist mit dem ersten durch den Parallelismus „Gib, daß ich“ (V. 12) verbunden. Die Aussage wird fortgeführt mit „der Handvoll Jahre / Froh wird eins vor meiner Bahre“ (V. 12 f.). Das lyrische Ich ist sich bewusst, dass es nicht mehr lange zu leben hat und bittet Gott um ein wenig mehr Zeit sich selbst kennenzulernen. Das Gedicht endet mit der Aussage „Mißgönne mir doch nicht dein liebliches Geschenk!“ (V. 14), was den Wunsch des lyrischen Ichs insbesondere durch die Verschwendung des Ausrufezeichens bestärkt.
Die Form des Gedichtes orientiert sich an den für die Literaturepoche des Barock strengen Regeln, mit zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme, wie bereits in der Analyse erwähnt, ist die Unterbrechung des Reimschemas, und zum anderen die Verse 9, 10, 12 und 13, die nicht mit dem regelmäßigen Schriftbild übereinstimmen und somit auch nicht den Alexandriner aus den Quartetten fortsetzen, sondern durch vierhebige Jamben gekennzeichnet werden.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das lyrische Ich dem Ende des Krieges gegenüber euphorisch gestimmt ist, es sich allerdings darüber bewusst ist, dass es nur noch wenig Zeit zum Leben hat und daher Gott bittet ihm noch ein wenig zu überlassen, um sich selbst kennenzulernen. Formal wird dies besonders durch die Interpunktion hervorgehoben und die sprachlichen Mittel, wie beispielsweise die Anapher oder der Parallelismus, der die Terzette verbindet.
Beide Gedichte gleichen sich in Form und Thematik, wobei die Ausgangssituationen unterschiedlich sin. In Klemms Gedicht werden die Folgen, die Ängste und die apokalyptische Sttimmung während des Ersten Weltkrieges dargestellt und die Vergänglichkeit der Zeit für das einzelne Individuum hervorgehoben, während in Gryphius‘ Gedicht das Ende des Dreißigjährigen Krieges und die dadurch für das Individuum verlorene Zeit beschrieben wird.
Goethe: Rastlose Liebe vs. Rilke: Einsamkeit
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Rastlose Liebe“ handelt es sich um ein Gedicht, verfasst von Johann Wolfgang von Goethe und veröffentlicht im Jahr 1776 in der Literaturepoche des Sturm und Drang zum Thema Liebe.
Das Gedicht umfasst drei Strophen. Die erste und die dritte Strophe zählen sechs Verse, während die zweite Strophe durch acht Verse gekennzeichnet wird. Wie auch die Anzahl der Verse variiert das Reimschema strophenabhängig. In der ersten und in der dritten Strophe sind Paarreime zu erkennen. Als Reimschema in der zweiten Strophe liegen überwiegend Kreuzreime vor. Weiterhin ist ebenfalls kein eindeutiges Metrum zu erkennen.
Bereits der Titel des Gedichtes „Rastlose Liebe“ (T) lässt insofern auf den Inhalt vorausdeuten, als dass das Lyrische Ich versucht die Liebe oder eine geliebte Person zu finden, somit stellt die Liebe ein zentrales Element in der Handlung des Gedichts dar.
Das zu analysierende Gedicht setzt ein mit der Aufzählung „Dem Schnee, dem Regen, / dem Wind entgegen“ (V. 1 f.) und knüpft somit unmittelbar an die Vorausdeutung im Titel an. Diese Aufzählung ist in Form einer Antiklimax angeordnet und deutet auf einen Wiederstand hin, den das Lyrische Ich versucht zu überwinden. Untermauert wird dies ebenso durch die folgenden Verse „im Dampf der Klüfte, / durch Nebeldüfte“ (V. 3 f.). Die verwendeten Substantive stammen aus dem Wortfeld der Natur, allerdings aus der Richtung erschwerter Witterungsverhältnisse, die darauf hindeuten dass der Weg des Lyrischen Ichs zur Liebe eher erschwert ist und es zahlreichen Kämpfen ausgesetzt ist. Untermauert wird dies weiterhin durch die Ausrufe „immer zu! Immer zu! / Ohne Rast und Ruh!“ (V. 5 f.). Die Repetitio der Klage „Immer zu!“ (ebd.) veranschaulicht die Ruhelosigkeit die das Lyrische Ich erleidet. Intensiviert wird dies weiterhin durch den Ausdruck „Ohne Rast und Ruh“ (V. 6), der zugleich eine Alliteration ist und insbesondere durch das Substantiv „Rast“ (ebd.) wird eine Verbindung zum Titel hergestellt.