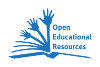Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Benutzer:CBontjer: Unterschied zwischen den Versionen
(→Lyrik) |
|||
| (20 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==Faust == | |
| − | Die Tragödie | + | === Inhaltsangabe === |
| + | |||
| + | Die Tragödie beginnt damit, dass Gott und Mephistopheles eine Wette abschließen. In dieser Wette geht es darum, ob Mephistopheles es schafft Faust vom richtigen Weg abzubringen. Faust leidet an Wissensdurst und ist unzufrieden, da er auf die Frage nach dem Sinn des Lebens keine Antwort findet. Er beschließt sich umzubringen, wird jedoch durch das läuten der Osterglocken daran gehindert. Nach einem Spaziergang am nächsten Tag folgt ihm ein Hund nach Hause. Der Hund verwandelt sich in Mephistopheles. Er schließt mit Faust einen Deal ab in dem er Faust anbietet ihm zu dienen und im Gegenzug seine Seele erhält, wenn er es schafft ihn glücklich zu machen. Später sind sie in einer Hexenküche, wo Faust einen Trank zur Verjüngung trinkt. Danach sieht Faust zum ersten Mal Gretchen und spricht sie an, wird dann aber abgewiesen. Jetzt soll Mephistopheles Gretchens als Fausts Geliebte besorgen. Sie besuchen Gretchens Haus und lassen ihr Schmuckkästchen als Geschenk da. Um die Nachbarin Marthe abzulenken soll sich Mephistopheles ihr annähern. Er erzählt ihr, dass ihr Mann tot sei und sie findet schließlich Gefallen an ihm. Faust und Gretchen haben nun die Gelegenheit sich zu treffen und dort kommt es auch zu ihrem ersten Kuss. Faust bittet Gretchen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie die Nacht miteinander verbringen können. Daraufhin stirbt die Mutter von dem Trank. Zwischen Faust und Gretchens Bruder Valentin kommt es zu einem Duell, da er erfahren hat, was zwischen den beiden in der Nacht lief. Faust tötet dabei Valentin und flieht. Gretchen geht zur Kirche, wo ihr ein Geist erscheint und ihr mitteilt, dass sie schwanger ist. Einige Zeit später erfährt Faust, dass Gretchen zu Tode verurteilt wurde. Er will sie retten, bricht dafür in den Kerker ein und versucht sie zu überzeugen mit ihm zu fliehen. Sie verneint dies aber, weil sie nicht noch mehr Ärger anrichten will. Zum Schluss wendet sie sich an Gott, der sie von ihren Sünden erlöst und Faust flieht mit Mephistopheles. | ||
| + | |||
| + | === "Nacht" VV. 353- 385 === | ||
| + | |||
| + | Die vorliegende Textstelle der Tragödie "Faust" von Johann Wolfgang Goethe, veröffentlicht im Jahr 1808, handelt von Faust, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist. | ||
| + | |||
| + | Faust, der sich sein Leben lang mit dem Studieren der Wissenschaften beschäftigt hat, kann sich nicht damit zufriedenstellen. In dem Monolog klagt er darüber, wie wenig er vom wirklich Wichtigem weiß. Aus dem Grund möchte er mit Hilfe der Geister herausfinden, was der Sinn des Lebens ist. | ||
| + | |||
| + | Nach den drei Prologen ist diese Textstelle die eigentlich Einleitung des Dramas. Sie stellt den Protagonisten, Faust, und seine Lage vor. Durch seine Unzufriedenheit kommt es dazu, dass er für Mephistopheles ein leichtes Opfer ist und seinem vorgeschlagenem Pakt, Mephistopheles seine Seele zu geben, wenn Mephistopheles es schafft ihn glücklich zu machen, zustimmt. Durch Mephistopheles nimmt Faust einen Trank zur Verjüngung zu sich und lernt Gretchen kennen. Nachdem Faust ihre Aufmerksamkeit nach dem ersten Versuch nicht bekommt, versucht er es weiter mit Geschenken. Gretchen hat Interesse an ihm und durch Mephistopheles kommt es zu einem Treffen. Das zweite Treffen findet nur durch eine List statt, bei der Gretchens Mutter ihr Leben verliert. Auch Gretchens Bruder stirbt bei einem Duell gegen Faust, da er erfahren hat, dass Gretchen schwanger ist. Nach einiger Zeit erfährt Faust dann, dass Gretchen wegen Mord an ihrem Kind im Gefängnis gelandet ist und er versucht sie daraufhin zu retten. Sie aber willigt nicht ein und überlässt sich somit dem Henker während Faust und Mephistopheles fliehen. | ||
| + | Am Anfang erkennt man als Reimschema einen Kreuzreim. Danach folgen ausschließlich Paarreime. Dies kann man am folgendem Beispiel festmachen: | ||
| + | |||
| + | „Habe nun, ach! Philosophie, A | ||
| + | |||
| + | Juristerei und Medizin, B | ||
| + | |||
| + | Und leider auch Theologie! A | ||
| + | |||
| + | Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. B | ||
| + | |||
| + | Da steh ich nun, ich armer Tor! C | ||
| + | |||
| + | Und bin so klug wie zuvor;“ (VV.354-356) C | ||
| + | |||
| + | Die Textstelle beginnt damit, dass Faust alle Wissenschaften aufzählt, die er studiert hat(vgl. VV.354-365). Die Synästhesie "heißes Bemühn" (V.375) zeigt dabei wie wichtig Faust dies war. Allerdings ist er nicht glücklich damit, da er der Meinung ist vom wirklich Wichtigem "nichts wissen [zu] können" (V.364). Seine Unzufriedenheit und Verzweiflung der Unwissenheit wird zum Beispiel durch die Ausrufe "Habe nun, ach!" (V.354), "Da stehe ich nun, ich armer Tor!" (V.357) zum Ausdruck gebracht. Er zweifelt an sich und bezeichnet sich selber als ein "Tor" (V.358), was so viel ist wie ein Narr oder ein nichts wissender Mensch. Er zweifelt auch am Sinn daran seinen Schülern etwas beizubringen, was für ihn keinen Wert hat. Er hat dabei das Gefühl seine Schüler anzulügen, was er durch die Metapher "an der Nase herum[führen]" (V.363) zum Ausdruck bringt. Das Wissen, "nichts wissen [zu] können" (V.364) löst bei ihm außerdem Wut aus. Die Metapher, "das Herz verbrennen" (V.365) steht in dem Zusammenhang für das Gefühl der Wut, da er trotz des Studiums nichts erreicht hat. Er selber hält sich für "gescheitert als alle Laffen, /Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen" (V.366f.), was über seine Person aussagt, dass er arrogant ist. Dann folgt die Anapher "bilde mir nicht ein was Rechts zu wissen" (V.371) und "bilde mir nicht ein ich könnte was lehren" (V.372), welche noch einmal seine Unzufriedenheit als Lehrer betont. Faust ist zwiegespalten, da er einerseits der Meinung ist intelligenter zu sein als manch Anderer, andererseits aber weiß, nicht alles wissen zu können und nichts wichtiges lehrt. Faust beschließt sich "der Magie [zu] ergeben" (V.377) und hofft auf eine Antwort auf die Frage "was die Welt / im Innersten zusammenhält" (V.382f.). Der letzte Satz drückt Fausts Wunsch aus endlich den Sinn des Lebens zu verstehen und nicht mit leeren Worten alles erklären zu müssen. | ||
| + | |||
| + | Die Textstelle verdeutlicht Fausts Zwiespalt und die damit verbundene Verzweiflung. Er ist einerseits der Meinung intelligent zu sein, aber andererseits kann er es nicht verarbeitet, dass er nur einen geringen, unwichtigen Teil des Lebens versteht und sonst rein gar nichts. Die Textstelle ist die Basis für die folgende Handlung. Es kommt zum Teufelspakt, dem Faust wegen seiner Unzufriedenheit mit seinem Leben zustimmt und die Handlung nimmt ihren Lauf. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === "Gretchens Stube"(VV.3374-3413) === | ||
| + | |||
| + | Die Tragödie "Faust" von Johann Wolfgang Goethe, veröffentlicht 1808, handelt von Faust, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist. | ||
| + | |||
| + | Die Textstelle VV. 3374-3413 handelt von Gretchen, die zu Hause ein Gedicht/Lied über ihr Sehnsucht nach Faust vorträgt. In dem Gedicht/Lied beschreibt sie, dass sie vor Faust ein normales Leben hatte und er es verändert hat. Ohne ihn fühlt sie sich einsam und ihre Gedanken und Gefühle spielen verrückt. Sie ist verzaubert von seiner Gestalt und sehnt sich nach ihm. | ||
| + | |||
| + | Dadurch, dass Faust durch seine Verzweiflung sich dazu entschied dem Teufelspakt zuzustimmen und sich als erste Maßnahme Verjüngern ließ, kam es zur ersten Begegnung zwischen Faust und Gretchen. Daraufhin folgten Geschenke an Gretchen und schließlich auch das erste Treffen zwischen den beiden. In dieser Textstelle wird sie sich Gefühlen zu Faust bewusst und gibt diesen nach. Dadurch vergiftet sie durch Fausts Einfluss ihre Mutter um mit ihm die Nacht in Ruhe verbringen zu können. Dabei wird sie ungewollt schwanger. Ihr Bruder, der ahnt, was geschehen ist, fordert Faust zum Duell heraus und wird dabei umgebracht. Faust flieht und erfährt nach einer Eingebung, was Gretchen widerfahren ist. Sie bekam ihr Kind, brachte es um und landete im Gefängnis, zum Tode verurteilt. Faust plant einen Rettungsversuch, der aber daran scheitert, dass Gretchen nicht noch mehr Schuld auf sich laden will und seinen Rettungsversuch ablehnt. Faust flieht und Gretchen stirbt. | ||
| + | |||
| + | Das Gedicht/Lied besteht aus 10 Strophen mit jeweils vier Versen. Davon wiederholt sich eine Strophe dreimal und bildet somit einen Refrain. Der Refrain handelt von Gretchens Leben bevor sie Faust kennengelernt hat und dass sie ein ruhiges Leben hatte (vgl. V. 3374). Als sie Faust kennengelernt hat, hat sich ihr Leben in sofern geändert, dass sie nun ihre Ruhe nicht mehr findet(vgl. V. 3375). Dies verdeutlicht auch der Klimax: "Ich finde sie nimmer/ und nimmermehr"(V. 3376 f.). Die zweite Strophe handelt davon, dass Gretchen sich einsam fühlt und das Gefühl hat, dass sie ohne ihn nicht Leben kann (vgl. V. 3379) und sie sich eine Welt ohne ihn nicht vorstellen kann (vgl. V. 3381 f.). Die dritte Strophe handelt davon, dass sie nicht klar denken kann und ihre Gefühle verrückt spielen. Die Anaphern "mein armer Kopf/mein armer Sinn" (vgl. V. 3382 u. V. 3384) und "ist mir verrückt/ist mir zerstückt" (vgl. V. 3383 u. V.3385) verdeutlichen, dass sie verliebt ist. Beiden Strophen thematisieren Gretchens Selbstbeschreibung. Danach folgt wieder der Refrain. Die fünfte Strophe beschreibt Gretchens Sehnsucht nach Faust und ihrer entstehende Abhängigkeit. Auch hier betont eine Anapher Gretchens Handeln, welches sich nur nach Faust richtet (vgl. V. 3390 u. V. 3392). Die darauf folgende Strophe handelt von der Beschreibung Fausts und wird auch hier mit Hilfen einer Anapher betont (vgl. V.3394-3397). Gretchen beschreibt Faust dabei als angesehen (vgl. V. 3395) und als edel (vgl. V. 3395). Außerdem fasziniert Gretchen "seines Mundes Lächeln" ( V. 3396) und "seiner Augen Gewalt" (V. 3397). Hierbei wird auch deutlich, dass Faust ihr gegenüber charmant ist, was sich durch sein Lächeln und die Beschreibung seiner Augen festmachen lässt. In der nächsten Strophe steigert sich die Beschreibung Fausts und Gretchen beschreibt, von seinen Worten verzaubert zu sein (vgl. V.3398). Sie schwärmt von seinen Berührungen, was an dem Ausruf " Und ach sein Kuss"(V. 3401) festzumachen ist. Nun folgt die zweite Wiederholung des Refrains. Durch die Wiederholungen wird Gretchens Verzweiflung deutlich gemacht. Sie stehen im Kontrast zu den Strophen, welche beschreiben, dass sie sich sehr nach Faust sehnt. Der Refrain beschreibt aber die Veränderung in ihrem Leben und dass sie auch gerne an ihrer Vergangenheit festhalten will. Beides ist aber nicht möglich. Die letzten beiden Strophen beschreiben Gretchens Reaktion, dass sie alles machen möchte, was eine Geliebte machen würde. Hier macht der Ausruf "Ach dürft ich fassen/und halten ihn!"(V. 3408f.) ihre Sehnsucht nach seiner Nähe deutlich. | ||
| + | |||
| + | Das Lied/Gedicht handelt hauptsächlich von Gretchens Einsamkeit und Sehnsucht nach Faust. Einsamkeit und Sehnsucht waren Merkmale der Romantik, einer Epoche, in der die Tragödie unter Anderem verfasst wurde. Zusammenfassend kann man sagen, dass in dieser Textstelle Gretchens Liebe zu Faust deutlich wird und sie bereit ist alles für ihn zu tun. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Abschrift der 1. Klausur === | ||
| + | |||
| + | Die Tragödie „Faust 1, erster Teil“ von Johann Wolfgang Goethe, veröffentlicht 1808 und geschrieben in den Epochen Sturm und Drang und Klassik, thematisiert die Suche nach dem Sinn des Lebens. | ||
Der vorliegende Textauszug „Wald und Höhle“ handelt von Fausts Monolog, in dem er sich seiner Unsicherheit gegenüber seinem derzeitigen Leben bewusst wird und mögliche Gefahren erkennt. | Der vorliegende Textauszug „Wald und Höhle“ handelt von Fausts Monolog, in dem er sich seiner Unsicherheit gegenüber seinem derzeitigen Leben bewusst wird und mögliche Gefahren erkennt. | ||
| − | Zuvor litt Faust an Wissensdurst, wodurch er beschloss sich umzubringen. Nach einem Spaziergang folgt Mephistopheles, der Teufel, Faust nach Hause und bietet ihm einen Pakt an, ihm zu dienen und ihm zu seinem Lebensglück zu verhelfen. Faust soll ihm im Gegenzug seine Seele versprechen. Faust willigt schließlich ein. Nach einer Verjüngung trifft Faust auf Gretchen und beauftragt Mephistopheles, sie als seine Geliebten zu gewinnen. Somit kommt es auch zu ihrem ersten Treffen. Nach der Szene „Wald und Höhle“ kommt es dazu, Faust Gretchen dazu bringt | + | Zuvor litt Faust an Wissensdurst, wodurch er beschloss sich umzubringen. Nach einem Spaziergang folgt Mephistopheles, der Teufel, Faust nach Hause und bietet ihm einen Pakt an, ihm zu dienen und ihm zu seinem Lebensglück zu verhelfen. Faust soll ihm im Gegenzug seine Seele versprechen. Faust willigt schließlich ein. Nach einer Verjüngung trifft Faust auf Gretchen und beauftragt Mephistopheles, sie als seine Geliebten zu gewinnen. Somit kommt es auch zu ihrem ersten Treffen. Nach der Szene „Wald und Höhle“ kommt es dazu, dass Faust Gretchen dazu bringt ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit er und Gretchen miteinander schlafen können. Die Mutter stirbt und Gretchen wird ungewollt schwanger. Nachdem Faust Valentin, Gretchens Bruder, in einem Duell getötet hat, muss er fliehen. Nach einiger Zeit erfährt er, dass Gretchen ihr Kind umgebracht hat und somit im Gefängnis gelandet ist. Faust plant mit Mephistopheles einen Rettungsversuch, dem Gretchen aber nicht zustimmt. Am Ende flieht Faust mit Mephistopheles und Gretchen überlässt sich dem Tod. |
| − | Der Textauszug ist ein Monolog Fausts und spielt im Wald und in einer Höhle. Er besteht aus 36 Versen; VV. 1-24 handeln von Fausts | + | Der Textauszug ist ein Monolog Fausts und spielt im Wald und in einer Höhle. Er besteht aus 36 Versen; VV. 1-24 handeln von Fausts Unsicherheit da er nicht weiß, wie er mit dem neu kennengelernten schönem Leben umgehen soll. Die Verse VV. 26-36 handeln von der Erkenntnis, dass die vermeintlichen Vorteile des Lebens eine Gefahr für ihn darstellen. Es gibt kein Reimschema und das Versmaß stellt einen 5-hebigen Jambus dar, der die Harmonie ausdrückt. Faust leitet den Monolog damit ein, indem er den „erhabne[n] Geist“ (V.1) anspricht, welcher eine übernatürliche Macht, einen Gott, darstellt. Er spricht davon, dass er ihm alles gab worum er bat(vgl. V. 1 f.). Er scheint zufrieden mit diesem Leben zu sein, dennoch erkennt er darin auch, dass dies nicht ausschließlich Vorteile hat (vgl. VV.2f.). Betont wird diese Aussage unter Verwendung eines Enjambements (vgl. VV. 1-3). Die Metapher „Natur“ (V.5) wurde verwendet um das Leben, die Liebe und alles, was Faust sich ersehnt, zu beschreiben. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er „[die] Kraft, sie zu fühlen, zu genießen“ (V.6). Er empfindet das Leben nicht als „kalt“ (V.7), er betrachtet es wie einen Freund (vgl. V. 9). Dann kommt es zu einem Wendepunkt. Durch Wörter des Wortfeldes „Natur“ (vgl. VV.13-16) werden die Nachteile des vermeintlich positiven Lebens beschrieben. Dieser Gegensatz, zwischen dem zuvor und danach beschriebenen Empfinden des Lebens, zeigt Fausts Unsicherheit und die Zerrissenheit sich einer Seite hinzugeben. Betont wird dieses Empfinden durch die Verben „stürzend“ (V.14), „quetschend“ (V.15) und „donnernd“ (V.16), die Faust als bedrückt und besorgt beschreiben. Er erkennt somit die Gefahren, die ihm bevorstehen, wenn er sich an die Menschen bindet, die er liebt (vgl. VV.10-12). Er kommt schließlich zu dem Entschluss, dass es in seiner „Höhle“ (V.17), welche für sein Studierzimmer bzw. sein bisher geführtes Leben steht, am sichersten ist (vgl. V.17). Er erkennt den Unterschied, er erkennt sich selbst (vgl. V.18), sein eigenes Leben und dass das Leben „geheime tiefe Wunder“ (V.19) bietet, die für Faust neu sind. Faust, der sich in Gretchen verliebt hat, zweifelt daran, dass etwas daraus wird, weil ihm auch der Pakt mit Mephistopheles im Weg steht. So kommt er zu dem allgemeinen Entschluss, „dass dem Menschen nichts Vollkommnes wird“ (V.26). Dass er den „Göttern nah und näher“ (V.28) gebracht wurde und er sich verliebt hat (vgl. VV.29 f.), ist also nur ein Schein, welcher vergänglich sein wird. Faust erkennt, dass Mephistopheles dafür gesorgt hat, dass er glücklich wird und Gefallen am Leben findet (vgl. V. 33), davon aber nichts echt sein kann. Würde er auf diese List hereinfallen, würde er durch seinen Willen in einen Genuss verfallen, aus dem er auch nicht mehr herausfindet, da Genuss zu noch mehr Begierde führt (vgl. VV. 35 f.). Dadurch könnte er die Wette mit dem Teufel verlieren. Dies ist Faust bewusst, dennoch taumelt (vgl. V.35) er, was seine Unentschlossenheit zum Ausdruck bringt und dass die neue Seite in seinem Leben das Interesse in ihm geweckt hat und somit eine verlockende Gefahr darstellt. Man findet im gesamten Textauszug immer wieder Motive des Wortfeldes „Natur“. Über Faust kann man somit sagen, dass er ein zur Natur hingezogener Mensch ist, was man damit belegen kann, dass er über die Fragestellung, ob sein derzeitiges Leben vollkommen ist, im Wald nachdenkt. Außerdem beschreibt er die Nachteile seines derzeitigen Lebens als eine Riesenfichte, die stürzt und alle Nachbaräste mitreißt (vgl. V.14), was man so deuten kann, dass der Pakt mit dem Teufel Opfer bringt. |
Zusammenfassend kann man über den Textauszug sagen, dass hier der Genuss des Lebens eine Gefahr für Faust darstellt und ihm das bewusst wird. Einerseits genießt er es glücklich zu sein, da er Gretchen gefunden hat, die er liebt. Andererseits weiß er aber, dass er Gretchen ohne die Hilfe von Mephistopheles nie kennengelernt hätte und das Zusammentreffen der beiden nur zu seinem Plan gehört um die Wette zu gewinnen. Deutlich werden hier innere Vorgänge eines Menschen, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist. | Zusammenfassend kann man über den Textauszug sagen, dass hier der Genuss des Lebens eine Gefahr für Faust darstellt und ihm das bewusst wird. Einerseits genießt er es glücklich zu sein, da er Gretchen gefunden hat, die er liebt. Andererseits weiß er aber, dass er Gretchen ohne die Hilfe von Mephistopheles nie kennengelernt hätte und das Zusammentreffen der beiden nur zu seinem Plan gehört um die Wette zu gewinnen. Deutlich werden hier innere Vorgänge eines Menschen, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist. | ||
| Zeile 13: | Zeile 58: | ||
'''Feedback:''' | '''Feedback:''' | ||
Ich finde, die Abschrift deiner Analyse ist dir gut gelungen. Du hast alle nötigen Aspekte genannt. Vielleicht kannst du das nächste Mal darauf achten, dass du nicht mehr so viele indirekte Zitate verwendest, sondern mehr direkte. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass du dich meiner Meinung nach zu wenig mit dem Inhalt beschäftigt hast, du hast zwar gut analysiert jedoch nennst du nicht dass Faust zum Erdgeist spricht, sondern vergleichst alles mit seiner Liebe zu Gretchen und beziehst dich sehr oft darauf. | Ich finde, die Abschrift deiner Analyse ist dir gut gelungen. Du hast alle nötigen Aspekte genannt. Vielleicht kannst du das nächste Mal darauf achten, dass du nicht mehr so viele indirekte Zitate verwendest, sondern mehr direkte. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass du dich meiner Meinung nach zu wenig mit dem Inhalt beschäftigt hast, du hast zwar gut analysiert jedoch nennst du nicht dass Faust zum Erdgeist spricht, sondern vergleichst alles mit seiner Liebe zu Gretchen und beziehst dich sehr oft darauf. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Woyzeck == | ||
| + | |||
| + | === Inhaltsangabe === | ||
| + | |||
| + | Das Drama „Woyzeck“ wurde von Georg Büchner geschrieben und im Jahr 1879 veröffentlicht. Das Stück handelt von Woyzeck, der wegen Demütigung und Betrug seine Freundin umbringt. | ||
| + | |||
| + | Woyzeck ist ein armer Soldat, der zusammen mit seiner Freundin Marie ein uneheliches Kind hat. Er versucht mit allen Mittel, vor Allem durch die Verrichtung niedriger Arbeit, Geld zu verdienen und somit seine Familie zu ernähren. Immer wieder wird er bei seiner Arbeit gedemütigt. Trotz seiner Bemühungen für die Familie, betrügt Marie ihn mit dem Tambourmajorn. Woyzeck lässt sich darauf ein, einem Arzt als Versuchsobjekt zu dienen und erhofft sich mit dem verdienten Geld Marie an sich zu binden. Sie wiederrum führt weiterhin eine Affäre mit dem Tambourmajorn. Woyzeck wird durch die Versuche des Arztes und die Demütigung durch den Tambourmajorn physisch und psychisch immer schwächer. Aufgrund seiner Eifersucht beschließt Woyzeck Marie umzubringen. Er kauft sich ein Messer, lockt sie in den Wald und bringt sie um. Bei der Rückkehr ins Dorf wird er blutverschmiert entdeckt. Daraufhin ergreift er die Flucht und versenkt das Messer in einem Teich. Zum Schluss wird Maries Leiche entdeckt. | ||
| + | |||
| + | === "Der Hessische Landbote"-Sachtextanalyse === | ||
| + | |||
| + | Die Flugschrift „Der Hessische Landbote“, geschrieben von Georg Büchner und überarbeitet von Friedrich Ludwig Weidig, wurde im Jahr 1834 veröffentlicht. Thematisiert wird die Spanne zwischen der oberen und der unteren Gesellschaftsschicht. | ||
| + | |||
| + | Die Textstelle Z.70- Z.128 handelt von der Stellung des Volkes, Fürsten und Adligen im Großherzogtum Hessen, aber auch in ganz Deutschland, und die Forderung nach einer Revolution. Man kann die Textstelle in folgende fünf Sinnabschnitte gliedern: In Z.70- Z.77 bezieht Georg Büchner sich auf die zuvor genannte Statistik, in der die Abgaben des Volkes an das Großherzogtum veranschaulicht wurde. Er ruft dazu auf, sich anzusehen, was das Großherzogtum darunter versteht, eine Ordnung einzuhalten (vgl. Z.70- 72) und macht deutlich, dass „700000 Menschen […] dafür 6 Millionen [bezahlen] […], damit sie in Ordnung leben (Z.72- 75). Er beschreibt, dass das Großherzogtum die Bevölkerung zu „Ackergäulen und Pflugstieren“ (Z.74) macht, wodurch er deutlich macht, dass die Regierung die Bevölkerung ausnutzt und sie darunter sogar leiden muss (vgl. Z.76f.). Den Sinnabschnitt Z.78- Z.89 leitet er durch eine rhetorische Frage ein, wer für die Ordnung verantwortlich ist und dafür sorgt, dass diese eingehalten wird (vgl. Z.78- 80). Er beschreibt, dass die Großherzogliche Regierung von dem Großherzog und seinen obersten Beamten gebildet wird (vgl. Z.80- 82). Diese wiederum haben im Land diverse Vertreter, die dafür sorgen, dass die Ordnung eingehalten wird (.vgl. Z.83- 89). Danach beschreibt er in Z.90- Z. 99 die Stellung des Volkes im Vergleich zu der Regierung mit Hilfe einer Metapher: „Das Volk ist ihre Herde, sie sind seine Hirten“ (Z.89- 90). Dennoch ist damit nicht gemeint, dass die Regierung sich gut um das Volk kümmert, sondern, dass sie „Melker und Schinder“ (Z.89f.) sind, das Volk also für ihr eigenes Wohlergehen ausnutzt. Des weiteren verdeutlicht eine Aufzählung (vgl. Z.91- 94), dass die Fürsten und Adligen auf Kosten des Volkes lebt. Er betont, dass sie es sich erlauben zu herrschen und das Volk dazu zwingt sich ihnen zu untergeben (vgl. Z.94f.). Durch eine Hyperbel betont er, dass die Regierung „die Mühe [hat], [das Volk] zu regieren“ (Z. 97). Dazu erläutert er, dass man nicht vom Regieren reden kann: Sie lassen sich vom Volk versorgen und nehmen ihnen alle Menschen- und Bürgerrechte (vgl. Z. 98f.). Im vorletzten Sinnabschnitt, Z.100- Z.118, veranschaulicht Weidig, dass das Großherzogtum sagt, „diese Regierung sei von Gott“ (Z.101), dies aber nicht stimmt (vgl. Z.102). Er betont dies durch eine Metapher, dass das Gottesgnadentum vom „Vater der Lügen“ (Z.103) stammt. „Vater“ (ebd.) steht häufig für „Gott“. Der Anhang „der Lügen“ (ebd.), sagt aus, dass die Idee des Gottesgnadentums von Jemandem stammt, der nicht Gott ist. Weidig erklärt, dass das Großherzogtum „aus Verrat und Meineid [gegenüber dem Kaiser], und nicht aus der Wahl des Volkes, [...]die Gewalt der deutschen Fürsten hervorgegangen [ist]“ (Z.108- 111). Er sagt sogar, dass deswegen das Wesen und Tun der Regierung von Gott verflucht sei (vgl. Z.111f.). Weidig vergleicht die vorgegebene Weisheit und Gerechtigkeit eher mit Trug und Schinderei (vgl. Z.112f.), die die Missachtung der Menschen- und Bürgerrechte und das Elend der Bevölkerung begründet(vgl. Z.113- 115). Den letzten Sinnabschnitt, Z. 119- Z. 128, beginnt Weidig indem er den Zustand des damaligen Deutschlands, dessenKaiser die „freien Voreltern“ (Z.121) wählten, mit dem Zustand des derzeitigen Deutschlands, welches durch die Fürsten zerissen wurde (vgl. Z.120), also in einzelne Großherzogtümer aufgeteilt wurde, vergleicht. Des weiteren verdeutlicht er, dass es Hoffnung gibt und sagt, dass das Reich der Finsternis sich zum Ende neigt (vgl. Z.124f.) und „Deutschland, das jetzt die Fürsten schinden, […] als ein Freistaat mit einer vom Volk gewählten Obrigkeit wieder auferstehen [wird]“ (Z.126- 128). Mit der Metapher „Reich der Finsternis“(Z.124) betont Weidig die Herrschaft, die das Elend der Bevölkerung mit sich bringt. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend kann man sagen, dass Georg Büchner und Friedrich Ludwig Weidig einen Sturz des Großherzogtums fordern. Die Regierung und die Adligen leben auf Kosten der Bevölkerung, welche deswegen verarmt. Generell besitzt diese keinerlei Menschen- und Bürgerrechte und wird dazu gezwungen den Fürsten Treue zu schwören, obwohl diese eigentlich nicht dazu befugt sind dies zu fordern. Das Flugblatt ist ein Appell an die Bevölkerung für ihre Rechte zu kämpfen und das Herzogtum zu stürzen. | ||
| + | |||
| + | === Parallelen Woyzeck-Der Hessische Landbote === | ||
| + | |||
| + | Die Flugschrift „Der Hessische Landbote“ und das Drama „Woyzeck“ von Georg Büchner, die beide im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Revolution in Deutschland, verfasst wurden, weisen einige Parallelen auf. | ||
| + | |||
| + | Zum einen werden in der Flugschrift die Unterschiede der Gesellschaftsschichten, die obere Schicht bestehend aus Fürsten und Adligen und die untere Schicht bestehend aus Bauern und Handwerkern, kritisiert. Er spricht davon, dass die untere Schicht viel arbeiten müssen um sich gerade noch ernähren zu können. Die untere Schicht wurde von großer Armut geplagt. In dem Drama findet man dies wieder: Woyzeck verrichtet jegliche Arbeit um für seine Familie Geld zu verdienen. Dafür rasiert er unter Anderem den Hauptmann (vgl. Szene 5) und stellt sich als Versuchsobjekt für die Experimente eines Arztes zur Verfügung (vgl. Szene 8). In der fünften Szene macht sich der Hauptmann über Woyzeck lustig und in der sechsten Szene wird Marie für die Bedürfnisse des Tambourmajors ausgenutzt. Dies veranschaulicht, dass die obere Schicht sich im Vergleich zu der unteren Schicht als etwas Hochwertigeres und etwas Besseres hielt. In Büchners Flugschrift verdeutlicht er dies so, dass die Bauern und Handwerker am fünften und die Fürsten und Adligen am sechsten Tag von Gott erschaffen wurden. | ||
| + | |||
| + | Man erkennt, dass Woyzeck, der mit allen Mitteln versucht Geld zu verdienen, und Marie in dem Drama, die Bauern und Handwerker in Büchners Flugschrift darstellen sollen. Diese leben in Armut und unter Arbeitslast, so wie es zur Zeit der Revolution der Fall war. Zudem sind der Hauptmann, der Arzt und der Tambourmajor Repräsentanten für die Fürsten und Adligen, die sich gesellschaftlich über die Bauern und Handwerker einordneten und auch nicht unter Armut leiden mussten. | ||
| + | |||
| + | === "Brief Büchners an die Eltern"-Sachtextanalyse === | ||
| + | |||
| + | Der Brief „Brief Büchners an die Eltern“ von Georg Büchner, veröffentlicht am 5.April 1833 in Straßburg, zur Zeit des Vormärz, thematisiert die Missstände zwischen den Gesellschaftsschichten. | ||
| + | |||
| + | Georg Büchners Brief ist die Antwort auf den Brief seiner Eltern, die von einer gescheiterten politischen Aktion demokratisch Gesinnter in Frankfurt berichteten. Daraufhin macht Büchner seine Meinung deutlich, und zwar, dass nur Gewalt gegen die Fürsten wirksam sei (vgl. Z. 2). Denn es sei bekannt, dass die Fürsten nichts an der Regierung und an den Menschen- und Bürgerrechten ändern würden, wenn man ihnen das nicht deutlich machen würde (vgl. Z. 3). Durch die Nutzung des Pronomens „wir“ (Z. 3), macht er deutlich, dass er unter Anderem auch die Meinung seiner Anhänger und allen anderen Revolutionären vertritt. Büchner verdeutlicht, dass die vermeintlichen Rechte, die das Volk besitzt, nur „durch die Notwendigkeit abgezwungen [wurden]“ (Z. 4), also von den Menschen- und Bürgerrechten nur die nötigsten vorhanden sind. Die Metapher, dass diese Rechte dem Volk „hingeworfen [wurden], wie eine erbettelte Gnade“ (Z. 6f.), sagt aus, dass diese Rechte den Ansprüchen des Volkes nicht gerecht werden und auch nur durch Nachdruck entstanden sind. Büchner beschreibt diese metaphorisch als das „elende Kinderspielzeug, um dem ewigen Maulaffen Volk seine zu eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen“ (Z. 6-8). Das „elende Kinderspielzeug“ (ebd.) ist eine Metapher für die inhumanen Rechte des Volkes. Dieses wird dennoch als „Maulaffen Volk“ (ebd.) beschrieben und soll aussagen, dass sie die Missstände gar nicht mitbekommen. Die „eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen“ (ebd.) ist eine Metapher für die Missstände, keine Menschen- und Bürgerrechte, zu hohe Abgaben und vieles mehr, die das Volk nicht wahrnimmt, die die Fürsten aber durch vermeintlichen Rechte und Erklärungen legitim darstellen wollen. Die Metaphern „blecherne Flinte“ (Z. 8) und „hölzerner Säbel“ (Z. 8) stehen für die Armut des Volkes und die Missstände zwischen den Bevölkerungsschichten. Da ja Soldaten sich mit Flinten und Säbeln bewaffnen und eigentlich einen gewissen Wohlstand repräsentieren, ist dies in dem Zusammenhang abwertend gemeint, dass das Volk ein schlecht bewaffneter Soldat ist, also arm ist. Büchner vergleicht das deutsche Volk mit anderen Ländern und sagt aus, dass „nur ein Deutscher die Abgeschmacktheit begehen konnte, Soldatchens zu spielen“ (Z. 9). Dabei könnte man davon ausgehen, dass Deutschland zu der Zeit im Vergleich zu anderen Ländern mit seiner Staatsform im Rückstand lag. Der Diminutiv „Soldatchens“ (ebd.) bezieht sich hierbei wieder auf die ärmlichen Verhältnisse des Volkes. | ||
| + | |||
| + | Büchner sagt, dass man den Revolutionären den Gebrauch von Gewalt vorwerfe (vgl. Z. 11). Mit der rhetorischen Frage „Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand?“ (Z. 11f.) sagt Büchner aus, dass das Volk nur durch Gewalttaten handelt, weil eine andere Form um seine Ziele zu erreichen, zum Beispiel seine Rechte durch Demonstrationen zu erkämpfen, nichts bringen würde und rechtfertigt damit diese Gewalttaten. Büchner erläutert noch einmal, dass das Volk nicht mehr merke, wie eingeschränkt es sei (Z. 12-15 ). Er verdeutlicht metaphorisch, dass das Volk „im Kerker geboren und großgezogen [wurde]“ (Z. 12f.), also von Geburt an und bis zum Lebensende rechtlich eingeschränkt ist. Dadurch, dass die Menschen von Geburt an keine andere Staatsform und Gesetze kennt, „merken [sie] nicht mehr, dass [sie] im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde“ (Z. 13ff.). „Mit angeschmiedeten Händen und Füßen“ (ebd.) ist die Arbeit gemeint, die die Menschen verrichten müssen und „[der] Knebel im Munde“ (ebd.) steht metaphorisch dafür, dass die Menschen sich auch nicht darüber beschweren dürfen. Also ist gemeint, dass das Volk die inhumane Arbeit für die Fürsten verrichten muss ohne sich dabei beschweren zu dürfen. Durch die rhetorische Frage „Was nennt ihr denn gesetzlichen Zustand?“ (Z. 15), verdeutlicht Büchner, dass man nicht von Gesetzen reden kann, die für jeden gerecht sind. In der darauf folgenden rhetorischen Frage beantwortet er die Frage welcher Gesetzeszustand herrsche damit, dass „die große Masse der Staatsbürger zum fronenden Vieh [gemacht wurde], um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen“ (Z. 16 ff.). Das Volk ist also zu den Dienstleistungen verpflichtet. „Die unnatürlichen Bedürfnisse“ (ebd.) sind eine Metapher für die hohen Abgaben, die das Volk zu zahlen hat. Die Hyperbel „unbedeutend und verdorben“ (ebd.) steht dafür, dass die „Minderzahl“ (ebd.), also die Fürsten, es nicht verdient haben, vom Volk finanziell unterstützt zu werden, da sie dem Volk nichts zurückgeben und sie nur ausbeuten. Dieses Gesetz wird durch „rohe Militärgewalt und die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten“ (Z. 19) unterstützt. Darunter kann man verstehen, dass jegliche Wiedersetzungen ohne Rücksicht auf Verluste durch Gewalt, von der Regierung aus, gelöst werden. „Die dumme Pfiffigkeit“ (ebd.) ist eine Antithese, durch die Büchner verdeutlicht, dass das ganze Regierungssystem zwar gut durchdacht ist, aber nicht mehr lange halten wird, da er und andere Revolutionäre dies stoppen wollen. Trotzdem stellt somit „dies Gesetz […] eine ewige, rohe Gewalt“ (Z. 20) für Büchner dar, die er „mit Mund und Hand“ (Z. 21) bekämpfen will. Er will also mit allen Mitteln, durch zum Beispiel Reden und vor allem durch Gewalt gegen die Fürsten und ihr Regierungssystem ankämpfen. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend kann man sagen, dass Georg Büchner in dem Brief seine Meinung zur Bekämpfung der Regierung deutlich macht. Er spricht häufig Gewalt als Mittel zur Bekämpfung an, welches zudem als Appell gedeutet werden kann. Außerdem erläutert er, dass das Volk jahrelang zu Unrecht behandelt wurde und man endlich einen Schlussstrich ziehen muss. Seine Erläuterungen sind vor allem durch Metaphern und rhetorische Fragen gekennzeichnet. Neben den rhetorischen Fragen wird auch eine einfache Sprache verwendet, die den Text somit für jeden verständlich machen. | ||
| + | |||
| + | === Abschrift der 2. Klausur === | ||
| + | |||
| + | '''1. Aufgabe''' | ||
| + | |||
| + | Der Brief „An die Familie“, geschrieben von Georg Büchner im Juli 1835 in Straßburg, in der Epoche des Vormärz, thematisiert die Zensur von Büchners Buch und allgemein die literarische Freiheit. | ||
| + | |||
| + | Der erste Abschnitt (Z. 2-15) handelt von Büchners Verständnis von den Aufgaben eines Dramatikers. Georg Büchners Buch soll „[eine] sogenannte Unsittlichkeit“ (Z. 2) beinhalten. Daraufhin beschreibt Büchner seine Auffassung, dass „der dramatische Dichter […] nichts als ein Geschichtsschreiber“ (Z. 3f.) ist. Somit sagt er aus, dass die „Unsittlichkeit“ (ebd.) als wahre Begebenheit in seinem Buch dokumentiert wurde. Er sagt, der Dichter erschaffe die Geschichte zum zweiten Mal (vgl. Z. 5f.) und versuche diese lebendig (vgl. Z. 7f.) darzustellen. Der Geschichtsschreiber liefere im Gegensatz dazu „eine trockene Erzählung“ (Z. 7). Büchner differenziert,unter Verwendung einer Aufzählung, dass Geschehnisse und das darauf aufbauende Drama „statt Charakteristiken Charaktere, […] statt Beschreibungen Gestalten gibt“ (Z. 8f.). Dabei sei die „höchste Aufgabe“ (Z. 9), also der Fokus, die Geschichte so genau wie möglich zu erzählen (vgl. Z. 10). Büchner sagt, dass ein Drama „weder sittlicher noch unsittlicher […] als die Geschichte selbst“ (Z. 11f.) sein solle. Denn „die Geschichte ist vom lieben Herrgott nicht zu einer Lektüre für junge Frauenzimmer geschaffen worden“ (Z. 12f.). Mit „junge Frauenzimmer“ (ebd.) drückt Büchner metaphorisch aus, dass ein Drama den Menschen die Realität vor Augen führen soll und nicht zur Unterhaltung dienen oder Geschehnisse verharmlosen soll. Und nach dieser Auffassung hat Büchner sein Drama verfasst (vgl. Z. 15). | ||
| + | Der zweite Abschnitt (Z. 16-27) handelt davon, warum Dramen, die auf Geschehnissen aufbauen, wichtig sind, Büchner geht anfangs darauf ein, dass er Gestalten erfindet und erschafft um die vergangene Geschichte zu veranschaulichen (vgl. Z. 17f.). Er denkt, dass die Menschen aus Dramen lernen können, wie man es auch in einem Geschichtsstudium und durch das Miterleben seines Umfelds macht (vgl. Z.19ff.). Da man unter anderem Büchners Drama verbieten wollte, ist er der Meinung, dass „man keine Geschichte studieren [dürfe]“ (Z. 22). Denn es werden dieselben Inhalte angesprochen (vgl. Z.23). Das heißt es macht keinen Unterschied, wenn ein Dramatiker ein Buch über die Geschehnisse verfasst und nur anders darstellt. Die Vertuschung von diesen Geschehnissen ist durch ein Verbot literarischer Texte nämlich nicht möglich. Büchner bezieht sich auf die Veranschaulichung der Realität durch historische Erzählungen und durch Dramen, die der Bevölkerung die Augen öffnen soll. | ||
| + | Der letzte Abschnitt (Z. 27-38) behandelt die Idealvorstellungen, die die Dichter vermeintlich beschreiben sollen. Büchner sagt, dass die Auffassung „der Dichter müsse die Welt nicht zeigen wie sie ist, sondern wie sie sein solle“ (Z. 38f.) nicht richtig ist. Er will die Welt nicht besser machen als Gott (vgl. Z.30), das heißt, er will den Menschen nicht sagen, wie eine Idealwelt aussieht, sondern ihnen Tatsachen beschreiben, aus denen sie selber ihre Schlüsse ziehen sollen. Büchner sagt, dass die Figuren in den Idealdichtungen „Marionetten mit himmelblauen Nasen und affektiertem Pathos“ (Z. 33f.) sind. „Marionetten mit himmelblauen Nasen“ (ebd.) ist eine Metapher dafür, dass die Figuren in den Geschichten ein Ideal darstellen. Welches aber fremdbestimmtr ist, weil Marionetten gesteuert werden. Außerdem ist „affektierter Pathos“ (ebd.) eine Metapher dafür, dass die Dramen dieser Dichter aufgesetzt sind und nicht der Realität entsprechen. Während diese Ideale verbreitet werden, findet Büchner die Dramen wichtiger, die die Geschehnisse der Zeit erzählen. Die Antithesen „Leid und Freude […] Abscheu und Verwunderung“ (Z. 35f.) sind Empfindungen, die Dramen, die die Realität darstellen, vermitteln. Für Büchner sind diese wichtig, da sie die Bevölkerung gewissermaßen beeinflussen und zum Umdenken bzw. Nachdenken anregen. Der letzte Satz, dass Büchner etwas von Goethe und Shakespeare hält und nicht viel von Schiller, könnte bedeuten, dass Goethe und Shakespeare seiner Beschreibung eines Dichters entsprechen und Schiller nicht. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend kann man sagen, dass Büchner seine Auffassung eines dramatischen Dichter und seine Aufgaben beschreibt. Ein dramatischer Dichter ist demnach jemand, der echte Geschehnisse mithilfe von Figuren und Gestalten zu beschreiben und zu veranschaulichen versucht. Außerdem sagt er, dass ein Drama die Menschen so belehren kann wie es die Geschichte macht, man also genau dieselben Erkenntnisse erschließt. Schließlich ist er der Meinung, dass die von Dichtern idealisierte Welt zu realitätsfern ist und das Verständnis der Menschen über reale Geschehnisse einschränkt. Büchner argumentiert für sein Drama und veranschaulicht überwiegend metaphorisch seine Argumente. Dabei richtet er sich an die Leute, die sein Buch für unangemessen halten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2. Aufgabe''' | ||
| + | |||
| + | Georg Büchners Brief „An die Familie“ bezieht sich auf die Kritik, die er für sein Drama „Woyzeck“ erhalten hat. | ||
| + | In dem Brief beschreibt er den dramatischen Dichter als einen Geschichtsschreiber. Sein Drama handelt von den Missständen in den Gesellschaftsschichten. Wobei die untere von der oberen Schicht im 19. Jahrhundert ausgebeutet wurde. Diese Ereignisse beschreibt Büchner in der Form eines Dramas. Hier stellen Woyzeck und Marie die untere Schicht dar, die alles tun müssen um sich ernähren zu können. Zum Beispiel verrichtet Woyzeck jegliche Arbeit, indem er den Hauptmann rasiert (Szene 5) und als Versuchsobjekt dient (Szene 8). Zudem fordert er mithilfe des Dramas eine Änderung dieser Gesellschaft; er beschreibt dafür extreme Zustände, die Woyzeck als Repräsentant für die untere Schicht, erlebt. Er ist arm und seine Freundin geht ihm deswegen sogar fremd und wird wiederum nur ausgebeutet (Szene 6). Dies soll den Menschen zeigen, dass etwas geändert werden musste. Darauf geht Büchner auch in seinem Brief ein; die Leute sollen daraus lernen. Büchner versucht in seinem Drama auch nicht eine idealisierte Welt zu zeigen. Am Ende des Drama wurde Woyzeck sogar dazu getrieben seine Freundin umzubringen (Szene 20). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Effi Briest == | ||
| + | |||
| + | === Inhaltsangabe === | ||
| + | |||
| + | Die siebzehnjährige Effi Briest stammt aus einer Adelsfamilie und wohnt zusammen mit ihren Eltern in Hohen-Cremmen. Der Baron Geert von Innstetten, der ein Vereherer von Effis Mutter war, hält um Effis Hand an und auf Wunsch ihrer Eltern nimmt Effi den Antrag an. Nach der Hochzeitsreise durch Italien zieht Effi mit Innstetten nach Kessin. Effi fürchtet sich allerdings vor dem Haus, da sie denkt es würde dort spuken. Außerdem langweilt sich Effi in dem Badeort, weil es dort kaum Abwechslung gibt. Der einzige ihr sympathische Mensch ist der Apotheker Gieshübler, mit dem sie sich auch anfreundet. Aus der Ehe entsteht eine Tochter dessen Name Annie ist. Effi stellt das Dienstmädchen Roswitha als Kindermädchen ein, mit der sich Effi gut versteht. Während Effi ihre Eltern in Hohen-Cremmen besucht, unternehmen Innstetten und der Landwehrbezirkskommandeur Major von Crampas einige Ausritte an denen sich Effi nach ihrer Rückkehr beteiligt. Als Innstetten verhindert ist, unternehmen Effi und Crampas zusammen einen Ausritt, bei dem sich die beiden näher kommen und seitdem sie immer öfter zusammen ihre Zeit verbringen. Nach einiger Zeit teilt Innstetten Effi mit, dass die Familie wegen einer Beförderung Innstettens nach Berlin umziehen muss. Effi ist froh darüber, da sie den Kontakt mit Major Crampas abbrechen kann. In Berlin fühlt Effi sich im Vergleich zu Kessin sehr wohl und langweilt sich dort nicht mehr. Durch Zufall findet Innstetten einige Liebesbriefe von Crampas an Effi. Daraufhin fordert Innstetten Crampas zu einem Duell heraus, bei dem Crampas stirbt. Wegen der verletzten Ehe wird Effi von ihrem Mann und ihrer Tochter verlassen und auch ihre Eltern verstoßen sie. Effi zieht zusammen mit Roswitha in eine kleine Wohnung in Berlin. Nach einem Treffen mit ihrer Tochter Annie, erleidet Effi einen Zusammenbruch, da Annie sich ihr gegenüber sehr distanziert verhält. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustand nehmen Effis Eltern sie wieder in ihr Haus auf, wo sie schließlich stirbt. | ||
| + | |||
| + | === Analyse Romananfang === | ||
| + | |||
| + | Der Roman „Effi Briest“ von Theodor Fontane, geschrieben im Jahr 1896 in der Epoche des Realismus, thematisiert den sozialen Umstand der Frau im 19. Jahrhundert. Der vorliegende Textauszug handelt von der Beschreibung des Anwesens der Familie von Briest. | ||
| + | |||
| + | Die Familie lebt in dem „Herrenhaus zu Hohen-Cremmen“ (Z.3), wovon man ausgehen kann, dass die Familie von Briest eine Adelsfamilie ist. Der „helle[...] Sonnenschein“ ist ein Klimax und betont die Idylle und den Frieden, die in Effis Heimatort herrschen und einen Einblick auf Effis friedliches Leben geben. Der „breite[...] Schatten“ hingegen steht gegenteilig zum „helle[n] Sonnenschein“ (ebd.) und steht metaphorisch für eine baldige Veränderung. Es wird eine Sonnenuhr beschrieben, die im Garten der Briests steht (vgl. Z. 8). Hier findet man das Motiv der Sonne wieder, die für den Frieden und die Idylle in Effis Leben steht. Somit steht die Sonnenuhr, da man anhand einer Uhr die Zeit ablesen kann, für die gute Zeit, die Effi in ihrem Elternhaus verbracht hat. Außerdem findet man die Sonnenuhr am Ende des Romans wieder, denn dort wird Effi beerdigt. Somit stellt die Sonnenuhr ihre Lebenszeit symbolisch dar. Um die Sonnenuhr sind Rhabarbarstauden und die indische Pflanze Canna indica gepflanzt (vgl. Z. 9). Übersetzt bedeutet Canna indica „zeitlos“, was Effis bisherige Kindheit widerspiegeln soll. Sie hat alles, was sie braucht und lebt eine sorglose Kindheit. Als nächstes wird beschrieben, dass „Fronthaus, Seitenflügel und Kirchhofsmauer […] einen kleinen Ziergarten umschließendes Hufeisen [bilden]“ (Z. 15 ff.). Diese Konstruktion bildet symbolisch gesehen einen Schutz vor der Außenwelt. Einerseits wird Effis Kindheit gewahrt und deutet somit auf ihre Unschuld hin. Andererseits wird durch diesen Schutz auch die Ungewissheit vor der Außenwelt verstärkt. An dem offenem Ende, wo das von dem Gebäude und der Mauer gebildete Hufeisen eine offene Seite hat, liegt ein Teich, an dem, wie beschrieben ein angeketteltes Boot liegt (vgl. Z. 18). Der Teich stellt ein Hindernis dar, wenn man versuchen würde ihn zu überqueren um das andere Ufer zu erreichen. Das angekettelte Boot ist leicht zu lösen und macht es möglich auf das Wasser zu gelangen. Der Teich und das Boot könnten somit eine Gefahr darstellen, wenn man versuchen sollte der gewohnten Umgebung zu entfliehen und das Unbekannte sucht. So wird Effi auch beschrieben; sie liebt das Abenteuer und geht gerne Risiken dafür ein. Neben dem Teich steht eine Schaukel, deren Balken etwas schief steht (vgl. Z. 19 ff.). Am Zustand der Schaukel kann man festmachen, dass sie oft genutzt wurde. Im Roman wird zudem erwähnt, dass Effi immer noch gerne schaukelt, besonders weil die Schaukel einzustürzen droht. Die Schaukel steht für Freiheit, da Effi sich frei fühlt, wenn sie schaukelt und für Abenteuer, da man nicht weiß, ob sie jeden Moment einstürzt. Hier werden nochmal Effis Charaktereigenschaften beschrieben; sie hat neben der Abenteuerlust ein Bedürfnis nach Freiheit. Als letztes werden „mächtige alte Platanen“ (Z. 23) beschrieben, die den Teich und Schaukel verstecken. Metaphorisch ist damit gemeint, dass sie Effi vor den Gefahren abhalten sollen. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend kann man sagen, dass direkt zu Beginn des Romans Effis Lebensumstände und einige Charaktereigenschaften unter anderem metaphorisch dargestellt werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Die Marquise von O... == | ||
| + | |||
| + | === Kopfzeile === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Sprache == | ||
| + | |||
| + | === Zusammenfassung "Was ist 'Mehrsprachigkeit'?- Eine Definition", Alexandra Wölke === | ||
| + | |||
| + | Die Bedeutung des Themas: | ||
| + | |||
| + | - zentrales Thema durch Globalisierung | ||
| + | |||
| + | - internationale Kommunikationsnetzwerke | ||
| + | |||
| + | → erwünschte und akzeptierte Selbstverständlichkeit mehr als eine Sprache zu können | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der Begriff „Mehrsprachigkeit“: | ||
| + | |||
| + | - individuelle, institutionelle, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit | ||
| + | |||
| + | - gesellschaftliche Mehrsprachigkeit: Geltung, Anwendung mehrerer Sprachen in einer Gesellschaftliche | ||
| + | |||
| + | → Länder mit offizieller Mehrsprachigkeit | ||
| + | |||
| + | - individuelle Mehrsprachigkeit: Fähigkeit bei der täglichen Kommunikation mehr als eine Sprache anwenden zu können | ||
| + | |||
| + | → Erstsprache/ Muttersprache; Zweit-/ Drittsprache oder Fremdsprache | ||
| + | |||
| + | |||
| + | „Heteroglossie“ als erweiterter Begriff von Mehrsprachigkeit: | ||
| + | |||
| + | - Sprache ist unabgeschlossen, lebendig, im Prozess | ||
| + | |||
| + | - Sprache ist vielfältig, Bandbreite sprachlicher und kommunikativer Ressourcen | ||
| + | |||
| + | → lässt sich verschiedenen Sprachsystemen zuordnen | ||
| + | |||
| + | - Heteroglossie: Fähigkeit sich einer komplexen sprachlichen Vielfalt bedienen zu können | ||
| + | |||
| + | - Mehrsprachigkeit nicht nur auf Fremdsprachen bezogen, sondern auch auf sprachliches Potenzial bezogen (kommunikative Kompetenz) | ||
| + | |||
| + | → Fähigkeit (mittels Kommunikation) sich selbst verständlich zu machen und andere zu verstehen | ||
| + | |||
| + | - Wissen von Sprachsystem, Grammatik, Lexik, Stilistik → Voraussetzung kompetenten Sprachhandelns | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Äußere und innere Mehrsprachigkeit: | ||
| + | |||
| + | - innere Mehrsprachigkeit: sprachliche Differenzierungen innerhlab einer Sprache; Varietäten | ||
| + | |||
| + | → Zeit, soziale Schicht, kommunikative und funktionelle Situation | ||
| + | |||
| + | - Zusammenhänge zwischen äußerer und innerer Mehrsprachigkeit | ||
| + | |||
| + | === Analyse "Hab isch gesehen mein Kumpel- Wie die Migration die deutsche Sprache verändert hat", Uwe Hinrichs === | ||
| + | |||
| + | Der vorliegende Sachtext „Hab isch gesehen mein Kumpel- Wie die Migration die deutsche Sprache verändert hat“ von Uwe Hinrichs, veröffentlicht im Jahr 2012, thematisiert den Sprachwandel der deutschen Sprache unter Einfluss der steigenden Migrationsrate. | ||
| + | |||
| + | Der erste Sinnabschnitt (Z. 1- 18) befasst sich damit, dass „der deutsche Sprachraum […] seit je und von allen Seiten von fremden Sprachen und Kulturen umgeben [ist]“ (Z. 1f.). Damit ist gemeint, dass Deutschland schon immer von Ländern wie Frankreich, Dänermark und Polen umgeben ist und somit eigentlich Kontakt zu anderen Sprachen und Kulturen gehabt haben könnte. Dennoch ist davon die Rede, dass dieser Kontakt „die weiche Variante des Sprachkontakts […] ohne soziale Konsequenzen“ war. Die Sprache und auch die Kultur wurden also weitestgehend nicht stark von den Nachbarländern und auch anderen Ländern beeinflusst bzw. man hat sich mit anderen Kulturen und Sprachen nicht so intensiv auseinandergesetzt. Seit den Siebzigern habe sich das aber geändert, denn Menschen mit anderen Kulturen und Sprachen haben die Kultur und Sprache in Deutschland geprägt (vgl. Z. 13- 18). Der Autor schildert in diesem Abschnitt grob, dass sich die deutsche Sprache durch Einflüsse aus dem Ausland, also dadurch, dass Menschen aus anderen Ländern eingewandert sind und ihre Sprache und Kultur mitnahmen, verändert hat. | ||
| + | |||
| + | Der zweite Abschnitt (Z. 19- 40) beginnt einleitend mit einer rhetorischen Frage, „wie [...] die jüngsten Sprachkontakte das Deutsche verändert [haben]“ (Z. 19f.), die die Leitfrage des Abschnitts darstellt, und versucht im Anschluss eine Erklärung dafür zu geben. Zunächst listet der Autor auf, dass „das, was […] für einfache Kommunikationszwecke mit fremden Sprachen am allerwenigsten benötigt [wird]“ (Z. 21 ff.), auch als erstes vernachlässigt wird. Dabei nennt der Autor „die Fälle, die Endungen und die Regeln ihrer Verknüpfung“ (Z. 24f.). Als Beispiel wird auch Bastian Sicks Bestseller („Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“) genannt, um seine Behauptung zu unterstützen (vgl. Z. 26ff.).Außerdem sagt er, dass „Dativ und Akkusativ […] Bastionen räumen [müssen]“ (Z. 29f.). Bastionen sind Festungswälle, die vor Angreifern schützen sollen. Die Metapher „Bastionen räumen“ (ebd.) betont, dass die korrekte Anwendung der Kausalfälle immer mehr vernachlässigt wird. Abschließend nennt der Autor ein paar falsche Beispielkonstruktionen, die er letztendlich auch nochmal grammatikalisch korrekt aufzählt, um deutlich zu machen, dass solche falschen Konstruktionen einem täglich begegnen und auch des öfteren von jungen Leuten angewendet werden, ohne dass sie es bemerken (vgl. Z. 31ff.). | ||
| + | |||
| + | Im nächsten Abschnitt (Z. 41- 57) macht der Autor auf den Verlust der Sprachstrukturen im Deutschen aufmerksam. Er behauptet ironisch, dass „das mehrsprachige Milieu […] auf korrekte Deklination und genaue Endungen durchaus verzichten [könne], weil diese Art der Grammatik nur Kodierungsenergie frisst, die woanders viel dringender gebraucht wird, beispielsweise um Defizite im Wortschatz auszugleichen“ (Z. 41- 46). Die daraus resultierende Vereinfachung der Sprachstrukturen, die Nichtmuttersprachlern eine einfachere Kommunikation ermöglicht, wird als Grund für den Verfall der Sprache angesehen (vgl. Z. 48 ff.). Die anschließende Behauptung, „Schulkategorien wie Konjunktiv, Plusquamperfekt oder vollendetes Futur werden in naher Zukunft wahrscheinlich kaum gebraucht“ (Z. 54ff.), verdeutlicht nochmal, dass die Grammatik sehr vernachlässigt wird. Der darauf folgende Sinnabschnitt (Z. 58- 83) behandelt einen weiterer Einfluss auf die Sprache, die Herkunftssprachen der Migranten (vgl. Z. 58 f.). Der Autor liefert eine Erklärung für die Sprachveränderungen, und zwar „greifen [die Migranten] auf Sprachstrukturen zurück, die sie aus ihrer Muttersprache mitbringen“ (Z. 60 f.), welche auf das Deutsche übertragen werden (vgl. Z. 62 f.). Anschließend nennt der Autor das „großstädtische Kiezdeutsch“(Z. 64) als ein Beispiel für Veränderungen in der Sprache. Durch die Nennung der „Potsdamer Linguistin Heike Wiese“ (Z. 64 f.) und einigen Beispielen, die Satzmuster aus dem Türkischen und Arabischen aufweisen (vgl. Z. 66 ff.), wird seine These, dass die Herkunftssprachen der Migranten einen Einfluss auf die deutsche Sprache nehmen, gestärkt. Des Weiteren wird aufgelistet, dass „auch in der Alltags- Umgangssprache […] Beispiele für neue Strukturen, die ihre Vorbilder in vielen Migrantensprachen haben“ (Z. 70- 79), vorzufinden sind. Daneben auch „neudeutsche Ausdrücke [, die] […] Parallelen im Türkischen [haben]“ (Z. 80 ff.). Durch die Aufzählung zahlreicher Beispiele, wird seine These gestärkt. | ||
| + | |||
| + | Im vorletztem Sinnabschnitt des Textes (Z. 84- 106) ist von „der heißen Phase des kontaktinduzierten Wandels der Sprachstrukturen“ (Z. 84 f.) die Rede. Die Metapher „heiße Phase“ (ebd.) steht für die Ankündigung einer Wende. Der Neologismus „kontaktinduziert“ (ebd.) betont, dass der Wandel in der Sprache durch den Kontakt unter den Menschen ausgelöst wird. So heißt es auch als Erläuterung, dass „die 'Fehler' der Migranten allmählich von den deutschen Muttersprachlern nachgeahmt werden“ (Z. 86 f.). Der Autor nennt an dieser Stelle auch einen Fachbegriff bzw. benennt er dieses Phänomen als „'foreigner talk'“ (Z. 88). Dadurch wirkt seine Argumentation authentischer. Die Folge daraus ist, dass es „zu[r] Sprachvermischung und zu neuen Sprachstrukturen“ (Z. 91 f.) kommt. Man unterscheidet nicht mehr zwischen richtiger und falscher Grammatik (vgl. Z. 89 f.) und „die Bereitschaft […] Fehler auch als Fehler wahrzunehmen und spontan zu korrigieren, [lässt] mit der Zeit nach und verschwindet irgendwann ganz“ (Z. 93 ff.). Daraus ergebe sich die Reduktion der Grammatik (vgl. Z. 101 f.) und die Vereinfachung bzw. Auflösung vieler Regeln (Z. 103 f.). Allgemein werde die Sprache einfacher (vgl. Z. 104 f.) „und wird [...] vom Englischen unterstützt“ (Z. 105 f.). Der Autor spricht am Ende des Abschnitts das Thema Anglizismus an, durch den die deutsche Sprache merklich beeinflusst wird. In diesem Abschnitt werden der Prozess und die Gründe für den „Abbau“ von Regeln in der deutschen Grammatik und die Neuentwicklung unter Einfluss von anderen Sprachen (hier wird das Englische genannt) verdeutlicht. | ||
| + | |||
| + | Im letzten Sinnabschnitt (Z. 107- 120) geht der Autor darauf ein, dass es in der Wissenschaft kaum Forschungen über dieses Phänomen der Sprachentwicklung gibt (vgl. Z. 107 ff.). Einen Grund dafür sieht der Autor darin, dass „Linguisten, […] wenn sie den Einfluss der Migrantensprachen auf das Deutsche analysieren, schnell in eine Diskriminierungsfalle geraten könnten“ (Z. 110 ff.). Der Autor bewertet dies aber als eine verlorene Gelegenheit „Deutsche und Migranten in Projekten zusammenzubringen und Visionen einer offenen Gesellschaft mit Leben zu füllen“ (Z. 115 f.). Somit fordert der Autor, nicht nur das Schlechte im Wandel der deutschen Sprach zu sehen. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend kann man sagen, dass der Autor nach der geschichtlichen Einführungen über die verschiedenen Einflüsse, die zu den ersten Sprachkontakten führten, auf die Einflüsse eingeht, die die Sprache heutzutage beeinflussen. Zudem geht er auf die Folgen ein, dass die Sprachstrukturen zunehmend verschwinden. Verdeutlicht wird dies anhand von Metaphern und Beispielen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Analyse "Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben", Ralph Mocikat === | ||
| + | |||
| + | Der vorliegende Sachtext „Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben“, geschrieben von Ralph Mocikat und veröffentlicht im Jahr 2012, thematisiert die Forderung Mocikats, die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache zu erhalten. | ||
| + | |||
| + | Die Überschrift „Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben“ stellt das Thema dar und fungiert als ein Appell. Somit wird direkt deutlich gemacht, worum es geht und was der Autor fordert. | ||
| + | Im ersten Sinnabschnitt (Z. 1- 5) wird zunächst eine These aufgestellt, dass „in der Wissenschaftskommunikation [...] zunehmend auch im Inland ausschließlich die englische Sprache verwendet“ (Z. 1 f.) werde. Durch den nächsten Satz, das dies „insbesondere für naturwissenschaftliche und technische Disziplinen“ (Z. 2 f.) gelte, erläutert der Autor um welchen Bereich der Wissenschaft es sich handelt. Im darauffolgenden wird darauf eingegangen, inwiefern die englische Sprache in der Wissenschaft angewendet wird: „Auf Kongressen […] werden Vorträge fast immer nur noch auf Englisch gehalten“ (Z. 3 f.) und „Drittmittelgeber schreiben oft vor, Förderanträge lediglich in englischer Sprache einzureichen“ (Z. 4 f.). Die englische Sprache zu beherrschen stellt somit eine Notwendigkeit dar. | ||
| + | Der zweite Sinnabschnitt (Z. 6- 9) handelt davon, dass „Hochschulen […] Studiengänge komplett auf Englisch um[stellen]“ (Z. 6). Hier wird noch einmal deutlich, dass die Beherrschung der englischen Sprache notwendig für Studierende ist. Darauffolgend stellt der Autor die Folge, „dass das tiefere Verständnis deutlich eingeschränkt [wird], wenn Studierende den Stoff in ihrer Disziplin nur in der Lingua franca aufnehmen“ (Z. 8 f.), dar und bezieht sich dabei auf verschiedene Studien (vgl. Z. 7). Die „Lingua franca“ (Z. 9) ist die Sprache eines größeren mehrsprachigen Raums, in diesem Zusammenhang also die englische Sprache. Der Autor sieht die Gefahr eines eingeschränkten Verständnisses bei Studierenden, da viele die englische Sprache nicht so gut beherrschen. Die Nennung der Studien, die allesamt aus dem Ausland stammen (ebd.), zeigen, dass das Problem nicht nur Studierende in Deutschland, sondern auch Studierende aus anderen Ländern betrifft. | ||
| + | Im nächsten Sinnabschnitt (Z. 10- 14) bezieht sich der Autor schließlich darauf, dass auch „bei uns“ (Z. 10), also womöglich an der Universität, an der Mocikat unterrichtet, die Verwendung der englischen Sprache in der Wissenschaft Konsequenzen hat (vgl. Z. 10). „Seminare oder wissenschaftliche Besprechungen […] verflachen“ (Z. 10 ff.). Das Verb „verflachen“ (ebd.) bedeutet, dass etwas niveaulos ist bzw. wird. In diesem Zusammenhang bedeutet das also, dass wenn ausschließlich das Englische verwendet wird, Studierende Probleme haben sich so auszudrücken, wie sie es auf ihrer Muttersprache könnten. Ihnen fehlt ein umfangreicher Wortschatz. Der kurze Satz „Sie verflachen“ (Z. 12), hat dabei eine betonende Funktion. Darauffolgend nennt der Autor „beispielsweise, wie die Diskussionsbereitschaft [in vielen Seminaren] dramatisch schwindet“ (Z. 12 ff.). Das Adverb „dramatisch“ (ebd.) betont die drastisch sinkende Teilnahme bei Diskussionen, die auf den mangelnden Wortschatz zurückzuführen ist. | ||
| + | Eine detaillierte Erläuterung, warum das Verständnis der Studierenden eingeschränkt wird, gibt der Autor im darauffolgenden Sinnabschnitt (Z. 15- 30). Somit stellt er eine These auf: „Sprache [habe] nicht nur eine kommunikative, sondern auch eine kognitive Funktion“ (Z. 15 f.). Der Autor erklärt, dass die Funktion einer Sprache komplexer ist, als sie erscheint. Die „kognitive Funktion“ (ebd.) umfasst die Wahrnehmung und das Denken. Somit erläutert der Autor auch, dass „unsere Denkmuster, […] in dem Denken verwurzelt [bleiben], das auf der Muttersprache beruht“ (Z. 16 ff.). Zur Veranschaulichung seiner These nennt er ein Beispiel, dass „wissenschaftliche Theorien […] immer mit Wörtern, Bildern, Metaphern, die der Alltagssprache entlehnt sind[, arbeiten]“ (Z. 18 ff.). Der Autor stellt nun zunächst das Problem dar, das sich ergibt: „Anspielungen und Bilder[...] kann man nur in der jeweiligen Muttersprache voll erfassen“ (Z. 19 ff.). D.h. wenn die „Fachsprache nicht mehr die Alltagssprache ist, werden die Sprachbilder fehlen, die nötig sind, um Neues anschaulich begreiflich zu machen“ (Z. 21 ff.). Diese Konsequenz stellt ein Problem dar, welches aus der Umstellung in die englische Sprache innerhalb der Wissenschaft resultiert. Somit „läuft es auf eine geistige Verarmung hinaus, wenn Lehre und Forschung auf das Englische eingeengt werden“ (Z. 24 f.). Die Metaphern „geistige Verarmung“ (ebd.) und „eingeengt werden“ (ebd.) betonen, dass die Umstellung auf die englische Sprache, Menschen, für die die englische Sprache eine Fremdsprache ist, in der Fähigkeit Dinge zu verstehen und sich selbst auch ausdrücken zu können, einschränkt. Ein weiteres Argument für den Erhalt der deutschen Sprache als Wissenschaftssprache sei, dass „Gastwissenschaftler, die mit guten Deutschkenntnissen hierherkommen, dann jedoch von unserer Sprache und Kultur ferngehalten werden und […] ihre Sprachkenntnisse verlieren, […] sich ausgegrenzt vor[kommen] und […] ein negatives Deutschlandbild in ihre Heimat zurück[bringen]“ (Z. 25 ff.). Somit erkennt der Autor den Erhalt der deutschen Wissenschaftssprache als notwendig an, um die Kultur anderen Wissenschaftlern nicht vorzuenthalten. Des Weiteren weist der Autor darauf hin, dass „die Wissenschaft [sich] auch immer weiter von der Gesellschaft ab[koppelt], gegenüber der sie rechenschaftspflichtig ist“ (Z. 29 f.). Somit sagt, der Autor, dass die Umstellung ins Englische nicht nur Verständnisprobleme bei den Wissenschaftlern und Studierenden, sondern auch in der Bevölkerung mit sich bringt. Doch es sei wichtig, dass auch für die Bevölkerung Erkenntnisse aus der Wissenschaft nachvollziehbar sind. | ||
| + | Im letzten Sinnabschnitt (Z. 31- 34) wägt der Autor ab, dass man ohne Englisch als internationale Kongress- und Publikationssprache nicht auskomme (vgl. Z. 31 f.). Denn es muss ja eine Sprache geben, um international zu kommunizieren und zu agieren. Dennoch sei „unbestritten […], dass wir im Inland auch das Deutsche als Wissenschaftssprache benutzen und pflegen müssen“ (Z. 32 f.). Der Autor vertritt also weiterhin seine Meinung, die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache, zumindest innerhalb Deutschlands, zu nutzen. Das Adverb „unbestritten“ (ebd.) betont, dass es genug Gründe dafür gibt. Als letztes unterstützt er seine Forderung durch den Vorschlag, „in Übersetzungen zu investieren“ (Z. 33f.), um die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache zu erhalten. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Autor direkt im Titel seine Forderung, das Deutsche als Wissenschaftssprache zu erhalten, aufstellt. Er unterstützt seine Argumente und aufgestellten Thesen mittels Beispielen und Erläuterungen und nutzt unter anderem Metaphern zur Veranschaulichung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Analyse "Schreiben in der Schule- booaaa mein dad voll eklich wg schule", Wolfgang Krischke === | ||
| + | |||
| + | ==== Aufgabe 1 ==== | ||
| + | |||
| + | Der Sachtext „Schreiben in der Schule- booaaa mein dad voll eklich wg schule“, geschrieben von Wolfgang Krischke und veröffentlicht im Jahr 2011, thematisiert die Verwendung der Schriftsprache in der formellen und elektronischen Kommunikation. Dabei liegt der Fokus darauf, ob Jugendliche die elektronische Kommunikation von der formellen Kommunikation, und die bestehenden Regeln, unterscheiden können. | ||
| + | |||
| + | In der Überschrift wird zunächst ein Kontrast deutlich: „Schreiben in der Schule“ und „booaaa mein dad voll eklich wg schule“. Ersteres lässt vermuten, dass in der Schule auf Rechtschreibung, Zeichensetzung etc. geachtet wird. Letzteres verdeutlicht, wie Jugendliche untereinander kommunizieren. Dabei werden, neben der fehlenden Groß- und Kleinschreibung, „schule“, und falscher Rechtschreibung, „eklich“, weitere Merkmale deutlich. Die Interjektion „booaaa“ (ebd.), ist ein Empfindungslaut, der in dieser Situation ausdrückt, dass man genervt ist. Als nächstes ist der Anglizismus „dad“ zu finden. Hier wird deutlich, dass das Englisch die deutsche Sprache beeinflusst. Außerdem werden Abkürzungen wie „wg“ gebraucht. | ||
| + | |||
| + | Zunächst wird der Text mit einer Unterüberschrift, die als These fungiert, eingeleitet: „Simsen macht Schüler nicht dumm“ (Z. 1). Somit behauptet der Autor, dass das Kommunizieren mittels Handys Schüler nicht beeinträchtigt. Darauffolgend wägt der Autor seine These ab und behauptet, dass trotzdem „Texte […] heute fehlerhafter als früher“ (Z. 1) seien. | ||
| + | |||
| + | Im ersten Sinnabschnitt (Z. 2-12) wird die Thematik genauer geschildert. Einleitend wird eine rhetorische Frage gestellt, die das Vorurteil, dass Kinder zu wenig lesen würden (Z. 2), benennt. Darauf geht der Autor verneinend ein und er ist sogar der Meinung, dass Kinder „wohl noch nie zuvor […] so viel gelesen und geschrieben [haben] wie heute“ (Z. 2f.). „Noch nie zuvor“ (ebd.) lässt darauf schließen, dass es sich um ein Phänomen der heutigen Zeit handelt. Des Weiteren geht der Autor auf seine Behauptung ein und erläutert, dass Kinder täglich Millionen Wörter tippen und Stunden mit SMS- Nachrichten, Chat- Sprüchen etc. verbringen würden (vgl. Z. 3ff.). Somit nennt er Beispiele, die veranschaulichen, inwiefern Kinder lesen und schreiben. Die adversative Konjunktion „trotzdem“ (Z. 6) leitet ein, dass es jedoch Probleme mit dem Lesen und Schreiben gibt. Pädagogen und Ausbilder seien nicht zufrieden damit (vgl. Z. 6), da bei „den Simsern […] die Schrift vor allem als Plaudermedium“ (Z. 7f.) diene. Der Neologismus „Plaudermedium“ (ebd.) stellt das Problem ziemlich deutlich dar: Die Schrift wird zur Kommunikation genutzt und auf Orthografie etc. wird kaum geachtet. So sei diese „von den Normen der Hochsprache […] Lichtjahre entfernt“ (Z. 8f.). Die Metapher „Lichtjahre“ (ebd.) betont, dass man die Schrift als Kommunikationsmittel nicht mit der Hochsprache vergleichen kann und diese auch ganz andere Regeln besitzt. Im Folgenden werden dann Beispielsätze genannt um dies zu veranschaulichen und hyperbolisch geschildert, dass diese „Freunde des Dudens und ganzer Sätze […] zusammenzucken“ (Z. 11f.) lassen würden. Hier wird wieder darauf eingegangen, dass die Kommunikationsschrift von der Hochsprache abweicht und gekürzt bzw. grammatikalisch häufig falsch ist. | ||
| + | |||
| + | Der zweite Sinnabschnitt (Z. 12- 29) wird mit der rhetorischen Frage, „Können Jugendliche, die sich in diesen sprachlichen Trümmerlandschaften bewegen, überhaupt noch einen lesbaren Aufsatz, einen präzisen Bericht, ein angemessenes Bewerbungsschreiben verfassen?“ (Z. 12 ff.), eingeleitet. Der Frage kann man entnehmen, dass man, wenn man die Kommunikationssprache betrachtet, unsicher ist, ob Jugendliche sich in der Hochsprache zurechtfinden. Der Autor bezieht sich, um diese Frage zu beantworten, auf eine Studie der Germanistik- Professorin Christa Dürscheid (vgl. Z. 15f.). Sie untersuchte 1000 Deutschaufsätze von 16- bis 18- jährigen Schülern verschiedener Schulformen und verglich diese dann mit Mitteilungen in sozialen Netzwerken etc., die von denselben Jugendlichen verfasst wurden (vgl. 16ff.). Das Ergebnis sei, dass die sprachlichen Elemente der Netzkommunikation keine nennenswerten Spuren in den Schultexten hinterlassen haben (vgl. Z. 24ff.). „'Die Schüler können die Schreibwelten durchaus trennen [und] sie wissen, dass […] andere Regeln gelten'“ (Z. 26ff.). Somit sieht der Autor in der elektronischen Kommunikation nicht die Ursache für die fehlerhaften Texte, da er die Studie ja als Begründung seiner These anführt. | ||
| + | |||
| + | Im letzten Sinnabschnitt (Z. 29- 39) nennt der Autor die eigentliche Ursache für die fehlerhaften Texte. Zunächst stellt er dar, dass „die elektronische Kommunikation als Verursacher ausscheidet“ (Z. 31f.). Die eigentliche Ursache sieht er in der „Entwicklung […] in den siebziger Jahren, als Deutschlehrer die Kinder stärker als zuvor zum freien, spontanen Schreiben ermutigten. (Z. 34ff.)“. Das „spontane Schreiben“ (ebd.) sieht er als „eigentlich begrüßenswerten Trend“ (Z. 36f.) an. Das Adjektiv „eigentlich“ (ebd.) lässt darauf schließen, dass der Autor diesen Trend abwägend betrachtet. Somit erklärt der Autor schließlich auch, dass dieser Trend auf Kosten „'harter' Sprachfertigkeiten wie der Orthografie“ (Z. 37f.) ginge. „'harte[...]' Sprachfertigkeiten“ (ebd.) hat eine ironische Bedeutung, was die Anführungszeichen betonen. Der Autor geht davon aus, dass diese Sprachfertigkeiten eigentlich gar nicht schwierig zu beherrschen sind. Außerdem führt der Autor an, dass die „formale Korrektheit […] an Bedeutung [verlor]“ (Z. 38), was auch eine negative Folge darstellt. Im letzten Satz ist von der formalen Korrektheit als „bildungsbürgerliche Schikane“ (Z. 39) die Rede. Somit behauptet der Autor, dass die formale Korrektheit als unnötig bzw. von manch einem als „Quälerei“ wahrgenommen wurde. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend kann man sagen, dass der Autor der Meinung ist, dass die Probleme, die Jugendliche beim Schreiben haben, nicht durch die elektronische Kommunikation verursacht wird. Seine Thesen veranschaulicht er mithilfe von Beispielen und bezieht sich auf eine Studie, um diese zu bekräftigen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Aufgabe 2 ==== | ||
| + | |||
| + | Der Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Sprache hat verschiedene Ursachen und bringt Konsequenzen mit sich. | ||
| + | |||
| + | Als Anglizismus bezeichnet man ein Wort, welches aus dem Englischen stammt und in einer anderen Sprache übernommen wurde. Anglizismen, die in der deutschen Sprache geläufig sind, wären z.B.: „Screenshot“, „Update“, „Cloud“ etc. | ||
| + | |||
| + | Ein Grund dafür, dass Anglizismen verwendet werden, ist der Kontakt zu der englischen Sprache. Es fängt z.B. in der Schule an, wo man die englische Sprache als erste Fremdsprache erlernt. Außerdem gibt es zahlreiche Begegnungen zwischen deutschen und englischen Schülern und den Kulturen, z.B. im Rahmen von Schüleraustauschen. Aber auch durch die stetig wachsende Globalisierung erhöht sich der Kontakt zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern und dann ist die englische Sprache meistens die Sprache, die zur Kommunikation verwendet wird. Die Menschen in Deutschland werden zudem vom Englischen beeinflusst. Dies geschieht über diverse Medien, z.B. durch Werbungen, Nachrichten, soziale Netzwerke etc. | ||
| + | |||
| + | Daraus ergeben sich folglich auch Konsequenzen. Einerseits wird die deutsche Sprache modernisiert. Einige Begriffe aus dem Englischen hören sich, in Abhängigkeit vom Gesamtzusammenhang, besser an als die deutsche Übersetzung. Somit ist z.B. das Wort „Screenshot“ geläufiger als „Bildschirmaufnahme“. Außerdem sind die meisten Wörter mittlerweile so geläufig, dass viele Menschen die Bedeutungen kennen. Andererseits stellen Anglizismen für die „ältere“ Generation eher ein Hindernis dar. Das kann man darauf zurückführen, dass diese im Vergleich zur „jüngeren“ Generation keinen so umfangreichen Kontakt zur englischen Sprache hatten bzw. haben. Eine weitere Konsequenz ist, dass womöglich der Bezug zwischen Anglizismen und Wörtern aus der Herkunftssprache verloren geht. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ursachen für Anglizismen auf den Kontakt mit anderen Menschen und den Einfluss durch Medien zurückzuführen ist. Dabei stellen sich Konsequenzen heraus, dass Anglizismen geläufiger und häufiger verwendet werden, aber die Gefahr besteht missverständlich aufgenommen zu werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Klausur, Aufgabe 2 === | ||
| + | |||
| + | Digitale Kommunikation bietet viele Möglichkeiten, bringt aber auch Gefahren mit sich. Durch die Nutzung digitaler Medien findet heutzutage somit eine Veränderung der Kommunikation statt. | ||
| + | |||
| + | Eine Möglichkeit, die die digitale Kommunikation bietet, ist die Schnelligkeit. Nachrichten werden schneller verbreitet, aber auch in der Kommunikation untereinander profitiert man von der schnellen Kommunikation via SMS, E-Mail und sozialen Netzwerken. Daraus resultiert dann auch eine Veränderung, die die Kommunikation prägt. Und zwar wird man jeden Tag mit digitalen Medien konfrontiert. E-Mails begleiten die meisten Menschen in ihren Berufen, wenn es z.B. um die Auslandskorrespondenz geht. Soziale Netzwerke werden von vielen Menschen, immer häufiger auch sehr jungen Leuten, genutzt. Dabei besteht aber die Gefahr, dass unerfahrene Menschen zunächst mit dem Umgang mit sozialen Netzwerken überfordert sind. Viele Menschen erleben im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken auch Ausgrenzung, Mobbing, diskriminierende Anfeindungen u.v.m. Aber auch Abhängigkeit, meistens bei jungen Menschen, ist eine Gefahr, die durch die Präsenz von digitalen Medien besteht. Dennoch bieten soziale Netzwerke die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Hier besteht aber wiederum die Gefahr von Anfeindungen usw. Neben der Schnelligkeit und freien Meinungsäußerung, die die digitale Kommunikation bietet gibt es noch weitere Vorteile der digitalen Kommunikation. Durch die Globalisierung ist der Kontakt und die Beziehung zu anderen Ländern sehr stark verbreitet worden. Dabei bietet dann die digitale Kommunikation die Möglichkeit mit anderen zu kommunizieren. Durch die schnelle Nachrichtenverbreitung erfährt man aktuelle Ereignisse nicht nur innerhalb des eigenen Landes, sonder auch aus aller Welt. | ||
| + | |||
| + | Die Aussage, dass wir in einer Zeit leben, die von digitaler Unverbindlichkeit geprägt sei, kann man folgendermaßen betrachten: Die digitale Kommunikation an sich bietet viele Vorteile, z.B. die Schnelligkeit der Kommunikation über die verschiedenen Medien wie SMS, E-Mails und soziale Netzwerke. Man hat die Möglichkeit über die Landesgrenze hinweg zu kommunizieren, was viele positive Einflüsse aus anderen Ländern und Kulturen mit sich bringt. Noch nie zuvor war die Kommunikation so einfach und fortschrittlich. Ein Kritikpunkt ist, dass die Generationen, die sich an der digitalen Kommunikation bedienen, bestimmte Verhaltensregeln nicht beachten und Werte verloren gehen. Dazu ist zu sagen, dass dies nicht verallgemeinert werden kann. Z.B ist die Wichtigkeit von Familie und Freunden sehr ausgeprägt. Eine Konsequenz des Nachlasses von verbaler Kommunikation ist die mögliche Vereinsamung und Isolation. In Foren hat man die Möglichkeit seine Meinung zu äußern, dennoch kann daraus auch Hass, Mobbing, Ausgrenzung usw. resultieren. Dabei lassen, wie gesagt, bestimmte Verhaltensregeln immer mehr nach, z.B. der respektable Umgang mit seinen Mitmenschen. | ||
| + | |||
| + | Zu der Überzeugungskraft des Textes ist zu sagen, dass seine Schilderung als subjektiv betrachtet werden muss. Es fehlen z.B. Belege für seine These und z.B. Studien, die seiner Argumentation Aussagekraft verleihen könnte, da dann nicht nur seine Meinung betrachtet wird. Dennoch ist auch zu sagen, dass der Text einen Erfahrungsbericht darstellt, deswegen den Leser emotional von seiner Authentizität überzeugt und auf eine bestehende Problematik hinweist. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Lyrik == | ||
| + | |||
| + | === Analyse "Es ist alles eitel", Andreas Gryphius === | ||
| + | |||
| + | Das Gedicht „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius, welches im Jahr 1637, in der Epoche des Barocks, verfasst wurde, thematisiert die Vergänglichkeit alles Irdischen und historisch gesehen die Zerstörungen, die aus dem 30- jährigen Krieg resultierten. | ||
| + | |||
| + | Der Titel „Es ist alles eitel“ verweist auf das Thema des Gedichts, dass alles vergänglich ist und irgendwann nicht mehr existieren wird. Das Pronomen „alles“ (ebd.) steht verallgemeinernd dafür, dass jedes Lebewesen, jeder Gegenstand, aber auch bestimmte Situationen nicht ewig sind und irgendwann nicht mehr existieren. Das Gedicht besteht aus 14 Versen, welche in insgesamt vier Strophen eingeteilt sind. Die ersten beiden Strophen bestehen jeweils aus vier Versen, werden somit jeweils als Quartett bezeichnet, und die letzten beiden jeweils aus drei Versen und werden somit jeweils als Terzett bezeichnet. Als Versmaß ist durchgängig ein sechshebiger Jambus vorzufinden, was ein Merkmal der literarischen Epoche des Barocks war und als Alexandriner bezeichnet wird. Die erste Strophe beginnt mit dem Personalpronomen „Du“ (V.1), was einen Bezug zum Leser herstellt, ihn also direkt anspricht bzw. ihn direkt mit einbezieht. Die Repetitio „siehst“ (V.1) betont, dass die „Eitelkeit auf Erden“ (V.1) nicht zu übersehen ist. Die „Eitelkeit auf Erden“ (ebd.) bezieht sich auf den Titel des Gedichts und deutet auf die Vergänglichkeit des Lebens hin. Die Tatsache, dass die Vergänglichkeit des Lebens, also das Sterben, das Leid und die Tode, nicht zu übersehen ist, bringt gleichzeitig eine Klage über die derzeitigen Ereignisse, den 30- jährigen Krieg, mit sich. Im nächsten Vers ist davon die Rede, dass das, was heute gebaut werde, morgen wieder zerstört sei (vgl. V. 2). Die Adverbien „heute“ (V. 2) und „morgen“ (V. 2)und die Verben bauen (vgl. V. 2) und einreißen (vgl. V. 2) stehen sich antithetisch gegenüber und verdeutlichen, dass der derzeitige Zustand nicht von Dauer ist und am nächsten Tag oder sogar schon in den nächsten Stunden alles anders sein kann. In dem Zusammenhang ist es der Krieg, der für die Zerstörung sorgt. Eine weitere Antithese ist im nächsten Vers zu finden. „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3), verdeutlicht wieder die Zerstörung der Dinge des derzeitigen Zustands und die Veränderung, die im zukünftigen Zustand herrscht. Die „Wiese“ (ebd.), kann man als ein Symbol für Frieden interpretieren, da es in Städten meistens laut und hektisch ist und auf Wiesen bzw. in der Natur eher Ruhe herrscht. Die zweite Strophe setzt zunächst mit einer Antithese „Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5) ein. Das Verb „blühen“ (ebd.) kann man so interpretieren, dass etwas, sei es ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze, gedeiht und lebt. Dadurch, dass es „zertreten [wird]“ (ebd.), wird das Leben beendet. Somit wird metaphorisch die Vergänglichkeit des Lebens dargestellt. Im nächsten Vers wird antithetisch dargestellt, dass „was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V. 6). Das Verb „pochen“ (ebd.) steht metaphorisch für einen Herzschlag, also für etwas lebendiges. Die Metapher „Asch und Bein“ (ebd.) steht für den Tod. Mittels dieser Antithese wird wieder deutlich gemacht, dass das Leben nicht ewig ist und es „morgen“ (ebd.) vorbei sein könnte. Darauf eingehend ist davon die Rede, dass „Nichts […] ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein“ (V. 7). Die Aufzählung „kein Erz, kein Marmorstein“ (ebd.) betont, dass „nichts“ (ebd.), selbst beständige Gesteine wie Erz und Marmor, für immer existieren werden. Im letzten Vers veranschaulicht die Personifikation 'das lachende Glück' (vgl. V. 8), dass, in diesem Zusammenhang gesehen, die Zeiten vor dem Krieg mit besseren Erinnerungen in Verbindung gebracht werden und man Vorstellungen hat, dass das Leben ohne das Leid, das der Krieg mit sich bringt, bessere wäre. Als Folge würden „bald […] die Beschwerden [donnern]“ (V. 8), was den Unmut und das Verlangen nach Frieden betont. Zum Reimschema der ersten beiden Strophen kann man sagen, dass es sich bei beiden jeweils um einen umarmenden Reim handelt. Die dritte Strophe wird sozusagen mit dem Appell „Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehen“ (V. 9) eingeleitet. Es wird betont, dass Rum nicht das wichtigste im Leben ist, da er schnell wieder vergehen kann. Die darauf folgende rhetorische Frage „Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehen?“ (V. 10) stellt mittels der Metapher „Spiel der Zeit“ (ebd.), was für die Lebenszeit steht, dar, dass diese für den Menschen begrenzt ist. Die Interjektion „Ach“ (V. 11) betont die Zweifel, die beim lyrischen Ich aufkommen. Es fragt anschließend „was ist alles dies, was wir für köstlich achten“ (V. 11). Dadurch wird deutlich, dass nicht die wichtigen Dinge im Leben, wie z.B. der Ruhm, geschätzt werden sollten, da diese ja vergänglich sind und eigentlich keinen Wert haben. Ein Enjambement verbindet schließlich die dritte mit der letzten Strophe, in der weiter auf die Frage eingegangen wird. Hier wird betont, dass das, was man als wichtig erachtet nichts „als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, / als eine Wiesenblum, die man nicht wieder find't“ (V. 12f.) sei. Die „Nichtigkeit“ (ebd.), also die Irrelevanz der Dinge, die man vermeidlich als wichtig empfindet, wird durch die Akkumulation „Schatten, Staub und Wind“ (ebd.) betont. Ein Schatten ist vom Sonnenstand abhängig, Staub kann so klein sein, dass man ihn gar nicht bemerkt und der Wind weht nicht konstant. Auch die Veranschaulichung durch die „Wiesenblum, die man nicht wieder find't“ (ebd.) betont auch die Irrelevanz. Denn eine bestimmte Blume kann man auf einer Wiese mit tausend anderen Blumen nur schwierig wiederfinden. Im letzten Vers beklagt sich das lyrische Ich, dass das, „was ewig ist, kein einig Mensch betrachten [will]“ (V. 14). Die meisten Menschen erkennen also noch nicht, was zu den wichtigen Dingen im Leben gehört und dass an zu vielen unnötigen Dingen, wie z.B. Krieg, festgehalten wird. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend ist zu sagen, dass in dem Gedicht durch Antithesen und Metaphern die Vergänglichkeit alles Irdischen verdeutlicht wird. Anschließend wird die Frage gestellt, ob das, was der Mensch als wichtig betrachtet, z.B. Krieg zu führen und zu gewinnen, die Mühe wert ist. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Analyse "Kleine Aster", Gottfried Benn === | ||
| + | |||
| + | Das Gedicht „Kleine Aster“, welches von Gottfried Benn geschrieben und im Jahr 1912 veröffentlicht wurde und der Epoche des Expressionismus zuzuordnen ist, handelt von der Entindividualisierung des Menschen. | ||
| + | |||
| + | Die Überschrift „Kleine Aster“ weist zunächst nicht auf das Thema des Gedichts hin. Das Adjektiv „klein[...]“ (ebd.) lässt die „Aster“ (ebd.), welche im Herbst blüht, sanft, zierlich und zerbrechlich wirken. Der Herbst wird meistens mit Vergänglichkeit assoziiert, was man als Vorausdeutung auf den Tod interpretieren kann. | ||
| + | |||
| + | Das Gedicht weist kein Metrum und kein festes Reimschema auf. Es lässt sich dennoch in drei Sinnabschnitte gliedern. Im ersten Sinnabschnitt (V. 1- 3) wird zunächst die Situation geschildert. Es ist von „ein[em] ersoffenem Bierfahrer [,der] auf den Tisch gestemmt [wurde]“ (V. 1) die Rede. Daraus kann man schließen, dass die Leiche einer Obduktion unterzogen wird. Der unbestimmte Artikel „ein“ (ebd.) deutet darauf hin, dass die Leiche nur eine von vielen Leichen ist und somit keine Bedeutsamkeit hat. Die Tatsache, dass die Leiche „gestemmt“ (ebd.) wurde, deutet auf einen pietätlosen Umgang hin. In den nächsten Versen wird beschrieben, dass „irgendeiner […] eine dunkelhelllila Aster zwischen die Zähne geklemmt [hatte]“ (V. 2f.). Das Indefinitpronomen „irgendeiner“ (ebd.) steht wieder für die Bedeutungslosigkeit des Menschen, denn es ist einer von vielen gemeint. Der Neologismus „dunkelhelllila“ (ebd.) ist zugleich ein Paradoxon. Der Widerspruch hat eine verwirrende Wirkung, dennoch die Funktion, die Aster in den Fokus zu rücken. Die Skurrilität und Absurdität wird zudem durch die Beschreibung, dass die Blume „zwischen die Zähne geklemmt [wurde]“ (ebd.), verstärkt dargestellt. Das Verb „geklemmt“ (V. 3) bildet einen Reim mit dem Verb „gestemmt“ (V. 1), wodurch der pietätlose Umgang mit der Leiche betont wird. | ||
| + | |||
| + | Der zweite Sinnabschnitt (V. 4- 12) stellt eine detaillierte Schilderung des Vorgehens der Obduktion dar. Der Enjambement „Als ich von der Brust aus / unter der Haut / mit einem langen Messer / Zunge und Gaumen herausschnitt, / muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt / in das nebenliegende Gehirn“ (V. 4- 9) verdeutlicht die Zusammengehörigkeit dieses Teils. Auffällig ist dabei die sachliche und emotionslose Schilderung des Prozesses, was gleichzeitig auf die nicht vorhandene emotionale Bindung des lyrischen Ichs zum Menschen hindeutet. Die Substantive „Brust“ (V. 4), „Haut“ (V. 5), „Zunge und Gaumen“ (V. 7), „Gehirn“ (V. 9) und „Brusthöhle“ (V. 10) kann man dem Wortfeld „Mensch“ zuordnen. Dabei wirkt die objektive Schilderung emotionslos gegenüber dem Menschen als ein Lebewesen. Darauf folgend wird wieder sachlich beschrieben, dass das lyrische ich die Aster „in die Brusthöhle / zwischen die Holzwolle [packte], / als man zunähte“ (V. 1O ff.). Die Sachlichkeit des Vorgangs steht hierbei wieder für die Gleichgültigkeit des lyrischen Ichs gegenüber der Leiche. Die Blume weist, im Gegensatz zur Leiche, eine hohe Bedeutung für das lyrische Ich auf, da sie, anstatt weggeschmissen zu werden, in die Brust der Leiche eingebettet wird. Die Ellipse „als man zunähte“ (V. 12) deutet auf die Irrelevanz des Menschen hin. Durch das fehlende Personalpronomen in dem Satz wird kein näherer Bezug auf die Leiche genommen. | ||
| + | |||
| + | Der letzte Sinnabschnitt (V. 13- 15) verdeutlicht die emotionale Bindung des lyrischen Ichs zu der Aster durch zwei Ausrufe. Dieser beginnt zunächst mit dem Ausruf, „Trinke dich satt in deiner Vase!“ (V. 13). Die Personifikation, dass sich die Blume satt trinken soll (ebd.), deutet auf die Bedeutung der Blume für das lyrische Ich hin. Es hat eine emotionale Bindung zu der Blume aufgebaut und wünscht sich, dass die Blume weiterleben kann. Auch dadurch, dass das lyrische Ich die Aster durch das Personalpronomen „dich“ (V. 13) direkt anspricht, wird die emotionale Bindung deutlich. Die Leiche fungiert nun als Vase für die Blume (vgl. V. 13), sie wird also als ein Gegenstand angesehen und hat somit nur eine funktionale Bedeutung, was die Gleichgültigkeit betont. Der zweite Ausruf „Ruhe sanft, / kleine Aster“ (V. 13 f.), welcher durch einen Enjambement getrennt wird, verdeutlicht die Besorgnis des lyrischen Ichs. Der Enjambement trennt den Ausruf, sodass „kleine Aster“ (ebd.) den letzten Vers bildet. Dadurch, dass die Überschrift im letzten Vers wiederzufinden ist, wird deutlich, dass es nicht um den Menschen geht. Da die letzten Worte des lyrischen Ichs der Aster gelten, wird schließlich wieder die Bedeutungslosigkeit des Menschen deutlich. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend kann man sagen, dass in dem Gedicht durch rhetorische Mittel, wie z.B. Ausrufen und Enjambements, die Gefühlsverbundenheit des lyrischen Ichs zu einer einfachen Blume und die zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber einer Leiche deutlich wird. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Vergleich Vergänglichkeit ("Es ist alles eitel" und "Kleine Aster") === | ||
| + | |||
| + | Die Gedichte „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius, welches im Jahr 1637 verfasst wurde und der Epoche des Barocks zuzuordnen ist, und „Kleine Aster“ von Gottfried Benn, welches im Jahr 1912 verfasst wurde und dem Expressionismus zuzuordnen ist, thematisieren die Vergänglichkeit. Beide Gedichte weisen trotz der selben Thematik wesentliche Unterschiede auf. | ||
| + | |||
| + | Im Gegensatz zu Benns Gedicht thematisiert das Gedicht von Gryphius die Vergänglichkeit im Allgemeinen. Historisch gesehen basiert das Gedicht auf dem 30- jährigen Krieg. Wesentliche Elemente des Vanitas- Gedankens, memento mori und carpe diem, findet man deswegen in dem Gedicht wieder. Man lebte mit dem Gedanken, dass jeder Tag der letzte sein könnte. Die ersten beiden Strophen beinhalten Gegenüberstellungen (vgl. V. 2+3+5+6), die veranschaulichen, dass nichts so bestehen bleibt, wie man es erschaffen hat bzw. wie man es kennt. Einerseits ist damit die Zerstörung und Vergänglichkeit gemeint (vgl. V. 2+5+6), andererseits wird auch die Hoffnung auf Frieden zum Ausdruck gebracht (vgl. V. 3). In den letzten beiden Strophen wird die Bedeutung des Lebens hinterfragt und ob das, was man für wichtig hält, tatsächlich von hoher Bedeutung ist. Schließlich kommt das lyrische Ich zu dem Entschluss, dass das „was ewig ist, kein einig Mensch betrachte[t]“ (V. 14). Hier wird auf das Überirdische angespielt, also auf Gott, und dass dieser ewig ist. | ||
| + | Benns Gedicht thematisiert die Vergänglichkeit des Menschen als ein Individuum. Während der Epoche des Expressionismus, ca. 1910- 1925, wurden die Menschen durch die zunehmende Industrialisierung und Verstädterung verunsichert. In Benns Gedicht wird die Bedeutungslosigkeit des Menschen durch den emotionslosen Umgang eines Pathologen mit einer Leiche veranschaulicht. Dazu kommt, dass dieser eine emotionale Bindung zu einer Aster aufbaut, die er in der Leiche findet. Diese Gegenüberstellung, dass eine Blume eine höhere Bedeutung hat als ein Mensch, betont die Bedeutungslosigkeit des Menschen um ein weiteres. | ||
| + | |||
| + | Zum formalen Aspekt ist bei Gryphius' Gedicht zu sagen, dass es sich um ein Sonett handelt. Dabei ist eine festgelegt Form vorzufinden: Das Gedicht ist in vier Strophen eingeteilt, die ersten beiden haben jeweils vier Verse und die beiden letzten haben jeweils drei Verse. Die ersten beiden Strophen bilden dabei jeweils einen umarmenden Reim und die letzten beiden eine Schweifreim. Bei dem Metrum handelt es sich um einen Alexandriner, also einem sechshebigen Jambus mit einer Zäsur, mit abwechselnd männlichen und weiblichen Kadenzen. Die Regelmäßigkeit und feste Form kann man so deuten, dass die Zerstörung durch den Krieg ein zu der Zeit ein Dauerzustand war. Zur Sprache ist zu sagen, dass die Zäsuren durch ein Komma hervorgehoben werden, was zusätzlich die Funktion hat, die Gegenüberstellungen und damit die Vergänglichkeit zu verdeutlichen (vgl. V. 2). Die Verwendung von Metaphern „Schatten, Staub und Wind“ (V. 12) dienen auch zur Veranschaulichung der Vergänglichkeit. | ||
| + | Bei Benns Gedicht sind kein Reimschema, kein Metrum und keine Strophen vorhanden. Dies betont die Orientierungslosigkeit der Menschen zur Zeit der Industrialisierung. Der pietätlose Umgang mit der Leiche wird unter anderem durch die Verben „gestemmt“ (V.1) und „geklemmt“ (V. 3), die in dem ganzen Gedicht zur Betonung den einzigen Reim bilden, beschrieben. Fehlende Pronomen (vgl. V. 12) und Indefinitpronomen (vgl. V. 1+2) verdeutlichen die fehlende Identität des Menschen sowie die sachliche Beschreibung der Obduktion (vgl. V. 4 ff.) die Gleichgültigkeit betont. Die emotionale Bindung zu der Aster wird durch Ausrufe (vgl. V. 13 ff.) dargestellt. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Thematik der Vergänglichkeit in den unterschiedlichen Epochen, basierend auf den unterschiedlichen historischen Ereignissen, jeweils anders interpretiert wurde. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Gryphius „Es ist alles eitel“'' | ||
| + | |||
| + | Thema: Vergänglichkeit im Allgemeinen | ||
| + | |||
| + | → Vergänglichkeit Materialien, alles was der Mensch aufgebaut hat, der Mensch selber, Werte (Ruhm, Geld etc.) | ||
| + | |||
| + | - Fragestellung: Was ist wirklich wichtig? Was ist ewig? | ||
| + | |||
| + | - historischer Hintergrund 30- jähriger Krieg | ||
| + | |||
| + | - Distanz zu Unvergänglichem | ||
| + | |||
| + | sprachlich-formal: | ||
| + | |||
| + | - Sonett | ||
| + | |||
| + | - 14 Verse, eingeteilt in 4 Strophen | ||
| + | |||
| + | → 1./ 2. Strophe jeweils 4 Verse, jeweils umarmender Reim; 3./ 4. Strophe jeweils 3 Verse, bilden einen Schweifreim | ||
| + | |||
| + | - Rhythmus: Alexandriner → 6- hebiger Jambus mit Zäsur | ||
| + | |||
| + | - Interpunktionen verdeutlichen Zäsur; Gegensätze werden beschrieben, die Vergänglichkeit betonen (vgl. V. 2+3++5+6) | ||
| + | |||
| + | ''Benn „Kleiner Aster“'' | ||
| + | |||
| + | Thema: Vergänglichkeit des Menschen als ein Individuum | ||
| + | |||
| + | - Wertlosigkeit des Menschen/ emotionsloser Umgang dargestellt durch: Verben, die pietätlosen Umgang beschreiben; Enjambement, der Prozess einer Obduktion sachlich beschreibt | ||
| + | |||
| + | - Aster nimmt eine höhere Bedeutung eingeteilt | ||
| + | |||
| + | → Emotionen z.B. durch Ausrufe dargestellt | ||
| + | |||
| + | - Orientierungslosigkeit des Menschen durch technischen Fortschritt | ||
| + | |||
| + | - kein Reimschema -> Orientierungslosigkeit | ||
| + | |||
| + | sprachlich-formal: | ||
| + | |||
| + | - 15 Verse, keine Strophen (evtl. Sinnabschnitte: V. 1-3; 4- 12; 13- 15) | ||
| + | |||
| + | - kein festes Reimschema; Ausnahme: V. 1+3 → Betonung pietätloser Umgang | ||
| + | |||
| + | - kein Metrum | ||
| + | |||
| + | - Entpersonalisierung durch fehlende Pronomen (z.B. V. 12), Indefinitpronomen (V. 1+2) | ||
| + | |||
| + | - skurrile Wirkung (z.B. V. 2+3) | ||
| + | |||
| + | - sachliche Beschreibung (Enjambement): Gleichgültigkeit | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Analyse "Untreu", August Stramm === | ||
| + | |||
| + | Das Gedicht „Untreu“ von August Stramm, veröffentlicht im Jahr 1915, in der Epoche des Expressionismus, thematisiert Vertrauensbruch und den Zerfall einer Beziehung. | ||
| + | |||
| + | Aus dem Titel des Gedichts kann man schließen, dass das lyrische Ich hintergangen wurde. Der erste Sinnabschnitt (V. 1-3) wird mit „Dein Lächeln weint in meiner Brust“ (V. 1) eingeleitet. Mit dem Possessivpronomen „dein“ (ebd.) spricht das lyrische Ich seinen Partner direkt an. Die Personifikation „Lächeln weint“ (ebd.) stellt gleichzeitig ein Paradoxon dar, welches die Trauer des lyrischen Ichs um den Partner betont. Die Darstellung, dass das Lächeln in seiner Brust weine (vgl. V. 1), also an der Stelle wo das Herz liegt, betont die Liebe und die Verbundenheit, die das lyrische Ich empfunden hat. Die Beschreibung der „glutverbissnen Lippen“ (V. 2), steht für die Leidenschaft die zwischen den Geliebten herrschte. Diese „eisen“ (V. 2) nun, was antithetisch zu den „glutverbissnen Lippen“ (ebd.) steht und die nachlassenden Gefühle und die zunehmende Kälte, also die Gleichgültigkeit gegenüber dem Partner, ausdrückt. Der Ausruf „Im Atem wittert Laubwelk!“ (V. 3) steht metaphorisch für Vergänglichkeit. Im Herbst fängt das Laub an zu welken - „Laubwelk“ (ebd.) - und den Herbst assoziiert man häufig mit Vergänglichkeit. Das Verb „wittert“ (ebd.) lässt auf eine Vorahnung des lyrischen Ichs schließen, also das es mit der Beziehung abschließen will. | ||
| + | |||
| + | Im zweiten Sinnabschnitt (V. 4- 8) geht es darum, dass das lyrische Ich mit dem Vertrauensbruch und der Beziehung abschließt. Die Metapher „ Dein Blick versargt“ (V. 4), deutet auf diesen Abschluss mit einer düster wirkenden Stimmung hin. Zunächst spricht das lyrische Ich seinen Partner mit dem Possessivpronomen „dein“ (ebd.) wieder direkt an. Das Verb „versargt“ (ebd.) ist ein Neologismus, der sich von dem Substantiv „Sarg“ ableitet. Daraus ist zu schließen, dass das lyrische Ich seine Trauer über den Vertrauensbruch des Partners begräbt. Gleichzeitig assoziiert man einen Sarg mit einer Beerdigung und somit auch dem Tod, was an dieser Stelle für eine düstere Stimmung sorgt. Die Konjunktion „und“ (V. 5) bildet einen eigenen Vers, was eine betonende Wirkung hat. Es wird eine Überleitung zum nächsten Vers geschaffen. Dort heißt es, dass „polternd[e] Worte“ (V. 6) folgen. Das Verb „polternd“ (V. 6) löst eine unruhige Stimmung aus, was man auch als Wut, die das lyrische Ich verspürt deuten kann. Das Verb „vergessen“ (V. 7) bildet zur Betonung auch einen eigenen Vers. Betont wird, dass das lyrische Ich einerseits vergessen will, was vorgefallen ist, andererseits möchte es die Beziehung hinter sich lassen. Ein weiterer Ausruf, „Bröckeln nach die Hände!“ (V. 8), veranschaulicht den Schock des lyrischen Ichs. Das Verb „bröckeln“ (ebd.) kann nebenbei auch für den Zerfall der Beziehung stehen. | ||
| + | |||
| + | Der letzte Sinnabschnitt (V. 9- 12) wird anhand des „Klaudsaum[s]“ (V. 10) deutlich, dass das lyrische Ich von einer Frau hintergangen wurde. Mit „Frei / Buhlt dein Kleidsaum“ (V. 9f.) sagt das lyrische Ich aus, dass es nichts mehr mit seiner Geliebten zu tun haben will und somit die Beziehung endgültig beendet. Das Adjektiv „frei“ (ebd.) hat dabei eine betonende und einleitende Funktion. Das Verb „buhlt“ (ebd. ) bedeutet, dass jemand eine Liebschaft hat, in dem Zusammenhang heißt das also, dass das lyrische Ich von der Liebschaft der Geliebten weiß und sich mehr oder weniger abwertend von ihr abwendet. Der letzte Vers bildet einen Ausruf „Drüber rüber!“ (V. 12), was die Abwendung des lyrischen Ichs von der Beziehung ausdrückt. Die Adverbien „drüber“ (ebd.) und „rüber“ (ebd.) sind umgangssprachlich und bedeuten in dem Zusammenhang so viel wie „über etwas hinweg sein“. | ||
| + | |||
| + | Zur Form ist zu sagen, dass das Gedicht aus zwölf Versen besteht und keine Strophen aufweist. Zudem gibt es kein Reimschema und auch kein Metrum. Auffällig ist dennoch, dass das Gedicht viele Enjambements aufweist. Dies hat eine beschreibende Wirkung über die Situation in der sich das lyrische Ich sich befindet. Außerdem wird dadurch die Gefühlslage, Trauer und Entsetzen über den Betrug der Geliebten, verdeutlicht. | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Gefühle, die bei einem Vertrauensbruch aufkommen durch Metaphern und Ausrufe dargestellt werden. Die entsetzliche Lage und das Chaos der Gefühle, die das lyrische Ich empfindet wird durch das fehlende Reimschema und Metrum und durch die Enjambements verdeutlicht. | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2018, 12:55 Uhr
Faust
Inhaltsangabe
Die Tragödie beginnt damit, dass Gott und Mephistopheles eine Wette abschließen. In dieser Wette geht es darum, ob Mephistopheles es schafft Faust vom richtigen Weg abzubringen. Faust leidet an Wissensdurst und ist unzufrieden, da er auf die Frage nach dem Sinn des Lebens keine Antwort findet. Er beschließt sich umzubringen, wird jedoch durch das läuten der Osterglocken daran gehindert. Nach einem Spaziergang am nächsten Tag folgt ihm ein Hund nach Hause. Der Hund verwandelt sich in Mephistopheles. Er schließt mit Faust einen Deal ab in dem er Faust anbietet ihm zu dienen und im Gegenzug seine Seele erhält, wenn er es schafft ihn glücklich zu machen. Später sind sie in einer Hexenküche, wo Faust einen Trank zur Verjüngung trinkt. Danach sieht Faust zum ersten Mal Gretchen und spricht sie an, wird dann aber abgewiesen. Jetzt soll Mephistopheles Gretchens als Fausts Geliebte besorgen. Sie besuchen Gretchens Haus und lassen ihr Schmuckkästchen als Geschenk da. Um die Nachbarin Marthe abzulenken soll sich Mephistopheles ihr annähern. Er erzählt ihr, dass ihr Mann tot sei und sie findet schließlich Gefallen an ihm. Faust und Gretchen haben nun die Gelegenheit sich zu treffen und dort kommt es auch zu ihrem ersten Kuss. Faust bittet Gretchen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie die Nacht miteinander verbringen können. Daraufhin stirbt die Mutter von dem Trank. Zwischen Faust und Gretchens Bruder Valentin kommt es zu einem Duell, da er erfahren hat, was zwischen den beiden in der Nacht lief. Faust tötet dabei Valentin und flieht. Gretchen geht zur Kirche, wo ihr ein Geist erscheint und ihr mitteilt, dass sie schwanger ist. Einige Zeit später erfährt Faust, dass Gretchen zu Tode verurteilt wurde. Er will sie retten, bricht dafür in den Kerker ein und versucht sie zu überzeugen mit ihm zu fliehen. Sie verneint dies aber, weil sie nicht noch mehr Ärger anrichten will. Zum Schluss wendet sie sich an Gott, der sie von ihren Sünden erlöst und Faust flieht mit Mephistopheles.
"Nacht" VV. 353- 385
Die vorliegende Textstelle der Tragödie "Faust" von Johann Wolfgang Goethe, veröffentlicht im Jahr 1808, handelt von Faust, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist.
Faust, der sich sein Leben lang mit dem Studieren der Wissenschaften beschäftigt hat, kann sich nicht damit zufriedenstellen. In dem Monolog klagt er darüber, wie wenig er vom wirklich Wichtigem weiß. Aus dem Grund möchte er mit Hilfe der Geister herausfinden, was der Sinn des Lebens ist.
Nach den drei Prologen ist diese Textstelle die eigentlich Einleitung des Dramas. Sie stellt den Protagonisten, Faust, und seine Lage vor. Durch seine Unzufriedenheit kommt es dazu, dass er für Mephistopheles ein leichtes Opfer ist und seinem vorgeschlagenem Pakt, Mephistopheles seine Seele zu geben, wenn Mephistopheles es schafft ihn glücklich zu machen, zustimmt. Durch Mephistopheles nimmt Faust einen Trank zur Verjüngung zu sich und lernt Gretchen kennen. Nachdem Faust ihre Aufmerksamkeit nach dem ersten Versuch nicht bekommt, versucht er es weiter mit Geschenken. Gretchen hat Interesse an ihm und durch Mephistopheles kommt es zu einem Treffen. Das zweite Treffen findet nur durch eine List statt, bei der Gretchens Mutter ihr Leben verliert. Auch Gretchens Bruder stirbt bei einem Duell gegen Faust, da er erfahren hat, dass Gretchen schwanger ist. Nach einiger Zeit erfährt Faust dann, dass Gretchen wegen Mord an ihrem Kind im Gefängnis gelandet ist und er versucht sie daraufhin zu retten. Sie aber willigt nicht ein und überlässt sich somit dem Henker während Faust und Mephistopheles fliehen. Am Anfang erkennt man als Reimschema einen Kreuzreim. Danach folgen ausschließlich Paarreime. Dies kann man am folgendem Beispiel festmachen:
„Habe nun, ach! Philosophie, A
Juristerei und Medizin, B
Und leider auch Theologie! A
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. B
Da steh ich nun, ich armer Tor! C
Und bin so klug wie zuvor;“ (VV.354-356) C
Die Textstelle beginnt damit, dass Faust alle Wissenschaften aufzählt, die er studiert hat(vgl. VV.354-365). Die Synästhesie "heißes Bemühn" (V.375) zeigt dabei wie wichtig Faust dies war. Allerdings ist er nicht glücklich damit, da er der Meinung ist vom wirklich Wichtigem "nichts wissen [zu] können" (V.364). Seine Unzufriedenheit und Verzweiflung der Unwissenheit wird zum Beispiel durch die Ausrufe "Habe nun, ach!" (V.354), "Da stehe ich nun, ich armer Tor!" (V.357) zum Ausdruck gebracht. Er zweifelt an sich und bezeichnet sich selber als ein "Tor" (V.358), was so viel ist wie ein Narr oder ein nichts wissender Mensch. Er zweifelt auch am Sinn daran seinen Schülern etwas beizubringen, was für ihn keinen Wert hat. Er hat dabei das Gefühl seine Schüler anzulügen, was er durch die Metapher "an der Nase herum[führen]" (V.363) zum Ausdruck bringt. Das Wissen, "nichts wissen [zu] können" (V.364) löst bei ihm außerdem Wut aus. Die Metapher, "das Herz verbrennen" (V.365) steht in dem Zusammenhang für das Gefühl der Wut, da er trotz des Studiums nichts erreicht hat. Er selber hält sich für "gescheitert als alle Laffen, /Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen" (V.366f.), was über seine Person aussagt, dass er arrogant ist. Dann folgt die Anapher "bilde mir nicht ein was Rechts zu wissen" (V.371) und "bilde mir nicht ein ich könnte was lehren" (V.372), welche noch einmal seine Unzufriedenheit als Lehrer betont. Faust ist zwiegespalten, da er einerseits der Meinung ist intelligenter zu sein als manch Anderer, andererseits aber weiß, nicht alles wissen zu können und nichts wichtiges lehrt. Faust beschließt sich "der Magie [zu] ergeben" (V.377) und hofft auf eine Antwort auf die Frage "was die Welt / im Innersten zusammenhält" (V.382f.). Der letzte Satz drückt Fausts Wunsch aus endlich den Sinn des Lebens zu verstehen und nicht mit leeren Worten alles erklären zu müssen.
Die Textstelle verdeutlicht Fausts Zwiespalt und die damit verbundene Verzweiflung. Er ist einerseits der Meinung intelligent zu sein, aber andererseits kann er es nicht verarbeitet, dass er nur einen geringen, unwichtigen Teil des Lebens versteht und sonst rein gar nichts. Die Textstelle ist die Basis für die folgende Handlung. Es kommt zum Teufelspakt, dem Faust wegen seiner Unzufriedenheit mit seinem Leben zustimmt und die Handlung nimmt ihren Lauf.
"Gretchens Stube"(VV.3374-3413)
Die Tragödie "Faust" von Johann Wolfgang Goethe, veröffentlicht 1808, handelt von Faust, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist.
Die Textstelle VV. 3374-3413 handelt von Gretchen, die zu Hause ein Gedicht/Lied über ihr Sehnsucht nach Faust vorträgt. In dem Gedicht/Lied beschreibt sie, dass sie vor Faust ein normales Leben hatte und er es verändert hat. Ohne ihn fühlt sie sich einsam und ihre Gedanken und Gefühle spielen verrückt. Sie ist verzaubert von seiner Gestalt und sehnt sich nach ihm.
Dadurch, dass Faust durch seine Verzweiflung sich dazu entschied dem Teufelspakt zuzustimmen und sich als erste Maßnahme Verjüngern ließ, kam es zur ersten Begegnung zwischen Faust und Gretchen. Daraufhin folgten Geschenke an Gretchen und schließlich auch das erste Treffen zwischen den beiden. In dieser Textstelle wird sie sich Gefühlen zu Faust bewusst und gibt diesen nach. Dadurch vergiftet sie durch Fausts Einfluss ihre Mutter um mit ihm die Nacht in Ruhe verbringen zu können. Dabei wird sie ungewollt schwanger. Ihr Bruder, der ahnt, was geschehen ist, fordert Faust zum Duell heraus und wird dabei umgebracht. Faust flieht und erfährt nach einer Eingebung, was Gretchen widerfahren ist. Sie bekam ihr Kind, brachte es um und landete im Gefängnis, zum Tode verurteilt. Faust plant einen Rettungsversuch, der aber daran scheitert, dass Gretchen nicht noch mehr Schuld auf sich laden will und seinen Rettungsversuch ablehnt. Faust flieht und Gretchen stirbt.
Das Gedicht/Lied besteht aus 10 Strophen mit jeweils vier Versen. Davon wiederholt sich eine Strophe dreimal und bildet somit einen Refrain. Der Refrain handelt von Gretchens Leben bevor sie Faust kennengelernt hat und dass sie ein ruhiges Leben hatte (vgl. V. 3374). Als sie Faust kennengelernt hat, hat sich ihr Leben in sofern geändert, dass sie nun ihre Ruhe nicht mehr findet(vgl. V. 3375). Dies verdeutlicht auch der Klimax: "Ich finde sie nimmer/ und nimmermehr"(V. 3376 f.). Die zweite Strophe handelt davon, dass Gretchen sich einsam fühlt und das Gefühl hat, dass sie ohne ihn nicht Leben kann (vgl. V. 3379) und sie sich eine Welt ohne ihn nicht vorstellen kann (vgl. V. 3381 f.). Die dritte Strophe handelt davon, dass sie nicht klar denken kann und ihre Gefühle verrückt spielen. Die Anaphern "mein armer Kopf/mein armer Sinn" (vgl. V. 3382 u. V. 3384) und "ist mir verrückt/ist mir zerstückt" (vgl. V. 3383 u. V.3385) verdeutlichen, dass sie verliebt ist. Beiden Strophen thematisieren Gretchens Selbstbeschreibung. Danach folgt wieder der Refrain. Die fünfte Strophe beschreibt Gretchens Sehnsucht nach Faust und ihrer entstehende Abhängigkeit. Auch hier betont eine Anapher Gretchens Handeln, welches sich nur nach Faust richtet (vgl. V. 3390 u. V. 3392). Die darauf folgende Strophe handelt von der Beschreibung Fausts und wird auch hier mit Hilfen einer Anapher betont (vgl. V.3394-3397). Gretchen beschreibt Faust dabei als angesehen (vgl. V. 3395) und als edel (vgl. V. 3395). Außerdem fasziniert Gretchen "seines Mundes Lächeln" ( V. 3396) und "seiner Augen Gewalt" (V. 3397). Hierbei wird auch deutlich, dass Faust ihr gegenüber charmant ist, was sich durch sein Lächeln und die Beschreibung seiner Augen festmachen lässt. In der nächsten Strophe steigert sich die Beschreibung Fausts und Gretchen beschreibt, von seinen Worten verzaubert zu sein (vgl. V.3398). Sie schwärmt von seinen Berührungen, was an dem Ausruf " Und ach sein Kuss"(V. 3401) festzumachen ist. Nun folgt die zweite Wiederholung des Refrains. Durch die Wiederholungen wird Gretchens Verzweiflung deutlich gemacht. Sie stehen im Kontrast zu den Strophen, welche beschreiben, dass sie sich sehr nach Faust sehnt. Der Refrain beschreibt aber die Veränderung in ihrem Leben und dass sie auch gerne an ihrer Vergangenheit festhalten will. Beides ist aber nicht möglich. Die letzten beiden Strophen beschreiben Gretchens Reaktion, dass sie alles machen möchte, was eine Geliebte machen würde. Hier macht der Ausruf "Ach dürft ich fassen/und halten ihn!"(V. 3408f.) ihre Sehnsucht nach seiner Nähe deutlich.
Das Lied/Gedicht handelt hauptsächlich von Gretchens Einsamkeit und Sehnsucht nach Faust. Einsamkeit und Sehnsucht waren Merkmale der Romantik, einer Epoche, in der die Tragödie unter Anderem verfasst wurde. Zusammenfassend kann man sagen, dass in dieser Textstelle Gretchens Liebe zu Faust deutlich wird und sie bereit ist alles für ihn zu tun.
Abschrift der 1. Klausur
Die Tragödie „Faust 1, erster Teil“ von Johann Wolfgang Goethe, veröffentlicht 1808 und geschrieben in den Epochen Sturm und Drang und Klassik, thematisiert die Suche nach dem Sinn des Lebens.
Der vorliegende Textauszug „Wald und Höhle“ handelt von Fausts Monolog, in dem er sich seiner Unsicherheit gegenüber seinem derzeitigen Leben bewusst wird und mögliche Gefahren erkennt.
Zuvor litt Faust an Wissensdurst, wodurch er beschloss sich umzubringen. Nach einem Spaziergang folgt Mephistopheles, der Teufel, Faust nach Hause und bietet ihm einen Pakt an, ihm zu dienen und ihm zu seinem Lebensglück zu verhelfen. Faust soll ihm im Gegenzug seine Seele versprechen. Faust willigt schließlich ein. Nach einer Verjüngung trifft Faust auf Gretchen und beauftragt Mephistopheles, sie als seine Geliebten zu gewinnen. Somit kommt es auch zu ihrem ersten Treffen. Nach der Szene „Wald und Höhle“ kommt es dazu, dass Faust Gretchen dazu bringt ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit er und Gretchen miteinander schlafen können. Die Mutter stirbt und Gretchen wird ungewollt schwanger. Nachdem Faust Valentin, Gretchens Bruder, in einem Duell getötet hat, muss er fliehen. Nach einiger Zeit erfährt er, dass Gretchen ihr Kind umgebracht hat und somit im Gefängnis gelandet ist. Faust plant mit Mephistopheles einen Rettungsversuch, dem Gretchen aber nicht zustimmt. Am Ende flieht Faust mit Mephistopheles und Gretchen überlässt sich dem Tod.
Der Textauszug ist ein Monolog Fausts und spielt im Wald und in einer Höhle. Er besteht aus 36 Versen; VV. 1-24 handeln von Fausts Unsicherheit da er nicht weiß, wie er mit dem neu kennengelernten schönem Leben umgehen soll. Die Verse VV. 26-36 handeln von der Erkenntnis, dass die vermeintlichen Vorteile des Lebens eine Gefahr für ihn darstellen. Es gibt kein Reimschema und das Versmaß stellt einen 5-hebigen Jambus dar, der die Harmonie ausdrückt. Faust leitet den Monolog damit ein, indem er den „erhabne[n] Geist“ (V.1) anspricht, welcher eine übernatürliche Macht, einen Gott, darstellt. Er spricht davon, dass er ihm alles gab worum er bat(vgl. V. 1 f.). Er scheint zufrieden mit diesem Leben zu sein, dennoch erkennt er darin auch, dass dies nicht ausschließlich Vorteile hat (vgl. VV.2f.). Betont wird diese Aussage unter Verwendung eines Enjambements (vgl. VV. 1-3). Die Metapher „Natur“ (V.5) wurde verwendet um das Leben, die Liebe und alles, was Faust sich ersehnt, zu beschreiben. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er „[die] Kraft, sie zu fühlen, zu genießen“ (V.6). Er empfindet das Leben nicht als „kalt“ (V.7), er betrachtet es wie einen Freund (vgl. V. 9). Dann kommt es zu einem Wendepunkt. Durch Wörter des Wortfeldes „Natur“ (vgl. VV.13-16) werden die Nachteile des vermeintlich positiven Lebens beschrieben. Dieser Gegensatz, zwischen dem zuvor und danach beschriebenen Empfinden des Lebens, zeigt Fausts Unsicherheit und die Zerrissenheit sich einer Seite hinzugeben. Betont wird dieses Empfinden durch die Verben „stürzend“ (V.14), „quetschend“ (V.15) und „donnernd“ (V.16), die Faust als bedrückt und besorgt beschreiben. Er erkennt somit die Gefahren, die ihm bevorstehen, wenn er sich an die Menschen bindet, die er liebt (vgl. VV.10-12). Er kommt schließlich zu dem Entschluss, dass es in seiner „Höhle“ (V.17), welche für sein Studierzimmer bzw. sein bisher geführtes Leben steht, am sichersten ist (vgl. V.17). Er erkennt den Unterschied, er erkennt sich selbst (vgl. V.18), sein eigenes Leben und dass das Leben „geheime tiefe Wunder“ (V.19) bietet, die für Faust neu sind. Faust, der sich in Gretchen verliebt hat, zweifelt daran, dass etwas daraus wird, weil ihm auch der Pakt mit Mephistopheles im Weg steht. So kommt er zu dem allgemeinen Entschluss, „dass dem Menschen nichts Vollkommnes wird“ (V.26). Dass er den „Göttern nah und näher“ (V.28) gebracht wurde und er sich verliebt hat (vgl. VV.29 f.), ist also nur ein Schein, welcher vergänglich sein wird. Faust erkennt, dass Mephistopheles dafür gesorgt hat, dass er glücklich wird und Gefallen am Leben findet (vgl. V. 33), davon aber nichts echt sein kann. Würde er auf diese List hereinfallen, würde er durch seinen Willen in einen Genuss verfallen, aus dem er auch nicht mehr herausfindet, da Genuss zu noch mehr Begierde führt (vgl. VV. 35 f.). Dadurch könnte er die Wette mit dem Teufel verlieren. Dies ist Faust bewusst, dennoch taumelt (vgl. V.35) er, was seine Unentschlossenheit zum Ausdruck bringt und dass die neue Seite in seinem Leben das Interesse in ihm geweckt hat und somit eine verlockende Gefahr darstellt. Man findet im gesamten Textauszug immer wieder Motive des Wortfeldes „Natur“. Über Faust kann man somit sagen, dass er ein zur Natur hingezogener Mensch ist, was man damit belegen kann, dass er über die Fragestellung, ob sein derzeitiges Leben vollkommen ist, im Wald nachdenkt. Außerdem beschreibt er die Nachteile seines derzeitigen Lebens als eine Riesenfichte, die stürzt und alle Nachbaräste mitreißt (vgl. V.14), was man so deuten kann, dass der Pakt mit dem Teufel Opfer bringt.
Zusammenfassend kann man über den Textauszug sagen, dass hier der Genuss des Lebens eine Gefahr für Faust darstellt und ihm das bewusst wird. Einerseits genießt er es glücklich zu sein, da er Gretchen gefunden hat, die er liebt. Andererseits weiß er aber, dass er Gretchen ohne die Hilfe von Mephistopheles nie kennengelernt hätte und das Zusammentreffen der beiden nur zu seinem Plan gehört um die Wette zu gewinnen. Deutlich werden hier innere Vorgänge eines Menschen, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist.
Feedback: Ich finde, die Abschrift deiner Analyse ist dir gut gelungen. Du hast alle nötigen Aspekte genannt. Vielleicht kannst du das nächste Mal darauf achten, dass du nicht mehr so viele indirekte Zitate verwendest, sondern mehr direkte. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass du dich meiner Meinung nach zu wenig mit dem Inhalt beschäftigt hast, du hast zwar gut analysiert jedoch nennst du nicht dass Faust zum Erdgeist spricht, sondern vergleichst alles mit seiner Liebe zu Gretchen und beziehst dich sehr oft darauf.
Woyzeck
Inhaltsangabe
Das Drama „Woyzeck“ wurde von Georg Büchner geschrieben und im Jahr 1879 veröffentlicht. Das Stück handelt von Woyzeck, der wegen Demütigung und Betrug seine Freundin umbringt.
Woyzeck ist ein armer Soldat, der zusammen mit seiner Freundin Marie ein uneheliches Kind hat. Er versucht mit allen Mittel, vor Allem durch die Verrichtung niedriger Arbeit, Geld zu verdienen und somit seine Familie zu ernähren. Immer wieder wird er bei seiner Arbeit gedemütigt. Trotz seiner Bemühungen für die Familie, betrügt Marie ihn mit dem Tambourmajorn. Woyzeck lässt sich darauf ein, einem Arzt als Versuchsobjekt zu dienen und erhofft sich mit dem verdienten Geld Marie an sich zu binden. Sie wiederrum führt weiterhin eine Affäre mit dem Tambourmajorn. Woyzeck wird durch die Versuche des Arztes und die Demütigung durch den Tambourmajorn physisch und psychisch immer schwächer. Aufgrund seiner Eifersucht beschließt Woyzeck Marie umzubringen. Er kauft sich ein Messer, lockt sie in den Wald und bringt sie um. Bei der Rückkehr ins Dorf wird er blutverschmiert entdeckt. Daraufhin ergreift er die Flucht und versenkt das Messer in einem Teich. Zum Schluss wird Maries Leiche entdeckt.
"Der Hessische Landbote"-Sachtextanalyse
Die Flugschrift „Der Hessische Landbote“, geschrieben von Georg Büchner und überarbeitet von Friedrich Ludwig Weidig, wurde im Jahr 1834 veröffentlicht. Thematisiert wird die Spanne zwischen der oberen und der unteren Gesellschaftsschicht.
Die Textstelle Z.70- Z.128 handelt von der Stellung des Volkes, Fürsten und Adligen im Großherzogtum Hessen, aber auch in ganz Deutschland, und die Forderung nach einer Revolution. Man kann die Textstelle in folgende fünf Sinnabschnitte gliedern: In Z.70- Z.77 bezieht Georg Büchner sich auf die zuvor genannte Statistik, in der die Abgaben des Volkes an das Großherzogtum veranschaulicht wurde. Er ruft dazu auf, sich anzusehen, was das Großherzogtum darunter versteht, eine Ordnung einzuhalten (vgl. Z.70- 72) und macht deutlich, dass „700000 Menschen […] dafür 6 Millionen [bezahlen] […], damit sie in Ordnung leben (Z.72- 75). Er beschreibt, dass das Großherzogtum die Bevölkerung zu „Ackergäulen und Pflugstieren“ (Z.74) macht, wodurch er deutlich macht, dass die Regierung die Bevölkerung ausnutzt und sie darunter sogar leiden muss (vgl. Z.76f.). Den Sinnabschnitt Z.78- Z.89 leitet er durch eine rhetorische Frage ein, wer für die Ordnung verantwortlich ist und dafür sorgt, dass diese eingehalten wird (vgl. Z.78- 80). Er beschreibt, dass die Großherzogliche Regierung von dem Großherzog und seinen obersten Beamten gebildet wird (vgl. Z.80- 82). Diese wiederum haben im Land diverse Vertreter, die dafür sorgen, dass die Ordnung eingehalten wird (.vgl. Z.83- 89). Danach beschreibt er in Z.90- Z. 99 die Stellung des Volkes im Vergleich zu der Regierung mit Hilfe einer Metapher: „Das Volk ist ihre Herde, sie sind seine Hirten“ (Z.89- 90). Dennoch ist damit nicht gemeint, dass die Regierung sich gut um das Volk kümmert, sondern, dass sie „Melker und Schinder“ (Z.89f.) sind, das Volk also für ihr eigenes Wohlergehen ausnutzt. Des weiteren verdeutlicht eine Aufzählung (vgl. Z.91- 94), dass die Fürsten und Adligen auf Kosten des Volkes lebt. Er betont, dass sie es sich erlauben zu herrschen und das Volk dazu zwingt sich ihnen zu untergeben (vgl. Z.94f.). Durch eine Hyperbel betont er, dass die Regierung „die Mühe [hat], [das Volk] zu regieren“ (Z. 97). Dazu erläutert er, dass man nicht vom Regieren reden kann: Sie lassen sich vom Volk versorgen und nehmen ihnen alle Menschen- und Bürgerrechte (vgl. Z. 98f.). Im vorletzten Sinnabschnitt, Z.100- Z.118, veranschaulicht Weidig, dass das Großherzogtum sagt, „diese Regierung sei von Gott“ (Z.101), dies aber nicht stimmt (vgl. Z.102). Er betont dies durch eine Metapher, dass das Gottesgnadentum vom „Vater der Lügen“ (Z.103) stammt. „Vater“ (ebd.) steht häufig für „Gott“. Der Anhang „der Lügen“ (ebd.), sagt aus, dass die Idee des Gottesgnadentums von Jemandem stammt, der nicht Gott ist. Weidig erklärt, dass das Großherzogtum „aus Verrat und Meineid [gegenüber dem Kaiser], und nicht aus der Wahl des Volkes, [...]die Gewalt der deutschen Fürsten hervorgegangen [ist]“ (Z.108- 111). Er sagt sogar, dass deswegen das Wesen und Tun der Regierung von Gott verflucht sei (vgl. Z.111f.). Weidig vergleicht die vorgegebene Weisheit und Gerechtigkeit eher mit Trug und Schinderei (vgl. Z.112f.), die die Missachtung der Menschen- und Bürgerrechte und das Elend der Bevölkerung begründet(vgl. Z.113- 115). Den letzten Sinnabschnitt, Z. 119- Z. 128, beginnt Weidig indem er den Zustand des damaligen Deutschlands, dessenKaiser die „freien Voreltern“ (Z.121) wählten, mit dem Zustand des derzeitigen Deutschlands, welches durch die Fürsten zerissen wurde (vgl. Z.120), also in einzelne Großherzogtümer aufgeteilt wurde, vergleicht. Des weiteren verdeutlicht er, dass es Hoffnung gibt und sagt, dass das Reich der Finsternis sich zum Ende neigt (vgl. Z.124f.) und „Deutschland, das jetzt die Fürsten schinden, […] als ein Freistaat mit einer vom Volk gewählten Obrigkeit wieder auferstehen [wird]“ (Z.126- 128). Mit der Metapher „Reich der Finsternis“(Z.124) betont Weidig die Herrschaft, die das Elend der Bevölkerung mit sich bringt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Georg Büchner und Friedrich Ludwig Weidig einen Sturz des Großherzogtums fordern. Die Regierung und die Adligen leben auf Kosten der Bevölkerung, welche deswegen verarmt. Generell besitzt diese keinerlei Menschen- und Bürgerrechte und wird dazu gezwungen den Fürsten Treue zu schwören, obwohl diese eigentlich nicht dazu befugt sind dies zu fordern. Das Flugblatt ist ein Appell an die Bevölkerung für ihre Rechte zu kämpfen und das Herzogtum zu stürzen.
Parallelen Woyzeck-Der Hessische Landbote
Die Flugschrift „Der Hessische Landbote“ und das Drama „Woyzeck“ von Georg Büchner, die beide im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Revolution in Deutschland, verfasst wurden, weisen einige Parallelen auf.
Zum einen werden in der Flugschrift die Unterschiede der Gesellschaftsschichten, die obere Schicht bestehend aus Fürsten und Adligen und die untere Schicht bestehend aus Bauern und Handwerkern, kritisiert. Er spricht davon, dass die untere Schicht viel arbeiten müssen um sich gerade noch ernähren zu können. Die untere Schicht wurde von großer Armut geplagt. In dem Drama findet man dies wieder: Woyzeck verrichtet jegliche Arbeit um für seine Familie Geld zu verdienen. Dafür rasiert er unter Anderem den Hauptmann (vgl. Szene 5) und stellt sich als Versuchsobjekt für die Experimente eines Arztes zur Verfügung (vgl. Szene 8). In der fünften Szene macht sich der Hauptmann über Woyzeck lustig und in der sechsten Szene wird Marie für die Bedürfnisse des Tambourmajors ausgenutzt. Dies veranschaulicht, dass die obere Schicht sich im Vergleich zu der unteren Schicht als etwas Hochwertigeres und etwas Besseres hielt. In Büchners Flugschrift verdeutlicht er dies so, dass die Bauern und Handwerker am fünften und die Fürsten und Adligen am sechsten Tag von Gott erschaffen wurden.
Man erkennt, dass Woyzeck, der mit allen Mitteln versucht Geld zu verdienen, und Marie in dem Drama, die Bauern und Handwerker in Büchners Flugschrift darstellen sollen. Diese leben in Armut und unter Arbeitslast, so wie es zur Zeit der Revolution der Fall war. Zudem sind der Hauptmann, der Arzt und der Tambourmajor Repräsentanten für die Fürsten und Adligen, die sich gesellschaftlich über die Bauern und Handwerker einordneten und auch nicht unter Armut leiden mussten.
"Brief Büchners an die Eltern"-Sachtextanalyse
Der Brief „Brief Büchners an die Eltern“ von Georg Büchner, veröffentlicht am 5.April 1833 in Straßburg, zur Zeit des Vormärz, thematisiert die Missstände zwischen den Gesellschaftsschichten.
Georg Büchners Brief ist die Antwort auf den Brief seiner Eltern, die von einer gescheiterten politischen Aktion demokratisch Gesinnter in Frankfurt berichteten. Daraufhin macht Büchner seine Meinung deutlich, und zwar, dass nur Gewalt gegen die Fürsten wirksam sei (vgl. Z. 2). Denn es sei bekannt, dass die Fürsten nichts an der Regierung und an den Menschen- und Bürgerrechten ändern würden, wenn man ihnen das nicht deutlich machen würde (vgl. Z. 3). Durch die Nutzung des Pronomens „wir“ (Z. 3), macht er deutlich, dass er unter Anderem auch die Meinung seiner Anhänger und allen anderen Revolutionären vertritt. Büchner verdeutlicht, dass die vermeintlichen Rechte, die das Volk besitzt, nur „durch die Notwendigkeit abgezwungen [wurden]“ (Z. 4), also von den Menschen- und Bürgerrechten nur die nötigsten vorhanden sind. Die Metapher, dass diese Rechte dem Volk „hingeworfen [wurden], wie eine erbettelte Gnade“ (Z. 6f.), sagt aus, dass diese Rechte den Ansprüchen des Volkes nicht gerecht werden und auch nur durch Nachdruck entstanden sind. Büchner beschreibt diese metaphorisch als das „elende Kinderspielzeug, um dem ewigen Maulaffen Volk seine zu eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen“ (Z. 6-8). Das „elende Kinderspielzeug“ (ebd.) ist eine Metapher für die inhumanen Rechte des Volkes. Dieses wird dennoch als „Maulaffen Volk“ (ebd.) beschrieben und soll aussagen, dass sie die Missstände gar nicht mitbekommen. Die „eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen“ (ebd.) ist eine Metapher für die Missstände, keine Menschen- und Bürgerrechte, zu hohe Abgaben und vieles mehr, die das Volk nicht wahrnimmt, die die Fürsten aber durch vermeintlichen Rechte und Erklärungen legitim darstellen wollen. Die Metaphern „blecherne Flinte“ (Z. 8) und „hölzerner Säbel“ (Z. 8) stehen für die Armut des Volkes und die Missstände zwischen den Bevölkerungsschichten. Da ja Soldaten sich mit Flinten und Säbeln bewaffnen und eigentlich einen gewissen Wohlstand repräsentieren, ist dies in dem Zusammenhang abwertend gemeint, dass das Volk ein schlecht bewaffneter Soldat ist, also arm ist. Büchner vergleicht das deutsche Volk mit anderen Ländern und sagt aus, dass „nur ein Deutscher die Abgeschmacktheit begehen konnte, Soldatchens zu spielen“ (Z. 9). Dabei könnte man davon ausgehen, dass Deutschland zu der Zeit im Vergleich zu anderen Ländern mit seiner Staatsform im Rückstand lag. Der Diminutiv „Soldatchens“ (ebd.) bezieht sich hierbei wieder auf die ärmlichen Verhältnisse des Volkes.
Büchner sagt, dass man den Revolutionären den Gebrauch von Gewalt vorwerfe (vgl. Z. 11). Mit der rhetorischen Frage „Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand?“ (Z. 11f.) sagt Büchner aus, dass das Volk nur durch Gewalttaten handelt, weil eine andere Form um seine Ziele zu erreichen, zum Beispiel seine Rechte durch Demonstrationen zu erkämpfen, nichts bringen würde und rechtfertigt damit diese Gewalttaten. Büchner erläutert noch einmal, dass das Volk nicht mehr merke, wie eingeschränkt es sei (Z. 12-15 ). Er verdeutlicht metaphorisch, dass das Volk „im Kerker geboren und großgezogen [wurde]“ (Z. 12f.), also von Geburt an und bis zum Lebensende rechtlich eingeschränkt ist. Dadurch, dass die Menschen von Geburt an keine andere Staatsform und Gesetze kennt, „merken [sie] nicht mehr, dass [sie] im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde“ (Z. 13ff.). „Mit angeschmiedeten Händen und Füßen“ (ebd.) ist die Arbeit gemeint, die die Menschen verrichten müssen und „[der] Knebel im Munde“ (ebd.) steht metaphorisch dafür, dass die Menschen sich auch nicht darüber beschweren dürfen. Also ist gemeint, dass das Volk die inhumane Arbeit für die Fürsten verrichten muss ohne sich dabei beschweren zu dürfen. Durch die rhetorische Frage „Was nennt ihr denn gesetzlichen Zustand?“ (Z. 15), verdeutlicht Büchner, dass man nicht von Gesetzen reden kann, die für jeden gerecht sind. In der darauf folgenden rhetorischen Frage beantwortet er die Frage welcher Gesetzeszustand herrsche damit, dass „die große Masse der Staatsbürger zum fronenden Vieh [gemacht wurde], um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen“ (Z. 16 ff.). Das Volk ist also zu den Dienstleistungen verpflichtet. „Die unnatürlichen Bedürfnisse“ (ebd.) sind eine Metapher für die hohen Abgaben, die das Volk zu zahlen hat. Die Hyperbel „unbedeutend und verdorben“ (ebd.) steht dafür, dass die „Minderzahl“ (ebd.), also die Fürsten, es nicht verdient haben, vom Volk finanziell unterstützt zu werden, da sie dem Volk nichts zurückgeben und sie nur ausbeuten. Dieses Gesetz wird durch „rohe Militärgewalt und die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten“ (Z. 19) unterstützt. Darunter kann man verstehen, dass jegliche Wiedersetzungen ohne Rücksicht auf Verluste durch Gewalt, von der Regierung aus, gelöst werden. „Die dumme Pfiffigkeit“ (ebd.) ist eine Antithese, durch die Büchner verdeutlicht, dass das ganze Regierungssystem zwar gut durchdacht ist, aber nicht mehr lange halten wird, da er und andere Revolutionäre dies stoppen wollen. Trotzdem stellt somit „dies Gesetz […] eine ewige, rohe Gewalt“ (Z. 20) für Büchner dar, die er „mit Mund und Hand“ (Z. 21) bekämpfen will. Er will also mit allen Mitteln, durch zum Beispiel Reden und vor allem durch Gewalt gegen die Fürsten und ihr Regierungssystem ankämpfen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Georg Büchner in dem Brief seine Meinung zur Bekämpfung der Regierung deutlich macht. Er spricht häufig Gewalt als Mittel zur Bekämpfung an, welches zudem als Appell gedeutet werden kann. Außerdem erläutert er, dass das Volk jahrelang zu Unrecht behandelt wurde und man endlich einen Schlussstrich ziehen muss. Seine Erläuterungen sind vor allem durch Metaphern und rhetorische Fragen gekennzeichnet. Neben den rhetorischen Fragen wird auch eine einfache Sprache verwendet, die den Text somit für jeden verständlich machen.
Abschrift der 2. Klausur
1. Aufgabe
Der Brief „An die Familie“, geschrieben von Georg Büchner im Juli 1835 in Straßburg, in der Epoche des Vormärz, thematisiert die Zensur von Büchners Buch und allgemein die literarische Freiheit.
Der erste Abschnitt (Z. 2-15) handelt von Büchners Verständnis von den Aufgaben eines Dramatikers. Georg Büchners Buch soll „[eine] sogenannte Unsittlichkeit“ (Z. 2) beinhalten. Daraufhin beschreibt Büchner seine Auffassung, dass „der dramatische Dichter […] nichts als ein Geschichtsschreiber“ (Z. 3f.) ist. Somit sagt er aus, dass die „Unsittlichkeit“ (ebd.) als wahre Begebenheit in seinem Buch dokumentiert wurde. Er sagt, der Dichter erschaffe die Geschichte zum zweiten Mal (vgl. Z. 5f.) und versuche diese lebendig (vgl. Z. 7f.) darzustellen. Der Geschichtsschreiber liefere im Gegensatz dazu „eine trockene Erzählung“ (Z. 7). Büchner differenziert,unter Verwendung einer Aufzählung, dass Geschehnisse und das darauf aufbauende Drama „statt Charakteristiken Charaktere, […] statt Beschreibungen Gestalten gibt“ (Z. 8f.). Dabei sei die „höchste Aufgabe“ (Z. 9), also der Fokus, die Geschichte so genau wie möglich zu erzählen (vgl. Z. 10). Büchner sagt, dass ein Drama „weder sittlicher noch unsittlicher […] als die Geschichte selbst“ (Z. 11f.) sein solle. Denn „die Geschichte ist vom lieben Herrgott nicht zu einer Lektüre für junge Frauenzimmer geschaffen worden“ (Z. 12f.). Mit „junge Frauenzimmer“ (ebd.) drückt Büchner metaphorisch aus, dass ein Drama den Menschen die Realität vor Augen führen soll und nicht zur Unterhaltung dienen oder Geschehnisse verharmlosen soll. Und nach dieser Auffassung hat Büchner sein Drama verfasst (vgl. Z. 15). Der zweite Abschnitt (Z. 16-27) handelt davon, warum Dramen, die auf Geschehnissen aufbauen, wichtig sind, Büchner geht anfangs darauf ein, dass er Gestalten erfindet und erschafft um die vergangene Geschichte zu veranschaulichen (vgl. Z. 17f.). Er denkt, dass die Menschen aus Dramen lernen können, wie man es auch in einem Geschichtsstudium und durch das Miterleben seines Umfelds macht (vgl. Z.19ff.). Da man unter anderem Büchners Drama verbieten wollte, ist er der Meinung, dass „man keine Geschichte studieren [dürfe]“ (Z. 22). Denn es werden dieselben Inhalte angesprochen (vgl. Z.23). Das heißt es macht keinen Unterschied, wenn ein Dramatiker ein Buch über die Geschehnisse verfasst und nur anders darstellt. Die Vertuschung von diesen Geschehnissen ist durch ein Verbot literarischer Texte nämlich nicht möglich. Büchner bezieht sich auf die Veranschaulichung der Realität durch historische Erzählungen und durch Dramen, die der Bevölkerung die Augen öffnen soll. Der letzte Abschnitt (Z. 27-38) behandelt die Idealvorstellungen, die die Dichter vermeintlich beschreiben sollen. Büchner sagt, dass die Auffassung „der Dichter müsse die Welt nicht zeigen wie sie ist, sondern wie sie sein solle“ (Z. 38f.) nicht richtig ist. Er will die Welt nicht besser machen als Gott (vgl. Z.30), das heißt, er will den Menschen nicht sagen, wie eine Idealwelt aussieht, sondern ihnen Tatsachen beschreiben, aus denen sie selber ihre Schlüsse ziehen sollen. Büchner sagt, dass die Figuren in den Idealdichtungen „Marionetten mit himmelblauen Nasen und affektiertem Pathos“ (Z. 33f.) sind. „Marionetten mit himmelblauen Nasen“ (ebd.) ist eine Metapher dafür, dass die Figuren in den Geschichten ein Ideal darstellen. Welches aber fremdbestimmtr ist, weil Marionetten gesteuert werden. Außerdem ist „affektierter Pathos“ (ebd.) eine Metapher dafür, dass die Dramen dieser Dichter aufgesetzt sind und nicht der Realität entsprechen. Während diese Ideale verbreitet werden, findet Büchner die Dramen wichtiger, die die Geschehnisse der Zeit erzählen. Die Antithesen „Leid und Freude […] Abscheu und Verwunderung“ (Z. 35f.) sind Empfindungen, die Dramen, die die Realität darstellen, vermitteln. Für Büchner sind diese wichtig, da sie die Bevölkerung gewissermaßen beeinflussen und zum Umdenken bzw. Nachdenken anregen. Der letzte Satz, dass Büchner etwas von Goethe und Shakespeare hält und nicht viel von Schiller, könnte bedeuten, dass Goethe und Shakespeare seiner Beschreibung eines Dichters entsprechen und Schiller nicht.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Büchner seine Auffassung eines dramatischen Dichter und seine Aufgaben beschreibt. Ein dramatischer Dichter ist demnach jemand, der echte Geschehnisse mithilfe von Figuren und Gestalten zu beschreiben und zu veranschaulichen versucht. Außerdem sagt er, dass ein Drama die Menschen so belehren kann wie es die Geschichte macht, man also genau dieselben Erkenntnisse erschließt. Schließlich ist er der Meinung, dass die von Dichtern idealisierte Welt zu realitätsfern ist und das Verständnis der Menschen über reale Geschehnisse einschränkt. Büchner argumentiert für sein Drama und veranschaulicht überwiegend metaphorisch seine Argumente. Dabei richtet er sich an die Leute, die sein Buch für unangemessen halten.
2. Aufgabe
Georg Büchners Brief „An die Familie“ bezieht sich auf die Kritik, die er für sein Drama „Woyzeck“ erhalten hat. In dem Brief beschreibt er den dramatischen Dichter als einen Geschichtsschreiber. Sein Drama handelt von den Missständen in den Gesellschaftsschichten. Wobei die untere von der oberen Schicht im 19. Jahrhundert ausgebeutet wurde. Diese Ereignisse beschreibt Büchner in der Form eines Dramas. Hier stellen Woyzeck und Marie die untere Schicht dar, die alles tun müssen um sich ernähren zu können. Zum Beispiel verrichtet Woyzeck jegliche Arbeit, indem er den Hauptmann rasiert (Szene 5) und als Versuchsobjekt dient (Szene 8). Zudem fordert er mithilfe des Dramas eine Änderung dieser Gesellschaft; er beschreibt dafür extreme Zustände, die Woyzeck als Repräsentant für die untere Schicht, erlebt. Er ist arm und seine Freundin geht ihm deswegen sogar fremd und wird wiederum nur ausgebeutet (Szene 6). Dies soll den Menschen zeigen, dass etwas geändert werden musste. Darauf geht Büchner auch in seinem Brief ein; die Leute sollen daraus lernen. Büchner versucht in seinem Drama auch nicht eine idealisierte Welt zu zeigen. Am Ende des Drama wurde Woyzeck sogar dazu getrieben seine Freundin umzubringen (Szene 20).
Effi Briest
Inhaltsangabe
Die siebzehnjährige Effi Briest stammt aus einer Adelsfamilie und wohnt zusammen mit ihren Eltern in Hohen-Cremmen. Der Baron Geert von Innstetten, der ein Vereherer von Effis Mutter war, hält um Effis Hand an und auf Wunsch ihrer Eltern nimmt Effi den Antrag an. Nach der Hochzeitsreise durch Italien zieht Effi mit Innstetten nach Kessin. Effi fürchtet sich allerdings vor dem Haus, da sie denkt es würde dort spuken. Außerdem langweilt sich Effi in dem Badeort, weil es dort kaum Abwechslung gibt. Der einzige ihr sympathische Mensch ist der Apotheker Gieshübler, mit dem sie sich auch anfreundet. Aus der Ehe entsteht eine Tochter dessen Name Annie ist. Effi stellt das Dienstmädchen Roswitha als Kindermädchen ein, mit der sich Effi gut versteht. Während Effi ihre Eltern in Hohen-Cremmen besucht, unternehmen Innstetten und der Landwehrbezirkskommandeur Major von Crampas einige Ausritte an denen sich Effi nach ihrer Rückkehr beteiligt. Als Innstetten verhindert ist, unternehmen Effi und Crampas zusammen einen Ausritt, bei dem sich die beiden näher kommen und seitdem sie immer öfter zusammen ihre Zeit verbringen. Nach einiger Zeit teilt Innstetten Effi mit, dass die Familie wegen einer Beförderung Innstettens nach Berlin umziehen muss. Effi ist froh darüber, da sie den Kontakt mit Major Crampas abbrechen kann. In Berlin fühlt Effi sich im Vergleich zu Kessin sehr wohl und langweilt sich dort nicht mehr. Durch Zufall findet Innstetten einige Liebesbriefe von Crampas an Effi. Daraufhin fordert Innstetten Crampas zu einem Duell heraus, bei dem Crampas stirbt. Wegen der verletzten Ehe wird Effi von ihrem Mann und ihrer Tochter verlassen und auch ihre Eltern verstoßen sie. Effi zieht zusammen mit Roswitha in eine kleine Wohnung in Berlin. Nach einem Treffen mit ihrer Tochter Annie, erleidet Effi einen Zusammenbruch, da Annie sich ihr gegenüber sehr distanziert verhält. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustand nehmen Effis Eltern sie wieder in ihr Haus auf, wo sie schließlich stirbt.
Analyse Romananfang
Der Roman „Effi Briest“ von Theodor Fontane, geschrieben im Jahr 1896 in der Epoche des Realismus, thematisiert den sozialen Umstand der Frau im 19. Jahrhundert. Der vorliegende Textauszug handelt von der Beschreibung des Anwesens der Familie von Briest.
Die Familie lebt in dem „Herrenhaus zu Hohen-Cremmen“ (Z.3), wovon man ausgehen kann, dass die Familie von Briest eine Adelsfamilie ist. Der „helle[...] Sonnenschein“ ist ein Klimax und betont die Idylle und den Frieden, die in Effis Heimatort herrschen und einen Einblick auf Effis friedliches Leben geben. Der „breite[...] Schatten“ hingegen steht gegenteilig zum „helle[n] Sonnenschein“ (ebd.) und steht metaphorisch für eine baldige Veränderung. Es wird eine Sonnenuhr beschrieben, die im Garten der Briests steht (vgl. Z. 8). Hier findet man das Motiv der Sonne wieder, die für den Frieden und die Idylle in Effis Leben steht. Somit steht die Sonnenuhr, da man anhand einer Uhr die Zeit ablesen kann, für die gute Zeit, die Effi in ihrem Elternhaus verbracht hat. Außerdem findet man die Sonnenuhr am Ende des Romans wieder, denn dort wird Effi beerdigt. Somit stellt die Sonnenuhr ihre Lebenszeit symbolisch dar. Um die Sonnenuhr sind Rhabarbarstauden und die indische Pflanze Canna indica gepflanzt (vgl. Z. 9). Übersetzt bedeutet Canna indica „zeitlos“, was Effis bisherige Kindheit widerspiegeln soll. Sie hat alles, was sie braucht und lebt eine sorglose Kindheit. Als nächstes wird beschrieben, dass „Fronthaus, Seitenflügel und Kirchhofsmauer […] einen kleinen Ziergarten umschließendes Hufeisen [bilden]“ (Z. 15 ff.). Diese Konstruktion bildet symbolisch gesehen einen Schutz vor der Außenwelt. Einerseits wird Effis Kindheit gewahrt und deutet somit auf ihre Unschuld hin. Andererseits wird durch diesen Schutz auch die Ungewissheit vor der Außenwelt verstärkt. An dem offenem Ende, wo das von dem Gebäude und der Mauer gebildete Hufeisen eine offene Seite hat, liegt ein Teich, an dem, wie beschrieben ein angeketteltes Boot liegt (vgl. Z. 18). Der Teich stellt ein Hindernis dar, wenn man versuchen würde ihn zu überqueren um das andere Ufer zu erreichen. Das angekettelte Boot ist leicht zu lösen und macht es möglich auf das Wasser zu gelangen. Der Teich und das Boot könnten somit eine Gefahr darstellen, wenn man versuchen sollte der gewohnten Umgebung zu entfliehen und das Unbekannte sucht. So wird Effi auch beschrieben; sie liebt das Abenteuer und geht gerne Risiken dafür ein. Neben dem Teich steht eine Schaukel, deren Balken etwas schief steht (vgl. Z. 19 ff.). Am Zustand der Schaukel kann man festmachen, dass sie oft genutzt wurde. Im Roman wird zudem erwähnt, dass Effi immer noch gerne schaukelt, besonders weil die Schaukel einzustürzen droht. Die Schaukel steht für Freiheit, da Effi sich frei fühlt, wenn sie schaukelt und für Abenteuer, da man nicht weiß, ob sie jeden Moment einstürzt. Hier werden nochmal Effis Charaktereigenschaften beschrieben; sie hat neben der Abenteuerlust ein Bedürfnis nach Freiheit. Als letztes werden „mächtige alte Platanen“ (Z. 23) beschrieben, die den Teich und Schaukel verstecken. Metaphorisch ist damit gemeint, dass sie Effi vor den Gefahren abhalten sollen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass direkt zu Beginn des Romans Effis Lebensumstände und einige Charaktereigenschaften unter anderem metaphorisch dargestellt werden.
Die Marquise von O...
Kopfzeile
Sprache
Zusammenfassung "Was ist 'Mehrsprachigkeit'?- Eine Definition", Alexandra Wölke
Die Bedeutung des Themas:
- zentrales Thema durch Globalisierung
- internationale Kommunikationsnetzwerke
→ erwünschte und akzeptierte Selbstverständlichkeit mehr als eine Sprache zu können
Der Begriff „Mehrsprachigkeit“:
- individuelle, institutionelle, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit
- gesellschaftliche Mehrsprachigkeit: Geltung, Anwendung mehrerer Sprachen in einer Gesellschaftliche
→ Länder mit offizieller Mehrsprachigkeit
- individuelle Mehrsprachigkeit: Fähigkeit bei der täglichen Kommunikation mehr als eine Sprache anwenden zu können
→ Erstsprache/ Muttersprache; Zweit-/ Drittsprache oder Fremdsprache
„Heteroglossie“ als erweiterter Begriff von Mehrsprachigkeit:
- Sprache ist unabgeschlossen, lebendig, im Prozess
- Sprache ist vielfältig, Bandbreite sprachlicher und kommunikativer Ressourcen
→ lässt sich verschiedenen Sprachsystemen zuordnen
- Heteroglossie: Fähigkeit sich einer komplexen sprachlichen Vielfalt bedienen zu können
- Mehrsprachigkeit nicht nur auf Fremdsprachen bezogen, sondern auch auf sprachliches Potenzial bezogen (kommunikative Kompetenz)
→ Fähigkeit (mittels Kommunikation) sich selbst verständlich zu machen und andere zu verstehen
- Wissen von Sprachsystem, Grammatik, Lexik, Stilistik → Voraussetzung kompetenten Sprachhandelns
Äußere und innere Mehrsprachigkeit:
- innere Mehrsprachigkeit: sprachliche Differenzierungen innerhlab einer Sprache; Varietäten
→ Zeit, soziale Schicht, kommunikative und funktionelle Situation
- Zusammenhänge zwischen äußerer und innerer Mehrsprachigkeit
Analyse "Hab isch gesehen mein Kumpel- Wie die Migration die deutsche Sprache verändert hat", Uwe Hinrichs
Der vorliegende Sachtext „Hab isch gesehen mein Kumpel- Wie die Migration die deutsche Sprache verändert hat“ von Uwe Hinrichs, veröffentlicht im Jahr 2012, thematisiert den Sprachwandel der deutschen Sprache unter Einfluss der steigenden Migrationsrate.
Der erste Sinnabschnitt (Z. 1- 18) befasst sich damit, dass „der deutsche Sprachraum […] seit je und von allen Seiten von fremden Sprachen und Kulturen umgeben [ist]“ (Z. 1f.). Damit ist gemeint, dass Deutschland schon immer von Ländern wie Frankreich, Dänermark und Polen umgeben ist und somit eigentlich Kontakt zu anderen Sprachen und Kulturen gehabt haben könnte. Dennoch ist davon die Rede, dass dieser Kontakt „die weiche Variante des Sprachkontakts […] ohne soziale Konsequenzen“ war. Die Sprache und auch die Kultur wurden also weitestgehend nicht stark von den Nachbarländern und auch anderen Ländern beeinflusst bzw. man hat sich mit anderen Kulturen und Sprachen nicht so intensiv auseinandergesetzt. Seit den Siebzigern habe sich das aber geändert, denn Menschen mit anderen Kulturen und Sprachen haben die Kultur und Sprache in Deutschland geprägt (vgl. Z. 13- 18). Der Autor schildert in diesem Abschnitt grob, dass sich die deutsche Sprache durch Einflüsse aus dem Ausland, also dadurch, dass Menschen aus anderen Ländern eingewandert sind und ihre Sprache und Kultur mitnahmen, verändert hat.
Der zweite Abschnitt (Z. 19- 40) beginnt einleitend mit einer rhetorischen Frage, „wie [...] die jüngsten Sprachkontakte das Deutsche verändert [haben]“ (Z. 19f.), die die Leitfrage des Abschnitts darstellt, und versucht im Anschluss eine Erklärung dafür zu geben. Zunächst listet der Autor auf, dass „das, was […] für einfache Kommunikationszwecke mit fremden Sprachen am allerwenigsten benötigt [wird]“ (Z. 21 ff.), auch als erstes vernachlässigt wird. Dabei nennt der Autor „die Fälle, die Endungen und die Regeln ihrer Verknüpfung“ (Z. 24f.). Als Beispiel wird auch Bastian Sicks Bestseller („Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“) genannt, um seine Behauptung zu unterstützen (vgl. Z. 26ff.).Außerdem sagt er, dass „Dativ und Akkusativ […] Bastionen räumen [müssen]“ (Z. 29f.). Bastionen sind Festungswälle, die vor Angreifern schützen sollen. Die Metapher „Bastionen räumen“ (ebd.) betont, dass die korrekte Anwendung der Kausalfälle immer mehr vernachlässigt wird. Abschließend nennt der Autor ein paar falsche Beispielkonstruktionen, die er letztendlich auch nochmal grammatikalisch korrekt aufzählt, um deutlich zu machen, dass solche falschen Konstruktionen einem täglich begegnen und auch des öfteren von jungen Leuten angewendet werden, ohne dass sie es bemerken (vgl. Z. 31ff.).
Im nächsten Abschnitt (Z. 41- 57) macht der Autor auf den Verlust der Sprachstrukturen im Deutschen aufmerksam. Er behauptet ironisch, dass „das mehrsprachige Milieu […] auf korrekte Deklination und genaue Endungen durchaus verzichten [könne], weil diese Art der Grammatik nur Kodierungsenergie frisst, die woanders viel dringender gebraucht wird, beispielsweise um Defizite im Wortschatz auszugleichen“ (Z. 41- 46). Die daraus resultierende Vereinfachung der Sprachstrukturen, die Nichtmuttersprachlern eine einfachere Kommunikation ermöglicht, wird als Grund für den Verfall der Sprache angesehen (vgl. Z. 48 ff.). Die anschließende Behauptung, „Schulkategorien wie Konjunktiv, Plusquamperfekt oder vollendetes Futur werden in naher Zukunft wahrscheinlich kaum gebraucht“ (Z. 54ff.), verdeutlicht nochmal, dass die Grammatik sehr vernachlässigt wird. Der darauf folgende Sinnabschnitt (Z. 58- 83) behandelt einen weiterer Einfluss auf die Sprache, die Herkunftssprachen der Migranten (vgl. Z. 58 f.). Der Autor liefert eine Erklärung für die Sprachveränderungen, und zwar „greifen [die Migranten] auf Sprachstrukturen zurück, die sie aus ihrer Muttersprache mitbringen“ (Z. 60 f.), welche auf das Deutsche übertragen werden (vgl. Z. 62 f.). Anschließend nennt der Autor das „großstädtische Kiezdeutsch“(Z. 64) als ein Beispiel für Veränderungen in der Sprache. Durch die Nennung der „Potsdamer Linguistin Heike Wiese“ (Z. 64 f.) und einigen Beispielen, die Satzmuster aus dem Türkischen und Arabischen aufweisen (vgl. Z. 66 ff.), wird seine These, dass die Herkunftssprachen der Migranten einen Einfluss auf die deutsche Sprache nehmen, gestärkt. Des Weiteren wird aufgelistet, dass „auch in der Alltags- Umgangssprache […] Beispiele für neue Strukturen, die ihre Vorbilder in vielen Migrantensprachen haben“ (Z. 70- 79), vorzufinden sind. Daneben auch „neudeutsche Ausdrücke [, die] […] Parallelen im Türkischen [haben]“ (Z. 80 ff.). Durch die Aufzählung zahlreicher Beispiele, wird seine These gestärkt.
Im vorletztem Sinnabschnitt des Textes (Z. 84- 106) ist von „der heißen Phase des kontaktinduzierten Wandels der Sprachstrukturen“ (Z. 84 f.) die Rede. Die Metapher „heiße Phase“ (ebd.) steht für die Ankündigung einer Wende. Der Neologismus „kontaktinduziert“ (ebd.) betont, dass der Wandel in der Sprache durch den Kontakt unter den Menschen ausgelöst wird. So heißt es auch als Erläuterung, dass „die 'Fehler' der Migranten allmählich von den deutschen Muttersprachlern nachgeahmt werden“ (Z. 86 f.). Der Autor nennt an dieser Stelle auch einen Fachbegriff bzw. benennt er dieses Phänomen als „'foreigner talk'“ (Z. 88). Dadurch wirkt seine Argumentation authentischer. Die Folge daraus ist, dass es „zu[r] Sprachvermischung und zu neuen Sprachstrukturen“ (Z. 91 f.) kommt. Man unterscheidet nicht mehr zwischen richtiger und falscher Grammatik (vgl. Z. 89 f.) und „die Bereitschaft […] Fehler auch als Fehler wahrzunehmen und spontan zu korrigieren, [lässt] mit der Zeit nach und verschwindet irgendwann ganz“ (Z. 93 ff.). Daraus ergebe sich die Reduktion der Grammatik (vgl. Z. 101 f.) und die Vereinfachung bzw. Auflösung vieler Regeln (Z. 103 f.). Allgemein werde die Sprache einfacher (vgl. Z. 104 f.) „und wird [...] vom Englischen unterstützt“ (Z. 105 f.). Der Autor spricht am Ende des Abschnitts das Thema Anglizismus an, durch den die deutsche Sprache merklich beeinflusst wird. In diesem Abschnitt werden der Prozess und die Gründe für den „Abbau“ von Regeln in der deutschen Grammatik und die Neuentwicklung unter Einfluss von anderen Sprachen (hier wird das Englische genannt) verdeutlicht.
Im letzten Sinnabschnitt (Z. 107- 120) geht der Autor darauf ein, dass es in der Wissenschaft kaum Forschungen über dieses Phänomen der Sprachentwicklung gibt (vgl. Z. 107 ff.). Einen Grund dafür sieht der Autor darin, dass „Linguisten, […] wenn sie den Einfluss der Migrantensprachen auf das Deutsche analysieren, schnell in eine Diskriminierungsfalle geraten könnten“ (Z. 110 ff.). Der Autor bewertet dies aber als eine verlorene Gelegenheit „Deutsche und Migranten in Projekten zusammenzubringen und Visionen einer offenen Gesellschaft mit Leben zu füllen“ (Z. 115 f.). Somit fordert der Autor, nicht nur das Schlechte im Wandel der deutschen Sprach zu sehen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Autor nach der geschichtlichen Einführungen über die verschiedenen Einflüsse, die zu den ersten Sprachkontakten führten, auf die Einflüsse eingeht, die die Sprache heutzutage beeinflussen. Zudem geht er auf die Folgen ein, dass die Sprachstrukturen zunehmend verschwinden. Verdeutlicht wird dies anhand von Metaphern und Beispielen.
Analyse "Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben", Ralph Mocikat
Der vorliegende Sachtext „Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben“, geschrieben von Ralph Mocikat und veröffentlicht im Jahr 2012, thematisiert die Forderung Mocikats, die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache zu erhalten.
Die Überschrift „Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben“ stellt das Thema dar und fungiert als ein Appell. Somit wird direkt deutlich gemacht, worum es geht und was der Autor fordert. Im ersten Sinnabschnitt (Z. 1- 5) wird zunächst eine These aufgestellt, dass „in der Wissenschaftskommunikation [...] zunehmend auch im Inland ausschließlich die englische Sprache verwendet“ (Z. 1 f.) werde. Durch den nächsten Satz, das dies „insbesondere für naturwissenschaftliche und technische Disziplinen“ (Z. 2 f.) gelte, erläutert der Autor um welchen Bereich der Wissenschaft es sich handelt. Im darauffolgenden wird darauf eingegangen, inwiefern die englische Sprache in der Wissenschaft angewendet wird: „Auf Kongressen […] werden Vorträge fast immer nur noch auf Englisch gehalten“ (Z. 3 f.) und „Drittmittelgeber schreiben oft vor, Förderanträge lediglich in englischer Sprache einzureichen“ (Z. 4 f.). Die englische Sprache zu beherrschen stellt somit eine Notwendigkeit dar. Der zweite Sinnabschnitt (Z. 6- 9) handelt davon, dass „Hochschulen […] Studiengänge komplett auf Englisch um[stellen]“ (Z. 6). Hier wird noch einmal deutlich, dass die Beherrschung der englischen Sprache notwendig für Studierende ist. Darauffolgend stellt der Autor die Folge, „dass das tiefere Verständnis deutlich eingeschränkt [wird], wenn Studierende den Stoff in ihrer Disziplin nur in der Lingua franca aufnehmen“ (Z. 8 f.), dar und bezieht sich dabei auf verschiedene Studien (vgl. Z. 7). Die „Lingua franca“ (Z. 9) ist die Sprache eines größeren mehrsprachigen Raums, in diesem Zusammenhang also die englische Sprache. Der Autor sieht die Gefahr eines eingeschränkten Verständnisses bei Studierenden, da viele die englische Sprache nicht so gut beherrschen. Die Nennung der Studien, die allesamt aus dem Ausland stammen (ebd.), zeigen, dass das Problem nicht nur Studierende in Deutschland, sondern auch Studierende aus anderen Ländern betrifft. Im nächsten Sinnabschnitt (Z. 10- 14) bezieht sich der Autor schließlich darauf, dass auch „bei uns“ (Z. 10), also womöglich an der Universität, an der Mocikat unterrichtet, die Verwendung der englischen Sprache in der Wissenschaft Konsequenzen hat (vgl. Z. 10). „Seminare oder wissenschaftliche Besprechungen […] verflachen“ (Z. 10 ff.). Das Verb „verflachen“ (ebd.) bedeutet, dass etwas niveaulos ist bzw. wird. In diesem Zusammenhang bedeutet das also, dass wenn ausschließlich das Englische verwendet wird, Studierende Probleme haben sich so auszudrücken, wie sie es auf ihrer Muttersprache könnten. Ihnen fehlt ein umfangreicher Wortschatz. Der kurze Satz „Sie verflachen“ (Z. 12), hat dabei eine betonende Funktion. Darauffolgend nennt der Autor „beispielsweise, wie die Diskussionsbereitschaft [in vielen Seminaren] dramatisch schwindet“ (Z. 12 ff.). Das Adverb „dramatisch“ (ebd.) betont die drastisch sinkende Teilnahme bei Diskussionen, die auf den mangelnden Wortschatz zurückzuführen ist. Eine detaillierte Erläuterung, warum das Verständnis der Studierenden eingeschränkt wird, gibt der Autor im darauffolgenden Sinnabschnitt (Z. 15- 30). Somit stellt er eine These auf: „Sprache [habe] nicht nur eine kommunikative, sondern auch eine kognitive Funktion“ (Z. 15 f.). Der Autor erklärt, dass die Funktion einer Sprache komplexer ist, als sie erscheint. Die „kognitive Funktion“ (ebd.) umfasst die Wahrnehmung und das Denken. Somit erläutert der Autor auch, dass „unsere Denkmuster, […] in dem Denken verwurzelt [bleiben], das auf der Muttersprache beruht“ (Z. 16 ff.). Zur Veranschaulichung seiner These nennt er ein Beispiel, dass „wissenschaftliche Theorien […] immer mit Wörtern, Bildern, Metaphern, die der Alltagssprache entlehnt sind[, arbeiten]“ (Z. 18 ff.). Der Autor stellt nun zunächst das Problem dar, das sich ergibt: „Anspielungen und Bilder[...] kann man nur in der jeweiligen Muttersprache voll erfassen“ (Z. 19 ff.). D.h. wenn die „Fachsprache nicht mehr die Alltagssprache ist, werden die Sprachbilder fehlen, die nötig sind, um Neues anschaulich begreiflich zu machen“ (Z. 21 ff.). Diese Konsequenz stellt ein Problem dar, welches aus der Umstellung in die englische Sprache innerhalb der Wissenschaft resultiert. Somit „läuft es auf eine geistige Verarmung hinaus, wenn Lehre und Forschung auf das Englische eingeengt werden“ (Z. 24 f.). Die Metaphern „geistige Verarmung“ (ebd.) und „eingeengt werden“ (ebd.) betonen, dass die Umstellung auf die englische Sprache, Menschen, für die die englische Sprache eine Fremdsprache ist, in der Fähigkeit Dinge zu verstehen und sich selbst auch ausdrücken zu können, einschränkt. Ein weiteres Argument für den Erhalt der deutschen Sprache als Wissenschaftssprache sei, dass „Gastwissenschaftler, die mit guten Deutschkenntnissen hierherkommen, dann jedoch von unserer Sprache und Kultur ferngehalten werden und […] ihre Sprachkenntnisse verlieren, […] sich ausgegrenzt vor[kommen] und […] ein negatives Deutschlandbild in ihre Heimat zurück[bringen]“ (Z. 25 ff.). Somit erkennt der Autor den Erhalt der deutschen Wissenschaftssprache als notwendig an, um die Kultur anderen Wissenschaftlern nicht vorzuenthalten. Des Weiteren weist der Autor darauf hin, dass „die Wissenschaft [sich] auch immer weiter von der Gesellschaft ab[koppelt], gegenüber der sie rechenschaftspflichtig ist“ (Z. 29 f.). Somit sagt, der Autor, dass die Umstellung ins Englische nicht nur Verständnisprobleme bei den Wissenschaftlern und Studierenden, sondern auch in der Bevölkerung mit sich bringt. Doch es sei wichtig, dass auch für die Bevölkerung Erkenntnisse aus der Wissenschaft nachvollziehbar sind. Im letzten Sinnabschnitt (Z. 31- 34) wägt der Autor ab, dass man ohne Englisch als internationale Kongress- und Publikationssprache nicht auskomme (vgl. Z. 31 f.). Denn es muss ja eine Sprache geben, um international zu kommunizieren und zu agieren. Dennoch sei „unbestritten […], dass wir im Inland auch das Deutsche als Wissenschaftssprache benutzen und pflegen müssen“ (Z. 32 f.). Der Autor vertritt also weiterhin seine Meinung, die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache, zumindest innerhalb Deutschlands, zu nutzen. Das Adverb „unbestritten“ (ebd.) betont, dass es genug Gründe dafür gibt. Als letztes unterstützt er seine Forderung durch den Vorschlag, „in Übersetzungen zu investieren“ (Z. 33f.), um die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache zu erhalten.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Autor direkt im Titel seine Forderung, das Deutsche als Wissenschaftssprache zu erhalten, aufstellt. Er unterstützt seine Argumente und aufgestellten Thesen mittels Beispielen und Erläuterungen und nutzt unter anderem Metaphern zur Veranschaulichung.
Analyse "Schreiben in der Schule- booaaa mein dad voll eklich wg schule", Wolfgang Krischke
Aufgabe 1
Der Sachtext „Schreiben in der Schule- booaaa mein dad voll eklich wg schule“, geschrieben von Wolfgang Krischke und veröffentlicht im Jahr 2011, thematisiert die Verwendung der Schriftsprache in der formellen und elektronischen Kommunikation. Dabei liegt der Fokus darauf, ob Jugendliche die elektronische Kommunikation von der formellen Kommunikation, und die bestehenden Regeln, unterscheiden können.
In der Überschrift wird zunächst ein Kontrast deutlich: „Schreiben in der Schule“ und „booaaa mein dad voll eklich wg schule“. Ersteres lässt vermuten, dass in der Schule auf Rechtschreibung, Zeichensetzung etc. geachtet wird. Letzteres verdeutlicht, wie Jugendliche untereinander kommunizieren. Dabei werden, neben der fehlenden Groß- und Kleinschreibung, „schule“, und falscher Rechtschreibung, „eklich“, weitere Merkmale deutlich. Die Interjektion „booaaa“ (ebd.), ist ein Empfindungslaut, der in dieser Situation ausdrückt, dass man genervt ist. Als nächstes ist der Anglizismus „dad“ zu finden. Hier wird deutlich, dass das Englisch die deutsche Sprache beeinflusst. Außerdem werden Abkürzungen wie „wg“ gebraucht.
Zunächst wird der Text mit einer Unterüberschrift, die als These fungiert, eingeleitet: „Simsen macht Schüler nicht dumm“ (Z. 1). Somit behauptet der Autor, dass das Kommunizieren mittels Handys Schüler nicht beeinträchtigt. Darauffolgend wägt der Autor seine These ab und behauptet, dass trotzdem „Texte […] heute fehlerhafter als früher“ (Z. 1) seien.
Im ersten Sinnabschnitt (Z. 2-12) wird die Thematik genauer geschildert. Einleitend wird eine rhetorische Frage gestellt, die das Vorurteil, dass Kinder zu wenig lesen würden (Z. 2), benennt. Darauf geht der Autor verneinend ein und er ist sogar der Meinung, dass Kinder „wohl noch nie zuvor […] so viel gelesen und geschrieben [haben] wie heute“ (Z. 2f.). „Noch nie zuvor“ (ebd.) lässt darauf schließen, dass es sich um ein Phänomen der heutigen Zeit handelt. Des Weiteren geht der Autor auf seine Behauptung ein und erläutert, dass Kinder täglich Millionen Wörter tippen und Stunden mit SMS- Nachrichten, Chat- Sprüchen etc. verbringen würden (vgl. Z. 3ff.). Somit nennt er Beispiele, die veranschaulichen, inwiefern Kinder lesen und schreiben. Die adversative Konjunktion „trotzdem“ (Z. 6) leitet ein, dass es jedoch Probleme mit dem Lesen und Schreiben gibt. Pädagogen und Ausbilder seien nicht zufrieden damit (vgl. Z. 6), da bei „den Simsern […] die Schrift vor allem als Plaudermedium“ (Z. 7f.) diene. Der Neologismus „Plaudermedium“ (ebd.) stellt das Problem ziemlich deutlich dar: Die Schrift wird zur Kommunikation genutzt und auf Orthografie etc. wird kaum geachtet. So sei diese „von den Normen der Hochsprache […] Lichtjahre entfernt“ (Z. 8f.). Die Metapher „Lichtjahre“ (ebd.) betont, dass man die Schrift als Kommunikationsmittel nicht mit der Hochsprache vergleichen kann und diese auch ganz andere Regeln besitzt. Im Folgenden werden dann Beispielsätze genannt um dies zu veranschaulichen und hyperbolisch geschildert, dass diese „Freunde des Dudens und ganzer Sätze […] zusammenzucken“ (Z. 11f.) lassen würden. Hier wird wieder darauf eingegangen, dass die Kommunikationsschrift von der Hochsprache abweicht und gekürzt bzw. grammatikalisch häufig falsch ist.
Der zweite Sinnabschnitt (Z. 12- 29) wird mit der rhetorischen Frage, „Können Jugendliche, die sich in diesen sprachlichen Trümmerlandschaften bewegen, überhaupt noch einen lesbaren Aufsatz, einen präzisen Bericht, ein angemessenes Bewerbungsschreiben verfassen?“ (Z. 12 ff.), eingeleitet. Der Frage kann man entnehmen, dass man, wenn man die Kommunikationssprache betrachtet, unsicher ist, ob Jugendliche sich in der Hochsprache zurechtfinden. Der Autor bezieht sich, um diese Frage zu beantworten, auf eine Studie der Germanistik- Professorin Christa Dürscheid (vgl. Z. 15f.). Sie untersuchte 1000 Deutschaufsätze von 16- bis 18- jährigen Schülern verschiedener Schulformen und verglich diese dann mit Mitteilungen in sozialen Netzwerken etc., die von denselben Jugendlichen verfasst wurden (vgl. 16ff.). Das Ergebnis sei, dass die sprachlichen Elemente der Netzkommunikation keine nennenswerten Spuren in den Schultexten hinterlassen haben (vgl. Z. 24ff.). „'Die Schüler können die Schreibwelten durchaus trennen [und] sie wissen, dass […] andere Regeln gelten'“ (Z. 26ff.). Somit sieht der Autor in der elektronischen Kommunikation nicht die Ursache für die fehlerhaften Texte, da er die Studie ja als Begründung seiner These anführt.
Im letzten Sinnabschnitt (Z. 29- 39) nennt der Autor die eigentliche Ursache für die fehlerhaften Texte. Zunächst stellt er dar, dass „die elektronische Kommunikation als Verursacher ausscheidet“ (Z. 31f.). Die eigentliche Ursache sieht er in der „Entwicklung […] in den siebziger Jahren, als Deutschlehrer die Kinder stärker als zuvor zum freien, spontanen Schreiben ermutigten. (Z. 34ff.)“. Das „spontane Schreiben“ (ebd.) sieht er als „eigentlich begrüßenswerten Trend“ (Z. 36f.) an. Das Adjektiv „eigentlich“ (ebd.) lässt darauf schließen, dass der Autor diesen Trend abwägend betrachtet. Somit erklärt der Autor schließlich auch, dass dieser Trend auf Kosten „'harter' Sprachfertigkeiten wie der Orthografie“ (Z. 37f.) ginge. „'harte[...]' Sprachfertigkeiten“ (ebd.) hat eine ironische Bedeutung, was die Anführungszeichen betonen. Der Autor geht davon aus, dass diese Sprachfertigkeiten eigentlich gar nicht schwierig zu beherrschen sind. Außerdem führt der Autor an, dass die „formale Korrektheit […] an Bedeutung [verlor]“ (Z. 38), was auch eine negative Folge darstellt. Im letzten Satz ist von der formalen Korrektheit als „bildungsbürgerliche Schikane“ (Z. 39) die Rede. Somit behauptet der Autor, dass die formale Korrektheit als unnötig bzw. von manch einem als „Quälerei“ wahrgenommen wurde.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Autor der Meinung ist, dass die Probleme, die Jugendliche beim Schreiben haben, nicht durch die elektronische Kommunikation verursacht wird. Seine Thesen veranschaulicht er mithilfe von Beispielen und bezieht sich auf eine Studie, um diese zu bekräftigen.
Aufgabe 2
Der Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Sprache hat verschiedene Ursachen und bringt Konsequenzen mit sich.
Als Anglizismus bezeichnet man ein Wort, welches aus dem Englischen stammt und in einer anderen Sprache übernommen wurde. Anglizismen, die in der deutschen Sprache geläufig sind, wären z.B.: „Screenshot“, „Update“, „Cloud“ etc.
Ein Grund dafür, dass Anglizismen verwendet werden, ist der Kontakt zu der englischen Sprache. Es fängt z.B. in der Schule an, wo man die englische Sprache als erste Fremdsprache erlernt. Außerdem gibt es zahlreiche Begegnungen zwischen deutschen und englischen Schülern und den Kulturen, z.B. im Rahmen von Schüleraustauschen. Aber auch durch die stetig wachsende Globalisierung erhöht sich der Kontakt zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern und dann ist die englische Sprache meistens die Sprache, die zur Kommunikation verwendet wird. Die Menschen in Deutschland werden zudem vom Englischen beeinflusst. Dies geschieht über diverse Medien, z.B. durch Werbungen, Nachrichten, soziale Netzwerke etc.
Daraus ergeben sich folglich auch Konsequenzen. Einerseits wird die deutsche Sprache modernisiert. Einige Begriffe aus dem Englischen hören sich, in Abhängigkeit vom Gesamtzusammenhang, besser an als die deutsche Übersetzung. Somit ist z.B. das Wort „Screenshot“ geläufiger als „Bildschirmaufnahme“. Außerdem sind die meisten Wörter mittlerweile so geläufig, dass viele Menschen die Bedeutungen kennen. Andererseits stellen Anglizismen für die „ältere“ Generation eher ein Hindernis dar. Das kann man darauf zurückführen, dass diese im Vergleich zur „jüngeren“ Generation keinen so umfangreichen Kontakt zur englischen Sprache hatten bzw. haben. Eine weitere Konsequenz ist, dass womöglich der Bezug zwischen Anglizismen und Wörtern aus der Herkunftssprache verloren geht.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ursachen für Anglizismen auf den Kontakt mit anderen Menschen und den Einfluss durch Medien zurückzuführen ist. Dabei stellen sich Konsequenzen heraus, dass Anglizismen geläufiger und häufiger verwendet werden, aber die Gefahr besteht missverständlich aufgenommen zu werden.
Klausur, Aufgabe 2
Digitale Kommunikation bietet viele Möglichkeiten, bringt aber auch Gefahren mit sich. Durch die Nutzung digitaler Medien findet heutzutage somit eine Veränderung der Kommunikation statt.
Eine Möglichkeit, die die digitale Kommunikation bietet, ist die Schnelligkeit. Nachrichten werden schneller verbreitet, aber auch in der Kommunikation untereinander profitiert man von der schnellen Kommunikation via SMS, E-Mail und sozialen Netzwerken. Daraus resultiert dann auch eine Veränderung, die die Kommunikation prägt. Und zwar wird man jeden Tag mit digitalen Medien konfrontiert. E-Mails begleiten die meisten Menschen in ihren Berufen, wenn es z.B. um die Auslandskorrespondenz geht. Soziale Netzwerke werden von vielen Menschen, immer häufiger auch sehr jungen Leuten, genutzt. Dabei besteht aber die Gefahr, dass unerfahrene Menschen zunächst mit dem Umgang mit sozialen Netzwerken überfordert sind. Viele Menschen erleben im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken auch Ausgrenzung, Mobbing, diskriminierende Anfeindungen u.v.m. Aber auch Abhängigkeit, meistens bei jungen Menschen, ist eine Gefahr, die durch die Präsenz von digitalen Medien besteht. Dennoch bieten soziale Netzwerke die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Hier besteht aber wiederum die Gefahr von Anfeindungen usw. Neben der Schnelligkeit und freien Meinungsäußerung, die die digitale Kommunikation bietet gibt es noch weitere Vorteile der digitalen Kommunikation. Durch die Globalisierung ist der Kontakt und die Beziehung zu anderen Ländern sehr stark verbreitet worden. Dabei bietet dann die digitale Kommunikation die Möglichkeit mit anderen zu kommunizieren. Durch die schnelle Nachrichtenverbreitung erfährt man aktuelle Ereignisse nicht nur innerhalb des eigenen Landes, sonder auch aus aller Welt.
Die Aussage, dass wir in einer Zeit leben, die von digitaler Unverbindlichkeit geprägt sei, kann man folgendermaßen betrachten: Die digitale Kommunikation an sich bietet viele Vorteile, z.B. die Schnelligkeit der Kommunikation über die verschiedenen Medien wie SMS, E-Mails und soziale Netzwerke. Man hat die Möglichkeit über die Landesgrenze hinweg zu kommunizieren, was viele positive Einflüsse aus anderen Ländern und Kulturen mit sich bringt. Noch nie zuvor war die Kommunikation so einfach und fortschrittlich. Ein Kritikpunkt ist, dass die Generationen, die sich an der digitalen Kommunikation bedienen, bestimmte Verhaltensregeln nicht beachten und Werte verloren gehen. Dazu ist zu sagen, dass dies nicht verallgemeinert werden kann. Z.B ist die Wichtigkeit von Familie und Freunden sehr ausgeprägt. Eine Konsequenz des Nachlasses von verbaler Kommunikation ist die mögliche Vereinsamung und Isolation. In Foren hat man die Möglichkeit seine Meinung zu äußern, dennoch kann daraus auch Hass, Mobbing, Ausgrenzung usw. resultieren. Dabei lassen, wie gesagt, bestimmte Verhaltensregeln immer mehr nach, z.B. der respektable Umgang mit seinen Mitmenschen.
Zu der Überzeugungskraft des Textes ist zu sagen, dass seine Schilderung als subjektiv betrachtet werden muss. Es fehlen z.B. Belege für seine These und z.B. Studien, die seiner Argumentation Aussagekraft verleihen könnte, da dann nicht nur seine Meinung betrachtet wird. Dennoch ist auch zu sagen, dass der Text einen Erfahrungsbericht darstellt, deswegen den Leser emotional von seiner Authentizität überzeugt und auf eine bestehende Problematik hinweist.
Lyrik
Analyse "Es ist alles eitel", Andreas Gryphius
Das Gedicht „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius, welches im Jahr 1637, in der Epoche des Barocks, verfasst wurde, thematisiert die Vergänglichkeit alles Irdischen und historisch gesehen die Zerstörungen, die aus dem 30- jährigen Krieg resultierten.
Der Titel „Es ist alles eitel“ verweist auf das Thema des Gedichts, dass alles vergänglich ist und irgendwann nicht mehr existieren wird. Das Pronomen „alles“ (ebd.) steht verallgemeinernd dafür, dass jedes Lebewesen, jeder Gegenstand, aber auch bestimmte Situationen nicht ewig sind und irgendwann nicht mehr existieren. Das Gedicht besteht aus 14 Versen, welche in insgesamt vier Strophen eingeteilt sind. Die ersten beiden Strophen bestehen jeweils aus vier Versen, werden somit jeweils als Quartett bezeichnet, und die letzten beiden jeweils aus drei Versen und werden somit jeweils als Terzett bezeichnet. Als Versmaß ist durchgängig ein sechshebiger Jambus vorzufinden, was ein Merkmal der literarischen Epoche des Barocks war und als Alexandriner bezeichnet wird. Die erste Strophe beginnt mit dem Personalpronomen „Du“ (V.1), was einen Bezug zum Leser herstellt, ihn also direkt anspricht bzw. ihn direkt mit einbezieht. Die Repetitio „siehst“ (V.1) betont, dass die „Eitelkeit auf Erden“ (V.1) nicht zu übersehen ist. Die „Eitelkeit auf Erden“ (ebd.) bezieht sich auf den Titel des Gedichts und deutet auf die Vergänglichkeit des Lebens hin. Die Tatsache, dass die Vergänglichkeit des Lebens, also das Sterben, das Leid und die Tode, nicht zu übersehen ist, bringt gleichzeitig eine Klage über die derzeitigen Ereignisse, den 30- jährigen Krieg, mit sich. Im nächsten Vers ist davon die Rede, dass das, was heute gebaut werde, morgen wieder zerstört sei (vgl. V. 2). Die Adverbien „heute“ (V. 2) und „morgen“ (V. 2)und die Verben bauen (vgl. V. 2) und einreißen (vgl. V. 2) stehen sich antithetisch gegenüber und verdeutlichen, dass der derzeitige Zustand nicht von Dauer ist und am nächsten Tag oder sogar schon in den nächsten Stunden alles anders sein kann. In dem Zusammenhang ist es der Krieg, der für die Zerstörung sorgt. Eine weitere Antithese ist im nächsten Vers zu finden. „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3), verdeutlicht wieder die Zerstörung der Dinge des derzeitigen Zustands und die Veränderung, die im zukünftigen Zustand herrscht. Die „Wiese“ (ebd.), kann man als ein Symbol für Frieden interpretieren, da es in Städten meistens laut und hektisch ist und auf Wiesen bzw. in der Natur eher Ruhe herrscht. Die zweite Strophe setzt zunächst mit einer Antithese „Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5) ein. Das Verb „blühen“ (ebd.) kann man so interpretieren, dass etwas, sei es ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze, gedeiht und lebt. Dadurch, dass es „zertreten [wird]“ (ebd.), wird das Leben beendet. Somit wird metaphorisch die Vergänglichkeit des Lebens dargestellt. Im nächsten Vers wird antithetisch dargestellt, dass „was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V. 6). Das Verb „pochen“ (ebd.) steht metaphorisch für einen Herzschlag, also für etwas lebendiges. Die Metapher „Asch und Bein“ (ebd.) steht für den Tod. Mittels dieser Antithese wird wieder deutlich gemacht, dass das Leben nicht ewig ist und es „morgen“ (ebd.) vorbei sein könnte. Darauf eingehend ist davon die Rede, dass „Nichts […] ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein“ (V. 7). Die Aufzählung „kein Erz, kein Marmorstein“ (ebd.) betont, dass „nichts“ (ebd.), selbst beständige Gesteine wie Erz und Marmor, für immer existieren werden. Im letzten Vers veranschaulicht die Personifikation 'das lachende Glück' (vgl. V. 8), dass, in diesem Zusammenhang gesehen, die Zeiten vor dem Krieg mit besseren Erinnerungen in Verbindung gebracht werden und man Vorstellungen hat, dass das Leben ohne das Leid, das der Krieg mit sich bringt, bessere wäre. Als Folge würden „bald […] die Beschwerden [donnern]“ (V. 8), was den Unmut und das Verlangen nach Frieden betont. Zum Reimschema der ersten beiden Strophen kann man sagen, dass es sich bei beiden jeweils um einen umarmenden Reim handelt. Die dritte Strophe wird sozusagen mit dem Appell „Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehen“ (V. 9) eingeleitet. Es wird betont, dass Rum nicht das wichtigste im Leben ist, da er schnell wieder vergehen kann. Die darauf folgende rhetorische Frage „Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehen?“ (V. 10) stellt mittels der Metapher „Spiel der Zeit“ (ebd.), was für die Lebenszeit steht, dar, dass diese für den Menschen begrenzt ist. Die Interjektion „Ach“ (V. 11) betont die Zweifel, die beim lyrischen Ich aufkommen. Es fragt anschließend „was ist alles dies, was wir für köstlich achten“ (V. 11). Dadurch wird deutlich, dass nicht die wichtigen Dinge im Leben, wie z.B. der Ruhm, geschätzt werden sollten, da diese ja vergänglich sind und eigentlich keinen Wert haben. Ein Enjambement verbindet schließlich die dritte mit der letzten Strophe, in der weiter auf die Frage eingegangen wird. Hier wird betont, dass das, was man als wichtig erachtet nichts „als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, / als eine Wiesenblum, die man nicht wieder find't“ (V. 12f.) sei. Die „Nichtigkeit“ (ebd.), also die Irrelevanz der Dinge, die man vermeidlich als wichtig empfindet, wird durch die Akkumulation „Schatten, Staub und Wind“ (ebd.) betont. Ein Schatten ist vom Sonnenstand abhängig, Staub kann so klein sein, dass man ihn gar nicht bemerkt und der Wind weht nicht konstant. Auch die Veranschaulichung durch die „Wiesenblum, die man nicht wieder find't“ (ebd.) betont auch die Irrelevanz. Denn eine bestimmte Blume kann man auf einer Wiese mit tausend anderen Blumen nur schwierig wiederfinden. Im letzten Vers beklagt sich das lyrische Ich, dass das, „was ewig ist, kein einig Mensch betrachten [will]“ (V. 14). Die meisten Menschen erkennen also noch nicht, was zu den wichtigen Dingen im Leben gehört und dass an zu vielen unnötigen Dingen, wie z.B. Krieg, festgehalten wird.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass in dem Gedicht durch Antithesen und Metaphern die Vergänglichkeit alles Irdischen verdeutlicht wird. Anschließend wird die Frage gestellt, ob das, was der Mensch als wichtig betrachtet, z.B. Krieg zu führen und zu gewinnen, die Mühe wert ist.
Analyse "Kleine Aster", Gottfried Benn
Das Gedicht „Kleine Aster“, welches von Gottfried Benn geschrieben und im Jahr 1912 veröffentlicht wurde und der Epoche des Expressionismus zuzuordnen ist, handelt von der Entindividualisierung des Menschen.
Die Überschrift „Kleine Aster“ weist zunächst nicht auf das Thema des Gedichts hin. Das Adjektiv „klein[...]“ (ebd.) lässt die „Aster“ (ebd.), welche im Herbst blüht, sanft, zierlich und zerbrechlich wirken. Der Herbst wird meistens mit Vergänglichkeit assoziiert, was man als Vorausdeutung auf den Tod interpretieren kann.
Das Gedicht weist kein Metrum und kein festes Reimschema auf. Es lässt sich dennoch in drei Sinnabschnitte gliedern. Im ersten Sinnabschnitt (V. 1- 3) wird zunächst die Situation geschildert. Es ist von „ein[em] ersoffenem Bierfahrer [,der] auf den Tisch gestemmt [wurde]“ (V. 1) die Rede. Daraus kann man schließen, dass die Leiche einer Obduktion unterzogen wird. Der unbestimmte Artikel „ein“ (ebd.) deutet darauf hin, dass die Leiche nur eine von vielen Leichen ist und somit keine Bedeutsamkeit hat. Die Tatsache, dass die Leiche „gestemmt“ (ebd.) wurde, deutet auf einen pietätlosen Umgang hin. In den nächsten Versen wird beschrieben, dass „irgendeiner […] eine dunkelhelllila Aster zwischen die Zähne geklemmt [hatte]“ (V. 2f.). Das Indefinitpronomen „irgendeiner“ (ebd.) steht wieder für die Bedeutungslosigkeit des Menschen, denn es ist einer von vielen gemeint. Der Neologismus „dunkelhelllila“ (ebd.) ist zugleich ein Paradoxon. Der Widerspruch hat eine verwirrende Wirkung, dennoch die Funktion, die Aster in den Fokus zu rücken. Die Skurrilität und Absurdität wird zudem durch die Beschreibung, dass die Blume „zwischen die Zähne geklemmt [wurde]“ (ebd.), verstärkt dargestellt. Das Verb „geklemmt“ (V. 3) bildet einen Reim mit dem Verb „gestemmt“ (V. 1), wodurch der pietätlose Umgang mit der Leiche betont wird.
Der zweite Sinnabschnitt (V. 4- 12) stellt eine detaillierte Schilderung des Vorgehens der Obduktion dar. Der Enjambement „Als ich von der Brust aus / unter der Haut / mit einem langen Messer / Zunge und Gaumen herausschnitt, / muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt / in das nebenliegende Gehirn“ (V. 4- 9) verdeutlicht die Zusammengehörigkeit dieses Teils. Auffällig ist dabei die sachliche und emotionslose Schilderung des Prozesses, was gleichzeitig auf die nicht vorhandene emotionale Bindung des lyrischen Ichs zum Menschen hindeutet. Die Substantive „Brust“ (V. 4), „Haut“ (V. 5), „Zunge und Gaumen“ (V. 7), „Gehirn“ (V. 9) und „Brusthöhle“ (V. 10) kann man dem Wortfeld „Mensch“ zuordnen. Dabei wirkt die objektive Schilderung emotionslos gegenüber dem Menschen als ein Lebewesen. Darauf folgend wird wieder sachlich beschrieben, dass das lyrische ich die Aster „in die Brusthöhle / zwischen die Holzwolle [packte], / als man zunähte“ (V. 1O ff.). Die Sachlichkeit des Vorgangs steht hierbei wieder für die Gleichgültigkeit des lyrischen Ichs gegenüber der Leiche. Die Blume weist, im Gegensatz zur Leiche, eine hohe Bedeutung für das lyrische Ich auf, da sie, anstatt weggeschmissen zu werden, in die Brust der Leiche eingebettet wird. Die Ellipse „als man zunähte“ (V. 12) deutet auf die Irrelevanz des Menschen hin. Durch das fehlende Personalpronomen in dem Satz wird kein näherer Bezug auf die Leiche genommen.
Der letzte Sinnabschnitt (V. 13- 15) verdeutlicht die emotionale Bindung des lyrischen Ichs zu der Aster durch zwei Ausrufe. Dieser beginnt zunächst mit dem Ausruf, „Trinke dich satt in deiner Vase!“ (V. 13). Die Personifikation, dass sich die Blume satt trinken soll (ebd.), deutet auf die Bedeutung der Blume für das lyrische Ich hin. Es hat eine emotionale Bindung zu der Blume aufgebaut und wünscht sich, dass die Blume weiterleben kann. Auch dadurch, dass das lyrische Ich die Aster durch das Personalpronomen „dich“ (V. 13) direkt anspricht, wird die emotionale Bindung deutlich. Die Leiche fungiert nun als Vase für die Blume (vgl. V. 13), sie wird also als ein Gegenstand angesehen und hat somit nur eine funktionale Bedeutung, was die Gleichgültigkeit betont. Der zweite Ausruf „Ruhe sanft, / kleine Aster“ (V. 13 f.), welcher durch einen Enjambement getrennt wird, verdeutlicht die Besorgnis des lyrischen Ichs. Der Enjambement trennt den Ausruf, sodass „kleine Aster“ (ebd.) den letzten Vers bildet. Dadurch, dass die Überschrift im letzten Vers wiederzufinden ist, wird deutlich, dass es nicht um den Menschen geht. Da die letzten Worte des lyrischen Ichs der Aster gelten, wird schließlich wieder die Bedeutungslosigkeit des Menschen deutlich.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in dem Gedicht durch rhetorische Mittel, wie z.B. Ausrufen und Enjambements, die Gefühlsverbundenheit des lyrischen Ichs zu einer einfachen Blume und die zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber einer Leiche deutlich wird.
Vergleich Vergänglichkeit ("Es ist alles eitel" und "Kleine Aster")
Die Gedichte „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius, welches im Jahr 1637 verfasst wurde und der Epoche des Barocks zuzuordnen ist, und „Kleine Aster“ von Gottfried Benn, welches im Jahr 1912 verfasst wurde und dem Expressionismus zuzuordnen ist, thematisieren die Vergänglichkeit. Beide Gedichte weisen trotz der selben Thematik wesentliche Unterschiede auf.
Im Gegensatz zu Benns Gedicht thematisiert das Gedicht von Gryphius die Vergänglichkeit im Allgemeinen. Historisch gesehen basiert das Gedicht auf dem 30- jährigen Krieg. Wesentliche Elemente des Vanitas- Gedankens, memento mori und carpe diem, findet man deswegen in dem Gedicht wieder. Man lebte mit dem Gedanken, dass jeder Tag der letzte sein könnte. Die ersten beiden Strophen beinhalten Gegenüberstellungen (vgl. V. 2+3+5+6), die veranschaulichen, dass nichts so bestehen bleibt, wie man es erschaffen hat bzw. wie man es kennt. Einerseits ist damit die Zerstörung und Vergänglichkeit gemeint (vgl. V. 2+5+6), andererseits wird auch die Hoffnung auf Frieden zum Ausdruck gebracht (vgl. V. 3). In den letzten beiden Strophen wird die Bedeutung des Lebens hinterfragt und ob das, was man für wichtig hält, tatsächlich von hoher Bedeutung ist. Schließlich kommt das lyrische Ich zu dem Entschluss, dass das „was ewig ist, kein einig Mensch betrachte[t]“ (V. 14). Hier wird auf das Überirdische angespielt, also auf Gott, und dass dieser ewig ist. Benns Gedicht thematisiert die Vergänglichkeit des Menschen als ein Individuum. Während der Epoche des Expressionismus, ca. 1910- 1925, wurden die Menschen durch die zunehmende Industrialisierung und Verstädterung verunsichert. In Benns Gedicht wird die Bedeutungslosigkeit des Menschen durch den emotionslosen Umgang eines Pathologen mit einer Leiche veranschaulicht. Dazu kommt, dass dieser eine emotionale Bindung zu einer Aster aufbaut, die er in der Leiche findet. Diese Gegenüberstellung, dass eine Blume eine höhere Bedeutung hat als ein Mensch, betont die Bedeutungslosigkeit des Menschen um ein weiteres.
Zum formalen Aspekt ist bei Gryphius' Gedicht zu sagen, dass es sich um ein Sonett handelt. Dabei ist eine festgelegt Form vorzufinden: Das Gedicht ist in vier Strophen eingeteilt, die ersten beiden haben jeweils vier Verse und die beiden letzten haben jeweils drei Verse. Die ersten beiden Strophen bilden dabei jeweils einen umarmenden Reim und die letzten beiden eine Schweifreim. Bei dem Metrum handelt es sich um einen Alexandriner, also einem sechshebigen Jambus mit einer Zäsur, mit abwechselnd männlichen und weiblichen Kadenzen. Die Regelmäßigkeit und feste Form kann man so deuten, dass die Zerstörung durch den Krieg ein zu der Zeit ein Dauerzustand war. Zur Sprache ist zu sagen, dass die Zäsuren durch ein Komma hervorgehoben werden, was zusätzlich die Funktion hat, die Gegenüberstellungen und damit die Vergänglichkeit zu verdeutlichen (vgl. V. 2). Die Verwendung von Metaphern „Schatten, Staub und Wind“ (V. 12) dienen auch zur Veranschaulichung der Vergänglichkeit. Bei Benns Gedicht sind kein Reimschema, kein Metrum und keine Strophen vorhanden. Dies betont die Orientierungslosigkeit der Menschen zur Zeit der Industrialisierung. Der pietätlose Umgang mit der Leiche wird unter anderem durch die Verben „gestemmt“ (V.1) und „geklemmt“ (V. 3), die in dem ganzen Gedicht zur Betonung den einzigen Reim bilden, beschrieben. Fehlende Pronomen (vgl. V. 12) und Indefinitpronomen (vgl. V. 1+2) verdeutlichen die fehlende Identität des Menschen sowie die sachliche Beschreibung der Obduktion (vgl. V. 4 ff.) die Gleichgültigkeit betont. Die emotionale Bindung zu der Aster wird durch Ausrufe (vgl. V. 13 ff.) dargestellt.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Thematik der Vergänglichkeit in den unterschiedlichen Epochen, basierend auf den unterschiedlichen historischen Ereignissen, jeweils anders interpretiert wurde.
Gryphius „Es ist alles eitel“
Thema: Vergänglichkeit im Allgemeinen
→ Vergänglichkeit Materialien, alles was der Mensch aufgebaut hat, der Mensch selber, Werte (Ruhm, Geld etc.)
- Fragestellung: Was ist wirklich wichtig? Was ist ewig?
- historischer Hintergrund 30- jähriger Krieg
- Distanz zu Unvergänglichem
sprachlich-formal:
- Sonett
- 14 Verse, eingeteilt in 4 Strophen
→ 1./ 2. Strophe jeweils 4 Verse, jeweils umarmender Reim; 3./ 4. Strophe jeweils 3 Verse, bilden einen Schweifreim
- Rhythmus: Alexandriner → 6- hebiger Jambus mit Zäsur
- Interpunktionen verdeutlichen Zäsur; Gegensätze werden beschrieben, die Vergänglichkeit betonen (vgl. V. 2+3++5+6)
Benn „Kleiner Aster“
Thema: Vergänglichkeit des Menschen als ein Individuum
- Wertlosigkeit des Menschen/ emotionsloser Umgang dargestellt durch: Verben, die pietätlosen Umgang beschreiben; Enjambement, der Prozess einer Obduktion sachlich beschreibt
- Aster nimmt eine höhere Bedeutung eingeteilt
→ Emotionen z.B. durch Ausrufe dargestellt
- Orientierungslosigkeit des Menschen durch technischen Fortschritt
- kein Reimschema -> Orientierungslosigkeit
sprachlich-formal:
- 15 Verse, keine Strophen (evtl. Sinnabschnitte: V. 1-3; 4- 12; 13- 15)
- kein festes Reimschema; Ausnahme: V. 1+3 → Betonung pietätloser Umgang
- kein Metrum
- Entpersonalisierung durch fehlende Pronomen (z.B. V. 12), Indefinitpronomen (V. 1+2)
- skurrile Wirkung (z.B. V. 2+3)
- sachliche Beschreibung (Enjambement): Gleichgültigkeit
Analyse "Untreu", August Stramm
Das Gedicht „Untreu“ von August Stramm, veröffentlicht im Jahr 1915, in der Epoche des Expressionismus, thematisiert Vertrauensbruch und den Zerfall einer Beziehung.
Aus dem Titel des Gedichts kann man schließen, dass das lyrische Ich hintergangen wurde. Der erste Sinnabschnitt (V. 1-3) wird mit „Dein Lächeln weint in meiner Brust“ (V. 1) eingeleitet. Mit dem Possessivpronomen „dein“ (ebd.) spricht das lyrische Ich seinen Partner direkt an. Die Personifikation „Lächeln weint“ (ebd.) stellt gleichzeitig ein Paradoxon dar, welches die Trauer des lyrischen Ichs um den Partner betont. Die Darstellung, dass das Lächeln in seiner Brust weine (vgl. V. 1), also an der Stelle wo das Herz liegt, betont die Liebe und die Verbundenheit, die das lyrische Ich empfunden hat. Die Beschreibung der „glutverbissnen Lippen“ (V. 2), steht für die Leidenschaft die zwischen den Geliebten herrschte. Diese „eisen“ (V. 2) nun, was antithetisch zu den „glutverbissnen Lippen“ (ebd.) steht und die nachlassenden Gefühle und die zunehmende Kälte, also die Gleichgültigkeit gegenüber dem Partner, ausdrückt. Der Ausruf „Im Atem wittert Laubwelk!“ (V. 3) steht metaphorisch für Vergänglichkeit. Im Herbst fängt das Laub an zu welken - „Laubwelk“ (ebd.) - und den Herbst assoziiert man häufig mit Vergänglichkeit. Das Verb „wittert“ (ebd.) lässt auf eine Vorahnung des lyrischen Ichs schließen, also das es mit der Beziehung abschließen will.
Im zweiten Sinnabschnitt (V. 4- 8) geht es darum, dass das lyrische Ich mit dem Vertrauensbruch und der Beziehung abschließt. Die Metapher „ Dein Blick versargt“ (V. 4), deutet auf diesen Abschluss mit einer düster wirkenden Stimmung hin. Zunächst spricht das lyrische Ich seinen Partner mit dem Possessivpronomen „dein“ (ebd.) wieder direkt an. Das Verb „versargt“ (ebd.) ist ein Neologismus, der sich von dem Substantiv „Sarg“ ableitet. Daraus ist zu schließen, dass das lyrische Ich seine Trauer über den Vertrauensbruch des Partners begräbt. Gleichzeitig assoziiert man einen Sarg mit einer Beerdigung und somit auch dem Tod, was an dieser Stelle für eine düstere Stimmung sorgt. Die Konjunktion „und“ (V. 5) bildet einen eigenen Vers, was eine betonende Wirkung hat. Es wird eine Überleitung zum nächsten Vers geschaffen. Dort heißt es, dass „polternd[e] Worte“ (V. 6) folgen. Das Verb „polternd“ (V. 6) löst eine unruhige Stimmung aus, was man auch als Wut, die das lyrische Ich verspürt deuten kann. Das Verb „vergessen“ (V. 7) bildet zur Betonung auch einen eigenen Vers. Betont wird, dass das lyrische Ich einerseits vergessen will, was vorgefallen ist, andererseits möchte es die Beziehung hinter sich lassen. Ein weiterer Ausruf, „Bröckeln nach die Hände!“ (V. 8), veranschaulicht den Schock des lyrischen Ichs. Das Verb „bröckeln“ (ebd.) kann nebenbei auch für den Zerfall der Beziehung stehen.
Der letzte Sinnabschnitt (V. 9- 12) wird anhand des „Klaudsaum[s]“ (V. 10) deutlich, dass das lyrische Ich von einer Frau hintergangen wurde. Mit „Frei / Buhlt dein Kleidsaum“ (V. 9f.) sagt das lyrische Ich aus, dass es nichts mehr mit seiner Geliebten zu tun haben will und somit die Beziehung endgültig beendet. Das Adjektiv „frei“ (ebd.) hat dabei eine betonende und einleitende Funktion. Das Verb „buhlt“ (ebd. ) bedeutet, dass jemand eine Liebschaft hat, in dem Zusammenhang heißt das also, dass das lyrische Ich von der Liebschaft der Geliebten weiß und sich mehr oder weniger abwertend von ihr abwendet. Der letzte Vers bildet einen Ausruf „Drüber rüber!“ (V. 12), was die Abwendung des lyrischen Ichs von der Beziehung ausdrückt. Die Adverbien „drüber“ (ebd.) und „rüber“ (ebd.) sind umgangssprachlich und bedeuten in dem Zusammenhang so viel wie „über etwas hinweg sein“.
Zur Form ist zu sagen, dass das Gedicht aus zwölf Versen besteht und keine Strophen aufweist. Zudem gibt es kein Reimschema und auch kein Metrum. Auffällig ist dennoch, dass das Gedicht viele Enjambements aufweist. Dies hat eine beschreibende Wirkung über die Situation in der sich das lyrische Ich sich befindet. Außerdem wird dadurch die Gefühlslage, Trauer und Entsetzen über den Betrug der Geliebten, verdeutlicht.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Gefühle, die bei einem Vertrauensbruch aufkommen durch Metaphern und Ausrufe dargestellt werden. Die entsetzliche Lage und das Chaos der Gefühle, die das lyrische Ich empfindet wird durch das fehlende Reimschema und Metrum und durch die Enjambements verdeutlicht.