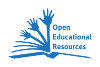Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Benutzer:LDümmer
Inhaltsverzeichnis |
Faust
Inhaltsangabe Faust
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Faust“ handelt es sich um den ersten Teil der gleichnamigen Tragödie, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahre 1808. Die Handlung setzt mit einer Wette zwischen Gott und dem Teufel, der hier als Mephistopheles bezeichnet wird, ein. Die Wette besteht darin, dass Mephistopheles versuchen will Faust, einen Doktor der immer auf dem rechten Weg gewandert ist und sein Leben der Wissenschaft verschrieben hat, von diesem Weg abzubringen. Gott ist sich seines Sieges bewusst und lässt ihn daher gewähren. Heinrich Faust ist ein verzweifelter Wissenschaftler, der zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er nicht alles Wissen kann. Während eines Spaziergangs begegnet er einem Hund, den er mit nach Hause nimmt. Der Hund jedoch gibt sich bald als Mephistopheles zu erkennen und schließt mit Faust einen Pakt: Wenn er es schafft Faust vollends glücklich zu machen erhält er dessen Seele. Zunächst versucht Mephistopheles Faust, der den Pakt eingegangen ist, Freude zu bereiten, doch bereits beim ersten Versuch scheitert er. Als nächstes ermutigt er Faust einen Trank zu nehmen, der ihn jünger macht. Infolge dessen begegnet Faust Gretchen, in die er sich verliebt. Mit der Hilfe Mephistopheles gelangt er in ihr Schlafzimmer und schenkt ihr Schmuck. Gretchen, die ihrer Nachbarin davon berichtet, zeigt ebenfalls Interesse an Faust. Während des Gespräches erscheint Mephistopheles bei der Nachbarin, um ihr mitzuteilen dass ihr Mann verstorben ist. Diese wiederum lädt Mephistopheles und Faust für den Abend ein, damit Gretchen sich mit Faust unterhalten kann. Gretchen und Faust verlieben sich ineinander und es kommt zum ersten Kuss. Faust verführt Gretchen dazu ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Gretchens Mutter stirbt jedoch an dem Trank. In der darauf folgenden Nacht kehrt Gretchens Bruder Valentin nach Hause zurück und fordert Faust zu einem Duell heraus. Faust gewinnt das Duell und tötet Valentin. Daraufhin muss dieser fliehen und lässt Gretchen zurück. Auf der Flucht versucht Mephistopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust hat unterdessen eine Erscheinung, dass Gretchen in Gefahr ist und kehrt zurück um sie zu retten. Er findet sie im Kerker, wo sie ihm gesteht, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die Tragödie endet damit, dass Gott Gretchen im Himmel aufnimmt. Kommentar von Carina: Du hast eine gut strukturierte Inhaltsangabe verfasst und ebenfalls eine gute Wortwahl verwendet. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag von mir ist, dass du einige, meiner Meinung nach, überflüssige Kleinigkeiten eingebaut hast. Beispielsweise hättest du die Beziehung von Mephisto zu Gretchens Nachbarin weglassen können.
Faust: "Nacht" V.353-385
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Faust“ handelt es sich um einen Auszug aus dem ersten Teil der gleichnamigen Tragödie, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahre 1808. Thematisiert wird das Streben nach dem Unerreichbaren. Protagonist der Handlung ist der Wissenschaftler Heinrich Faust, der zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er nicht alles Wissen kann. Wenig später begegnet Faust dem Teufel Mephistopholes und lässt sich mit diesem auf einen Pakt ein: Wenn er es schafft Faust vollends glücklich zu machen erhält er dessen Seele. Während Mephistopheles versucht seinen Teil der Abmachung zu erfüllen verliebt sich Faust in Gretchen. Gretchen, die ebenfalls Interesse an Faust zeigt, lässt sich von diesem verführen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Die Mutter jedoch stirbt an dem Trank und Gretchens Bruder wird von Faust im Duell getötet, woraufhin dieser fliehen muss und Gretchen zurücklässt. Auf der Flucht versucht Mephistopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust jedoch kehrt zu Gretchen zurück und findet diese im Kerker, wo sie ihm gestehet, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die zu analysierende Textstelle setzt ein mit dem Ausruf Fausts: „Habe nun, ach! Philosophie,/ Juristerei und Medizin“ (V.354 f.). Die Anzahl der Studienfächer kennzeichnet Faust als eine gelehrte Person. Auffällig ist jedoch die Interjektion „ach!“ (ebd.), welche trotz des hohen Wissensstandes eine gewisse Unzufriedenheit in Bezug auf die Studienfächer verdeutlicht. Faust ergänzt die Studienfächer um ein weiteres mit der Aussage: „Und leider auch Theologie“ (V.365). Das Adverb „leider“ (ebd.) in Bezug auf das Studium der Theologie verdeutlicht die Unzufriedenheit Fausts. Die Theologie steht generell im Kontrast zu den anderen Studienfächern, da es sich bei diesen um faktenbasierte Wissenschaften handelt und diese nicht, wie die Theologie unlösbare Fragen aufwerfen. Faust selbst berichtet, er habe „mit heißem Bemühen [studiert]“ (V. 357). Der Ausdruck „mit heißem Bemühen“ (ebd.) ist eine unreine Synästhesie, welche verdeutlichen soll wie intensiv und ehrgeizig Faust in seinem Studium vorgegangen ist. Im weiteren Verlauf erklärt Faust: „Da steh ich nun, ich armer Tor!/ Und bin so klug als wie zuvor“ (V. 358 f.). Die beiden Aussagen stehen im Gegensatz zu einander, da Faust sich in der ersten Aussage als „armer Tor“ (V.358) beschreibt und in der zweiten Aussage erläutert, er sei „so klug als wie zuvor“ (V.359). Zuvor hat Faust ganze vier Fächer studiert und bezeichnet sich dennoch als einen armen Narren. Diese Aussagen sind ebenfalls als Unzufriedenheit Fausts zu interpretieren. Als nächstes berichtet er, er„heiße Magister“ (V.360) und er „heiße Doktor“ (ebd.), damit sind die akademischen Titel gemeint, die er während seines intensiven Studiums errungen hat und die seinen Erfolg als Wissenschaftler verdeutlichen sollen. In den folgenden Versen wird erläutert, dass Faust bereits seit mehreren Jahren Lehrer ist und seine Schüler „an der Nase herum[führt]“ (V. 363), was bedeutet, dass er seinen Schülern aus seiner Sicht nichts Sinnvolles beibringt und im Zusammenhang mit der Unzufriedenheit am Anfang der Textstelle steht. In den Jahren als Lehrer ist er ebenfalls zu der Erkenntnis gekommen, „dass wir nichts wissen können“ (V. 364). Diese Erkenntnis vertrat ursprünglich der griechische Philosoph Sokrates, welcher versuchte damit zu verdeutlichen, dass wir Menschen so bedeutungslos im Universum sind, sodass wir nichts wissen können. Nach dieser Erkenntnis ist Faust so verzweifelt, dass es ihm „schier das Herz verbrenn[t]“ (V. 365). Faust bezeichnet sich selbst als „gescheiter als alle die Laffen,/ Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen“ (V.366 f.), was eine gewisse Arroganz verdeutlicht, da er sich selbst über Gelehrte und Priester stellt. Untermauert wird dies ebenfalls durch die Aussagen: „Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel“ (V. 368) und „Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel“ (V.369), wobei letzteres ebenso eine Vorrausdeutung für die zukünftige Handlung ist. Seine Verzweiflung wird ebenfalls darin bestätigt, dass ihm „alle Freud entrissen [wurde]“ (V.370). Die folgende Anapher: „Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,/ Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren“ (V. 371 f.) steht im Kontrast zu den vorherigen Aussagen, da Faust dort erwähnte, dass er sehr gebildet ist und seit Jahren Schüler unterrichtet. Er habe zudem „weder Gut noch Geld, Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt“ (V. 374), was veranschaulicht, dass er seiner Ansicht nach nichts Weiteres als unnützes Wissen besitzt. Aus diesem Grund habe er sich, seiner Aussage nach „der Magie ergeben“ (V. 377), damit ihm „durch Geistes Kraft und Mund/ Nicht manch Geheimnis würde kund“ (V. 378 f.) und er „nicht mehr, mit saurem Schweiß,/ Zu sagen brauche was [er] nicht weiß“ (V. 380 f.). Faust, dem es missfällt nicht alles wissen zu können, versucht nun in der Magie nach antworten zu suchen. Die Metapher „saure[r] Schweiß“ (V. 380) verdeutlicht ebenfalls die Unzufriedenheit Fausts. Auffällig ist, dass die Magie im Gegensatz zu den Studienfächern zu Beginn der Textstelle nicht in irgendeiner Form belegbar ist und es Faust somit nicht möglich wäre sein Wissen, welches er durch die Magie erlangt, in wissenschaftlicher Form zu erklären oder anderen glaubhaft zu vermitteln. Im weiteren Verlauf wird Fausts Wunsch, „dass [er] erkenn[t], was die Welt/ Im Innersten zusammenhält“ (V. 382 f.). Die Textstelle endet mit der Aussage: „Schau alle Wirkenskraft und Samen,/ Und tu nicht mehr in Worten kramen“ (V. 384 f.). Er legt dar, dass er erkennen möchte was die Welt antreibt, anstatt zu versuchen es irgendwie zu erklären, was an der Metapher „alle Wirkenskraft und Samen“ (V. 384) veranschaulicht wird. Zum Schluss ist zusammenzufassen, dass Faust aufgrund seiner Erkenntnis, nicht alles wissen zu können, verzweifelt und unzufrieden ist. Diese Tatsache impliziert in ihm den Wunsch zu sehen wie die Welt funktioniert, dies ist ihm jedoch mit gewöhnlichen Methoden nicht möglich, weshalb er sich der Magie zuwendet. Feedback von Annika: Ich finde du bist sehr gut auf die wichtigsten Aspekte der Textstelle eingegangen und hast diese auch gut gedeutet. Außerdem hast du deine Analyse sehr angenehm formuliert. Sie lässt sich gut lesen und verstehen, aber auch deine Wortwahl ist super. Wie ja auch bereits besprochen, könntest du aber den Pudel kürzer fassen bzw. komplett raus lassen und gegebenenfalls noch die "heißen Magister" abändern. Am Schluss fängst du an nur noch zu zitieren und erläuterst nicht mehr, was du im vorherigem Teil deiner Analyse gut gemacht hast. Ich finde im Ganzen ist es eine gelungene Analyse :)
Faust: "Gretchens Stube" V.3374-3413
Bei dem vorliegenden Text, handelt es sich um die Szene „Gretchens Stube“ aus dem ersten Teil der Tragödie „Faust“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe im Jahr 1808. Thematisiert wird die Frage des Menschen hinsichtlich der Lebensbezüge. Die Szene „Gretchens Stube“ beschreibt die Gefühle Gretchens für Faust. Faust, der zu Beginn der Tragödie erkannt hat, dass er nicht in der Lage ist alles zu wissen und aus diesem Grund einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles eingegangen ist, welcher ihm versprach ihn für den Preis seiner Seele vollends glücklich zu machen. Mephistopheles ist mit seinen Versuchen Faust glücklich zu machen gescheitert bis dieser Gretchen traf. Gretchen lässt sich von Faust verführen ihrer Mutter einen Trank zu verabreichen, damit sie sich Nachts treffen können. Die Mutter jedoch stirbt an dem Trank und Gretchens Bruder wird von Faust im Duell getötet, woraufhin dieser fliehen muss und Gretchen zurücklässt. Auf der Flucht versucht Mephisopheles Faust abzulenken und verschweigt ihm Gretchens Schwangerschaft. Faust jedoch kehrt zu Gretchen zurück und findet diese im Kerker, wo sie ihm gesteht, dass sie ihr gemeinsames Kind getötet hat. Faust versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Gretchen entscheidet sich dagegen und somit für die Todesstrafe. Die Szene ist insofern für die Handlung wichtig, als dass das Interesse Gretchens, auf welchem die Liebesgeschichte zwischen ihr und Faust beruht, verdeutlicht wird. Der Monolog Gretchens, welcher in Form eines Liedes verfasst ist, lässt sich in drei Sinnabschnitte gliedern, die formal durch den Refrain voneinander getrennt sind. Das Lied setzt mit dem Refrain ein, somit bilden die Strophen zwei und drei einen Sinnabschnitt, in dem Gretchen ihre eigenen Gefühle beschreibt. Der darauf folgende zweite Sinnabschnitt erstreckt sich über die Strophen fünf, sechs und sieben, da die vierte Strophe wieder den Refrain beinhaltet. Thematisiert wird diesmal allerdings Faust und die Abhängigkeit Gretchens von diesem. Der letzte Sinnabschnitt ist nach dem Refrain in der achten Strophe zu verorten und legt Gretchens Wünsche und Sehnsüchte dar. Insgesamt umfasst das Lied zehn Strophen zu je vier Versen. Das Metrum wird durch zwei- und dreihebige Jamben gekennzeichnet. Als Reimschema liegen hauptsächlich unterbrochene Kreuzreime vor, aber auch vollständige Kreuzreime und Paarreime sind zu finden. Das Leid ist in der Literaturepoche des Sturm und Drang entstanden, da die Gefühle der Figuren im Vordergrund stehen. Die zu analysierende Textstelle setzt mit der Aussage Gretchens: „Meine Ruh ist hin“ (V.3374) ein. Diese Aussage ist auf die vorherigen Ereignisse, wie dem Tod der Mutter und die erste Begegnung mit Faust, zu beziehen. Da all diese Ereignisse mit Menschen in Verbindung stehen, die Gretchen viel bedeuten und ihre Familie bildeten, ist diese nun innerlich erschüttert und auf sich selbst gestellt. Ebenfalls klagt sie „[ihr] Herz ist schwer“ (V. 3375), was veranschaulicht, dass sie sehr unter der Trennung von Faust leidet. Die darauf folgende Äußerung: „Ich finde sie nimmer / und nimmermehr“ (V. 3376 f.) verdeutlicht in Bezug auf ihre innere Unruhe und die Trennung von Faust, dass sie sich der Endgültigkeit ihrer Gefühle Faust betreffend sicher ist. Dies wird ebenfalls zu Beginn der zweiten Strophe aufgegriffen, in der sie behauptet: „Wo ich ihn nicht hab, / Ist mir das Grab“ (V. 3379 f.). Gretchen sieht demnach keinerlei Sinn ohne Faust weiter zu leben, ihr Leben ist dementsprechend abhängig von ihm. Der Ausdruck: „Die ganze Welt / ist mir vergällt“ (V. 3380 f.) ist ebenfalls auf diesen Umstand zu beziehen und bestätigt, dass ihr ohne die Anwesenheit des Geliebten die Lebensfreude fehlt. Auffällig in der zweiten Strophe ist ebenfalls, dass diese die einzige Strophe des Liedes ist in der Paarreime eingesetzt wurden. Die Paarreime sollen daher abermalig die Beziehung zu Faust aufgreifen. Die dritte Strophe schließt sich thematisch unmittelbar der zweiten an, da Bezeichnungen, wie „Mein armer Kopf / ist mir verrückt“ (V. 3382 f.) und „Meiner armer Sinn / Ist mir zerstückt“ (V.3384 f.) die Bedeutung Fausts für Gretchen ein weiteres Mal unterstreichen. Zudem bilden beide Bezeichnungen einen Parallelismus, der die Endgültigkeit entsprechend Gretchens Ansicht ihre Gefühle betreffend aufzeigt. Im Gegensatz zur zweiten Strophe ist die dritte gekennzeichnet durch unterbrochene Kreuzreime, welche an die innere Unruhe Gretchens zu Beginn anknüpfen und somit die Überleitung zum Refrain,der diese Unruhe erläutert. Die fünfte Strophe setzt ein mit der Aussage: „Nach ihm nur schau ich / Zum Fenster hinaus“ (V. 3390 f.), welche darlegen soll, dass sie ihre Umwelt gar nicht mehr wahrnimmt, sondern nur Faust noch für sie von Bedeutung ist. Diese Strophe ist ebenso wie die dritte mit einem Parallelismus versehen, der die Verse gegenseitig in Verbindung setzt. Die Strophe endet daher mit der Aussage: „Nach ihm nur geh ich / Aus dem Haus“ (V. 3392 f.). Der Parallelismus ist ebenfalls wie in der dritten Strophe mit der Endgültigkeit bezüglich Gretchens Gefühlen zu deuten. In der sechsten und siebten Strophe wird Faust näher beschrieben. Sie erwähnt „Sein[en] holde[n] Gang, / Sein[e] edle Gestalt, / Seines Mundes Lächeln [und] / Seiner Augen Gewalt“ (V. 3394 ff.). Insgesamt ist diesen Beschreibungen die Tatsache zu entnehmen, dass ihre Gefühle für Faust sehr stark sind. Weiterhin beschreibt Gretchen Fausts Rede als „Zauberfluss“ (V. 3399) und schwärmt von „Sein[em] Händedruck“ (V. 3400) und „sein[em] Kuss“ (V. 3401). Die beiden Strophen bilden einen zusammenhängenden Satz, der mit einem Ausrufezeichen endet und somit die Bedeutung Fausts für Gretchen in Form der Schwärmereien verdeutlicht. In der achten Strophe folgt ein drittes Mal der Refrain des Liedes. Die letzten beiden Strophen sind ebenfalls durch einen zusammenhängenden Satz verbunden. Dem Beginn der neunten Strophe ist zu entnehmen, dass die letzten beiden Strophen Gretchens Sehnsüchte und Wünsche darstellen. Die Strophe setzt ein mit dem Ausdruck: „Mein Busen drängt / Sich nach ihm hin“ (V. 3406 f.), welcher im Gegensatz zu Gretchens vorherigem tugendhaften Verhalten steht. Dies wird ebenfalls im weiteren Verlauf der Strophe: „Ach dürft ich fassen / Und halten ihn“ (V. 3408 f.) deutlich. Auffällig ist hierbei jedoch auch der Moduswechsel von Indikativ zu Konjunktiv. Der Konjunktiv führt wiederholt die Sehnsucht nach Faust und die starken Gefühlte Gretchens vor Augen. Der Moduswechsel besteht bis zum Ende des Gedichtes und gibt, da es sich beim Konjunktiv um die Möglichkeitsform handelt, eine Vorausdeutung auf den weiteren Verlauf der Handlung. Das Lied endet mit dem Wunsch Gretchens: „Und küssen ihn, / So wie ich wollt, / An seinen Küssen / Vergehen sollt!“ (V. 3410 ff.). Das Enjambement, welches die letzten beiden Verse verbindet, deutet auf die Abhängigkeit Gretchens von Faust hin. Zum Schluss ist festzuhalten, dass Gretchen durch ihre starken Gefühle für Faust eine Abhängigkeit von diesem entwickelt hat. Sie ist bereit selbst ihr Leben für ihn zu geben. Während seiner Abwesenheit verfällt sie einer inneren Unruhe, die teilweise das Gegenteil ihrer sonst tugendhaften Charakterzüge hervorbringt. Feedback von Janette: Hallo Lorena, ich finde du hast die Analyse struckturiert und gut geschrieben. Ich denke allerdings es wäre besser, wenn man anstatt ,,Thematisiert wird diesmal allerdings Faust und die Abhängigkeit Gretchens von diesem schreiben würde, dass es darum geht, dass Gretchen in einem inneren Konflikt mit sich selbst steht, da sie sich ihren Gefühlen und der Abhängigkeit zu Faust bewusst wird. Bei dir fehlt warum sie abhängig ist und dass sie innere Unruhe hat. Dass du allerdings die Szene in eigene Sinnabschnitte teilst zeigt, dass du den Text verstanden hast und dir dazu auch Gedanken gemacht hast.
Faust: "Kerker" V.4580-4595
Bei dem vorliegenden Textauszug handelt es sich um einen Teil der Szene „Kerker“ aus der Tragödie „Faust – Der Tragödie Erster Teil“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe und veröffentlicht im Jahr 1808. Die Tragödie thematisiert die Suche nach dem Sinn des Lebens. Inhaltlich handelt der Textauszug von der bevorstehenden Hinrichtung Margaretes. Die Handlung veranschaulicht zudem den Wahnsinn, dem Margarete verfallen ist, nachdem Faust sie verlassen, ihre ganze Familie tot ist und sie ihr eigenes Kind ertränkt hat, sowie ihre Akzeptanz der Todesstrafe. Der Textauszug umfasst 15 Verse. Es liegen unterschiedliche Reimschemen vor, es gibt zwei umarmende Reime, ein Kreuzreim, sowie ein Paarreim und auch zwei reimlose Verse. Das Metrum wird durch drei- bis sechshebige Trochäen gekennzeichnet. Am Ende des Verses liegen sowohl klingende als auch stumme Kadenzen vor. Der zu analysierende Text setzt ein mit „Tag! Ja es wird Tag! Der letzte Tag dringt herein“ (V. 4580). Die Textpassage ist in einem Trikolon aufgebaut, welches die Akzeptanz ihres Todes von Seiten Gretchens veranschaulicht, da sie am nächsten Tag dem Henker vorgeführt wird. Im weiteren Verlauf erklärt sie „Mein Hochzeitstag sollt es sein“ (V. 4581), was im Kontrast zur Realität steht, da der Hochzeitstag eigentlich der glücklichste Tag im Leben sein sollte und nicht der Tag der Hinrichtung. Dies ist daher auf den Wahnsinn, dem Gretchen verfallen ist zu beziehen. Gretchen fährt fort mit dem Ausruf „Weh meinem Kranze“ (V. 4583). Gemeint ist hierbei der Hochzeitskranz, welcher traditionell am Haus des Hochzeitspaares angebracht wurde um diesem Glück zubringen. Der Hochzeitskranz bildet somit ebenfalls eine Antithese zur Hinrichtung. Mit der Aussage „Es ist eben geschehen“ (V. 4584) wechselt Gretchen vom Hochzeitstag zum Todestag, was die Endgültigkeit dieses Tages und den Wahnsinn dem Gretchen verfallen ist wiederholt vor Augen führt. Im weiteren Verlauf verspricht sie Faust „Wir werden uns wiedersehen“ (V. 4585), womit sie ihm die Möglichkeit auf ein Treffen nach dem Tod in Aussicht stellt und sich somit vorläufig von ihm verabschiedet. Im Kontrast dazu steht der Zusatz „Aber nicht beim Tanze“ (V.4586). Der vorhin erwähnte Tanz ist in diesem Zusammenhang der Hochzeitstanz, der von dem frisch verheirateten Paar getanzt wird. Gretchen erklärt Faust somit indirekt, dass sie ihn nicht heiraten wird, zum einen nicht, weil sie am kommenden Tag getötet wird und zum anderen will sie ihn nicht heiraten oder generell mit ihm zusammen sein, da alles Schreckliche was ihr in der letzten Zeit geschehen ist mit Faust zusammenhängt. Im weiteren Verlauf beschreibt Gretchen „Die Menge drängt sich, man hört sie nicht“ (V.4587), womit sie nun final ihre Hinrichtung thematisiert. Die stumme Menge (vgl. V.4587) steht hier für das Publikum, das damals bei der Hinrichtung zugegen war. Selbst „Der Platz [und] die Gassen / Können sie nicht fassen“ (V. 4588 f.) veranschaulicht, dass zahlreiche Menschen bei einer Hinrichtung erscheinen und Gretchen dies nicht angenehm ist, da es normalerweise nicht ihrem Charakter entspricht sich auffällig in der Gesellschaft zu verhalten. Ihre Erzählung fährt fort mit „Die Glocke ruft, dass Stäbchen bricht“ (V. 4590). Bei einer Hinrichtung wurde in der Regel das Armesünderglöcklein geläutet und über dem Haupt des Hinzurichtenden zerbrach der Richter als Zeichen der endgültigen Verurteilung ein weißes Stäbchen, das er ihm dann vor die Füße warf. Gretchens Wahnsinn lässt sich nicht nur am stetigen Wechsel zwischen Hochzeits- und Todestag belegen sondern auch an der Textpassage „Wie sie mich binden und packen“ (V. 4591), da sie nach wie vor mit Faust im Kerker steht und niemand sie fesselt oder nach ihr greift. Sie berichtet zudem „Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt“ (V.4592). Der „Blutstuhl“ (ebd.) ist eine Metapher für den Stuhl der bei der Hinrichtung verwendet wird, was zusätzlich die wenigen Stunden verdeutlicht, die noch bis zum Todeszeitpunkt vergehen werden. Dies wird ebenso an der Aussage Gretchens „So zuckt nach jedem Nacken / Die Schärfe, die nach meinem zückt“ (V. 4593 f.) ausgedrückt. Die „Schärfe“ (ebd.) steht metaphorisch für die Hinrichtung oder eben die Waffe, die dafür verwendet wird. Der Umstand, dass die Schärfe „nach jedem Nacken [zuckt]“ (V. 4593), verdeutlicht, dass jeder an Gretchens Stelle stehen könnte und sich alle Anwesenden dessen bewusst sind. Die Textstelle endet mit dem Vergleich „Stumm liegt die Welt wie das Grab“ (V. 4595) welcher verdeutlicht, dass Gretchen ihre Hinrichtung vollends akzeptiert hat und sich nicht wiedersetzt. Zudem hebt sich dieser Vers auch formal von den übrigen ab, da dieser über kein Reimschema verfügt und somit die Endgültigkeit Gretchens Hinrichtung vor Augen führt. Die wechselnden Reimschemen, die unterschiedlich langen Trochäen und die verschiedenen Kadenzen verdeutlichen wiederholt den Wahnsinn dem Gretchen verfallen ist. Zum Schluss ist festzuhalten, dass Gretchen, nach allem was vorgefallen ist, wahnsinnig geworden ist und ihre Hinrichtung akzeptiert hat, obwohl noch die Möglichkeit besteht mit Faust aus dem Kerker zu fliehen. Zentrale Sprachliche Mittel sind das Trikolon zu Beginn der Textstelle, welches die bevorstehende Hinrichtung ankündigt und die zahlreichen Metaphern und Traditionen, die in Bezug zur Hinrichtung stehen. Faust
Abschrift der 1. Klausur
Bei dem vorliegenden Textauszug handelt es sich um einen Teil der Szene „Wald und Höhle“ aus der Tragödie „Faust – Der Tragödie Erster Teil“, verfasst von Johann Wolfgang Goethe und veröffentlicht im Jahr 1808. Die Tragödie thematisiert die Frage nach dem Meschen in seinen vielfältigen Lebensbezügen<. Inhaltlich handelt der Textauszug von Faust, der einen Monolog führt, in dem er die Natur und seine Verbundenheit zu dieser erläutert. Er befasst sich ebenfalls mit der Vollkommenheit des Menschen, Mephistopholes und Gott. Die Handlung veranschaulicht zudem Fausts Entwicklung von harmonischem Einklang mit der Schöpfung zur Erkenntnis seiner eigenen Begrenztheit, welche sich zudem formal in den zwei Abschnitten des Textes wiederspiegelt. Der Textauszug umfasst 36 Verse und ist im 25. Vers durch eine Leerzeile unterbrochen. Es ist kein Reimschema zu erkennen. Das Versmaß besteht aus 5-hebigen Jamben, die einen harmonischen Rhythmus komplettieren.
Der zu analysierende Text setzt ein mit der Regieanweisung „Faust allein“ (V.1), welche auf einen Monolog hindeutet, da sich keine andere Figur in seiner Nähe befindet. Er beginnt den Monolog mit dem Wortlaut „Erhabner Geist“ (V.2). Dieser Wortlaut verdeutlicht, dass er seinen Monolog einer nicht anwesenden Figur als Gebet widmet, da der Wortlaut dem Beginn eines Gebetes sehr ähnelt. Die darauf folgende Erkenntnis „du gabst mir, gabst mir alles“ (V.2) lässt insbesondere durch die Geminatio „gabst mir“ (ebd.) darauf schließen, dass es sich bei dem angesprochenen Geist um Gott handeln muss, der ihn bisher immer zufrieden gestellt hat. Faust erwähnt auch, dass der Geist ihm „Sein Angesicht im Feuer zugewendet“ (V.4) habe. Das „Feuer“ (ebd.) steht in diesem Zusammenhang für die Verzweiflung, die Faust zu Beginn der Tragödie durchlebt hat. Der Umstand, dass der Geist sich ihm während der Verzweiflung zugewendet hat, belegt ebenfalls, dass es sich bei dem zuvor erwähnten Geist um Gott handelt, da dieser im Wissen, dass Mephistopholes scheitern wird die Wette bezüglich Faust eingegangen ist und Mephistopholes letztendlich doch zu Faust gelassen hat. Gott ist sich schließlich sicher, dass Faust den rechten Weg wiederfindet und nicht der Versuchung durch den Teufel vollständig verfällt. Ein weiterer Aspekt, der die Rolle Gottes als Geist bestätigt, ist die Aussage Fausts „Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich“ (V.5), denn Gott hat die Natur und das Leben geschaffen. Die Tatsache jedoch, dass Faust die Natur als sein „Königreich“ (ebd.) bezeichnet, verdeutlicht seine Arroganz, da er sich eines Herrschers gleich an die Spitze der Natur stellt, obwohl er sie zum einen nicht selbst geschaffen hat und zum anderen auch nur ein unbedeutender Teil davon ist. Faust bestätigt dies, da jemand ihm „Kraft, sie zu fühlen, zu genießen“ (V.6) gab. Das Enjambement „Nicht / Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur“ (V.6 f.) verdeutlicht, dass Faust sich im Einklang mit der Natur befindet, da er ein Teil davon ist und nicht als eine außenstehende Person, wie ein Besucher, nur dass äußere Erscheinungsbild sieht, sondern täglich alles das, was im Inneren verborgen ist, erkundet. Der darauf folgende Vergleich „in ihre tiefe Brust / Wie in den Busen eines Freunds zu schauen“ (V.8 f.) ist ebenfalls Teil eines Enjambements und lässt sich im selben Kontext wie die vorherigen Zeilen deuten. Faust führt seinen Monolog mit der Aussage „Du führst die Reihen der Lebendigen / Vor mir vorbei“ (V.10 f.), veranschaulicht die Tatsache, dass er sich als König sieht und sein Volk in Form von allen Lebewesen an ihm vorbei geführt wird. Der Zusatz „lehrst mich meine Brüder“ (V.11) führt vor Augen, dass er durch seinen Stellenwert in der Natur dieser und seine Mitmenschen, was die Metapher „Brüder“ (ebd.) verdeutlicht, besser kennenlernt. Veranschaulicht wird dies durch verschiedene Metaphern aus der Natur, wie „Busch“ (V.12) oder die Elemente „Luft und Wasser“ (ebd.), die den Pantheismus in Form zweier Lebensnotwendiger Elemente zusätzlich hervorheben. Faust befindet sich in vollkommener Harmonie mit der Natur und Pflanzenwelt, da er selbst den „stillen Busch“ (V.12) als seinen Bruder bezeichnet und sich in den Elementen Luft und Wasser (vgl. V.12) geborgen fühlt. Deutlich wird hieran ebenfalls der Pantheismus, der im gesamten ersten Teil des Gedichtes zu finden ist. Faust führt die Metapher des Sturmes, die eine Antithese zu den vorherigen ruhigen, elementaren Metaphern bildet auf, indem er beschreibt, wie eine „Riesenfichte stürzend Nachbaräste / Und Nachbarstämme quetschend niederstreift / Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert“ (V.14 ff.). Die Metapher des Sturmes ist hier ein entscheidendes Symbol für die Naturthematik welche bereits im Titel „Wald und Höhle“ wieder zu finden ist. Der Wald wurde durchaus in Form der fallenden Bäume thematisiert. Die Symbolik der Höhle wird in Vers 17 aufgegriffen, wenn es heißt: „Dann führst du mich zur sicheren Höhle“ (V.17). Die sichere Höhle bildet eine Antithese zu der zuvor beschriebenen gefährlichen Situation im Wald. Das Pronomen „du“ (V.17) macht deutlich, dass es für Faust nur eine Person, in diesem Fall Gott, gibt, die ihm hilft aus einer gefährlichen Situation hinaus zu finden und für ihn somit als Retter und Beschützer da ist. Nachdem Gott ihn aus der Gefahrensituation befreit hat, zeigt er Faust sich „selbst, und meiner eignen Brust / Geheime tiefe Wunden öffnen sich“ (V.18 f.), was bedeutet, dass Faust seine eigenen Fehler und Charakterzüge, die ihn erst in diese Situation gebracht haben, verdeutlicht und seine eigenen Schwächen somit ins Licht treten. Als nächstes erklärt Faust, ihm schweben „Der Vorwelt silberne Gestalten auf / Und lindern der Betrachtung strenge Lust“ (V.23 f.). Mit „Vorwelt“ (ebd.) ist die Vergangenheit gemeint und die silbernen Gestalten sind Personen, denen er einst Schaden oder Leid zugefügt hat. Der Anblick dieser lässt ihn sein Verlangen nach Wissen zurückhalten, da die Schuld, die er gegenüber jenen Gestalten verspürt, auf seinen Schultern lastet und er bei ihrem Anblick Scham empfindet. Im 25. Vers folgt eine Leerzeile, die das Schamgefühl deutlicher zum Ausdruck bringt und den Text in zwei Teile gliedert. Der zweite wird durch die Interjektion „O“ (V.26) eingeleitet, die eine resignative Stimmung vermuten lässt. Der weitere Wortlaut „dass dem Menschen nichts Vollkommen wird, / Empfinde ich nun“ (V. 26 f.) bestätigt die resignativen Gemütszustand, in dem sich Faust befindet. Fausts Ziel ist es alles zu wissen, auch wenn er weiß, dass dies einem Menschen nicht möglich ist. Daher bezeichnet er den Umstand, dass Gott ihn die Natur lehrt, als eine „Wonne, / Die mich den Göttern nah und näher bringt“ (V.27 f.). Die Steigerung „nah und näher“ (V.28) führt seine Arrogant vor Augen, da er sich schon bald als göttlich betrachtet, auch wenn er nur ein einfacher Mensch ist. Im weitern Verlauf beschreibt Faust Mephistopholes als „den Gefährten, den ich schon nicht mehr / Entbehren kann“ (V.29 f.), auch wenn dieser kalt, frech und erniedrigend ist (vgl. V.30 f.) „und zu Nichts, / Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt“ (V.31 f.). Mephistopholes, der als Teufel Gottes Gegenspieler ist, wird hier in einer antithetischen Darstellung noch einmal als jener identifiziert. Die Adjektive „kalt und frech“ (V. 30) sowie das erniedrigende Verhalten stehen im Gegensatz zu Gottes Verhalten, der Faust schützt und lehrt. Ebenso wird dies an der Tatsache deutlich, dass Mephistopholes keine Hemmungen hat, das was Gott geschaffen hat, zu zerstören (vgl. V.31 f.). Des Weiteren führt Faust auf, dass Mephistopholes „in meiner Brust ein wildes Feuer / Nach jenem schönen Bild geschäftigt an[facht]“ (V.33 f.). Das wilde Feuer steht metaphorisch für das Verlangen nach „jenem schönen Bild“ (V.34), welches wiederum eine Metapher für den Umstand ist, dass Mephistopholes Faust versprach ihm seinen Wunsch nach Wissen zu erfüllen. Der Textauszug endet mit dem Chiasmus „So tauml ich von Begierde zu Genuss, / Und im Genuss verschmacht ich nach Begierde“ (V. 35 f.). Die Nomen „Begierde“ (ebd.) und „Genuss“ (ebd.) bilden den Chiasmus und bringen so zum Ende des Textauszuges die Resignation Fausts zum Ausdruck.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Faust Gott sehr viel verdankt und dies in seinem Monolog auch zum Ausdruck bringt. Er ist sich der Schuld bewusst, in der er bei Gott steht, seitdem er Mephistopholes als Gefährten akzeptiert und bereut sein selbstsüchtiges Verhalten nach Vollkommenheit zutiefst. Zentrale Sprachliche Mittel des Textes sind die Interjektion zu Beginn des zweiten Abschnittes, welche den Wendepunkt in Fausts Entwicklung darstellt, und der Chiasmus am Abschluss des Textauszuges, der die Resignation Fausts zum Ende hin verdeutlicht.
Feedback von Janette: Hallo Lorena, deine Analyse finde ist die meiner Meinung nach sehr gelungen, da du die Aspekte, welche in der Analyse inbegriffen sein sollen mit hinein gebracht hast. Außerdem finde ich deine Formulierungen sehr gut und du erklärst alles, so dass der Leser versteht was du mit den einzelnen Dingen sagen willst. Somit wird auch deutlich dass du die Textpassage verstanden hast. Allerdings hätte ich „Luft und Wasser“ separat zitiert und nicht verglichen, da es meiner Meinung nach eine wichtige Rolle spielt, da somit die Naturverbundenheit Fausts noch einmal zur Geltung kommt. Des Weiteren fände ich es gut, wenn du in deinen Schluss mit einbaust, von welchem Genuss die Rede ist.
Woyzeck
Inhaltsangabe Woyzeck
Das vorliegende Drama „Woyzeck“ verfasst von Georg Büchner und erschienen im Jahre 1879 thematisiert die gesellschaftlichen Missstände in der Zeit des Vormärzes. Protagonist der Handlung ist der dreißigjährige Soldat Franz Woyzeck, der zu einer der unteren Gesellschaftsschichten gehört und somit von seinen Vorgesetzten ausgenutzt und verspottet wird. Er hat mit seiner Freundin Marie einen gemeinsamen Sohn und ist daher zusätzlich zu seinem eigentlichen Beruf als Forschungsobjekt für einen Doktor tätig, um Marie und das Kind finanziell zu unterstützen. Während der Forschungen vollzieht Woyzeck eine Mangelernährung und wiederfährt dadurch psychische Erkrankungen. Marie betrügt ihm im Laufe der Handlung mit dem Tambourmajor. Woyzeck leidet unterdessen an Halluzinationen, als Nebenwirkung der Forschungen, und hört eine Stimme, die ihm aufträgt Marie, wegen ihres Verrats, zu ermorden. Letztendlich hört Woyzeck auf die Stimme, er tötet Marie und gibt das gemeinsame Kind weg
Der Hessische Landbote Z.70-128
Bei dem vorliegenden Textauszug mit dem Titel „Der Hessische Landbote“, verfasst von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahr 1834, handelt es sich um ein Flugblatt. Thematisiert wird die Unterdrückung der unteren sozialen Schichten. Mögliche Intentionsaspekte sind der Wiederstand gegen die Adligen und Beamten, der Wunsch nach Rechten und Gesetzen, sowie der Gedanke an Deutschland als einen Freistaat. Der zu analysierende Textauszug setzt ein mit dem Appell: „Seht nun, was man in dem Großherzogtum aus dem Staat gemacht hat; seht was es heißt die Ordnung im Staate erhalten!“ (Z.70 f.). Der Appell ist abwertend zu verstehen und stellt sofort zu Beginn der Textstelle das Großherzogtum negativ dar. Zunächst benennt der Autor klare Fakten, wie „700 000 Menschen bezahlen dafür 6 Millionen“ (Z. 72 f.), was ihn zu der Schlussfolgerung kommen lässt, dass diese „zu Ackergäulen und Pflugstieren gemacht [werden], damit sie in Ordnung leben“(Z. 74 f.). Die umgangssprachlichen und negativen Bezeichnungen „Ackergäulen“ (Z.74) und „Pflugtieren“ (ebd.) legen die unmenschlichen Bedingungen dar, die die unteren Bevölkerungsschichten ertragen, nur um die Steuern zahlen zu können, die die Ordnung im Staat erhalten. Als Resultat leitet er daraus ab, dass „In Ordnung leben heißt hungern und geschunden werden“ (Z. 75 ff.) und zieht somit einen weiteren Bezug zum Tiervergleich, da er geradeheraus sagt, dass die Bürger von den wohlhabenden Bevölkerungsschichten wie Arbeitstiere behandelt und gehalten werden. Der Autor fährt mit der rhetorischen Frage „Wer sind denn die, welche diese Ordnung gemacht haben und die wachen, diese Ordnung zu erhalten?“ (Z. 78 ff.) um noch einmal vor Augen zu führen wer seiner Meinung nach Schuld an der Situation der unteren Bevölkerungsschichten trägt. Er beantwortet die Frage im weiteren Verlauf selbst und stellt zudem dar aus welchen Mitgliedern die Regierung zusammengesetzt wird. Er erläutert „Die Regierung wird gebildet von dem Großherzog und seinen obersten Beamten“ (Z. 81 f.), zudem gibt es auch zusätzlich weitere untergeordnete Beamte, „die von der Regierung berufen werden um jene Ordnung in Kraft zu erhalten“ (Z. 83 ff.). Durch die Akkumulation „Staatsräte und Regierungsräte, Landräte und Kreisräte, geistliche Räte und Schulräte, Finanzräte und Forsträte usw. mit allem ihrem Heer von Sekretären“ (Z. 86 ff.) wird veranschaulicht wie viele Personen beim Großherzogtum angestellt sind und dementsprechend bezahlt werden müssen. Die Tatsache das alle Angestellten die Bezeichnung Rat in der Berufsbeschreibung haben, verdeutlicht dass sie nur eine beratende Aufgabe haben und somit nicht alle zwingend notwendig für die staatliche Ordnung sind, aber trotzdem von der Allgemeinheit bezahlt werden. Er vergleicht das Volk mit einer Herde und die Beamten mit ihren „Hirten, Melker und Schinder“ (Z.90 f.). Die Beamten stehen dementsprechend über dem Volk, obwohl sie teilweise selbst Teil des Volkes sind. Zusätzlich merkt er an „sie haben die Häute der Bauern an, der Raub der Armen ist in ihrem Hause; die Tränen der Witwen und Waisen sind das Schmalz auf ihren Gesichtern“ (Z.91 ff.) ein Semikolon trennt die Aufzählung in Form einer Klimax vom Fazit des Autors „sie herrschen frei und ermahnen das Volk zur Knechtschaft“ (Z.94 f.). Die Regierung regiert in einer Art Willkürherrschaft über das Volk, das machtlos unter ihnen steht. Das Verb „regieren“ (Z. 97) definiert der Autor mit der Erklärung „sich von euch füttern zu lassen und euch eure Menschen- und Bürgerrechte zu rauben“ (Z.98 f.). Das Volk wehrt sich nicht gegen die Steuern und die Herrschaft der Regierung, obwohl es ihnen dadurch schlecht geht. Zusätzlich bezeichnet der Autor die Mitglieder der Regierung als „Schurken“ (Z.100), denn „Diese Regierung ist nicht von Gott, sondern vom Vater der Lügen“ (Z.101 ff.) und „den deutschen Kaiser, der vormals vom Volke frei gewählt wurde, haben sie seit Jahrhunderten verachtet und endlich gar verraten“ (Z.105 ff.). Die oberen Gesellschaftsschichten, die zum großen Teil die Regierung bilden, haben somit den vom Volk gewählten und somit von Gott bestimmten Machtinhaber entmachtet und die Macht auf sich selbst übertragen um das Volk zu unterdrücken. Der Autor fügt diesem noch hinzu, dass „ihr Wesen und Tun von Gott verflucht! Ihre Weisheit ist Trug, ihre Gerechtigkeit ist Schinderei“ (Z.111 ff.), was bedeutet das ihre gesamte Regierung auf einem ungerechten und unterdrückendem System basiert. Sie sind nicht so Weise und Gerecht wie sie sich aufführen, sondern handeln nur zu ihrem eigenen Vorteil. Er schließt dieses Argument mit der Behauptung: „Ihr lästert Gott, wenn ihr einen dieser Fürsten einen Gesalbten Herrn nennt“ (Z.115 f.). Im weiteren Verlauf erwähnt der Autor erneut den deutschen Kaiser und erinnert die Bürger daran, dass „unsere freien Voreltern [diesen] wählten“ (Z.121). Im Kontrast dazu stellt er die Tatsache, dass „diese Verräter und Menschenquäler nun Treue von euch [verlangen]!“ (Z.122 ff.), wodurch er zum Abschluss noch einmal zusammenfasst was die Regierung dem Volk angetan hat. Der Autor beendet den Text mit seiner Vision des zukünftigen Deutschlands „als ein Freistaat mit einer vom Volk gewählten Obrigkeit" (Z.127 f.), womit er am Schluss die Intention seines Textes offenlegt. Zum Schluss ist festzuhalten, dass der Autor den Text strukturiert auf seine Intention ausgelegt hat und diese auch im gesamten Inhalt als positive Lösung dargestellt hat, auch wenn seine Argumentation nicht in einem neutralen Stil verfasst wurde konnte er dennoch überzeugende Argumente anbringen, die seine Meinung deutlich vor Augen führen. Er verwendet einige sprachliche Mittel, von denen am Meisten die Akkumulation der Regierungsangestellten und die Tiermetaphorik in Bezug auf das Volk herausstachen.
Parallelen "Der Hessische Landbote" und "Woyzeck"
Der vorliegende Text, mit dem Titel „Der Hessische Landbote“ verfasst von Georg Büchner im Jahre 1834, weist einige Parallelen zum Drama „Woyzeck“, ebenfalls geschrieben von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahre 1879, auf. Büchner erklärt in „Der Hessische Landbote“, dass die Menschen in eine Art Ständegesellschaft gegliedert sind. Dementsprechend sind auch die Figuren im Drama angeordnet: zur oberen Schicht zählen der Hauptmann, der Doktor und der Tambourmajor, zur unteren Schicht zählen dementsprechend Woyzeck und Marie. Woyzeck ist ein Soldat und verdient nur ein geringes Gehalt, das er vollständig Marie überlässt um sie und ihr gemeinsames Kind zu versorgen. Die beiden Leben daher in ständiger Armut, auch wenn Woyzeck durch zusätzliche Arbeiten bei seinem Vorgesetzten und als Forschungsobjekt bei einem Arzt versucht sein Gehalt aufzubessern. Woyzecks Vorgesetzter, der Hauptmann, erhält ein durchaus höheres Gehalt und muss sich dementsprechend wenig Sorgen um seine finanzielle Lage machen. Es ist ihm sogar möglich andere, oder in diesem Fall Woyzeck für tägliche Arbeiten, wie das Rasieren seines Bartes (Szene: „Beim Hauptmann“) zu bezahlen. Zudem wird er in der Szene Straße als äußerst Wohlgenährt beschrieben, was ebenfalls einer höheren Gesellschaftsschicht entspricht. Des Weiteren wären noch der Arzt und der Tambourmajor zu nennen. Der Arzt verwendet Woyzeck für einen zusätzlichen Lohn als Forschungsobjekt und interessiert sich mehr für seine Forschung als für Woyzecks Wohlbefinden. Er bezeichnet ihn daher als „Subjekt“ und „interessanten casus“ (Szene: „Beim Doktor“). Zudem spricht er ihn lediglich in der dritten Person an und redet somit nicht mit ihm wie mit einem Menschen sondern wie mit einem Versuchsobjekt (Szene: ebd.). Der Tambourmajor wird als selbstbewusster und starker Mann beschrieben, dessen Ziel es ist Marie zu erobern (Szene: „Mariens Kammer“). Er befindet sich auf Grund seines militärischen Ranges ebenfalls in einer höheren Gesellschaftsklasse und es ist ihm möglich Marie mit Hilfe von Schmuck zu verführen und Woyzeck somit das einzige zu nehmen, das ihm noch Lieb ist. Büchner stellt in seinem Flugblatt die oberen Gesellschaftsschichten, insbesondere die Regierung, als negativ dar und legt dar, dass diese die unteren Gesellschaftsschichten ausnutzen und nicht menschengerecht behandeln. Er geht sogar so weit dass er die Menschen aus den unteren Schichten als „Ackergäulen“ und „Pflugstieren“ (Z.74) bezeichnet. Diese Bezeichnungen treffen durchaus auf Woyzeck zu, der teilweise unmenschliche und gesundheitsgefährdende Auflagen erträgt, nur um bei den Forschungen des Doktors zusätzliches Geld zu verdienen. Zudem erläutert Büchner, dass in der staatlichen Ordnung leben für die untere Bevölkerungsschicht bedeutet zu „hungern und geschunden [zu] werden“ (Z.76 f.), was ebenfalls Woyzecks aktueller Situation entspricht. Im weiteren Verlauf stellt Büchner die Metapher einer Herde von Tieren (vgl. Z.89 ff.) auf, die der unteren Gesellschaftsschicht entsprechen. Generell ist der Tiervergleich auch im Drama wieder zu finden, da Woyzeck sowohl vom Arzt als auch vom Hauptmann auf den Stellenwert eines Tieres herabgeschraubt und auch dementsprechend behandelt wird. Er führt auf, dass das einfache Volk die Herde der Oberschicht ist und „sie sind seine Hirten, Melker und Schinder“ (Z.90 f.). Im gesamten Drama wird die Oberschicht als dominant und egoistisch dargestellt, wohingegen die Unterschicht am Rande der Armut lebt und sich sogar, wie in Woyzecks Fall für andere Menschen aufopfert. Die Aussage Büchners „sie herrschen frei und mahnen das Volk zur Knechtschaft“ (Z.94 f.), stimmt mit der Art des Tambourmajors überein, der sich ohne auf Woyzecks Lage oder andere Situationen zu achten mit Marie trifft und diese schlussendlich auch verführt, indem er sie mit materiellen Werten beschenkt und somit seine ständische Überlegenheit demonstriert (Szene: „Mariens Kammer“). Zum Schluss seines Flugblattes ruft Büchner das einfache Volk der unteren Bevölkerungsschichten dazu auf sich mit Gewalt gegen die Oberschicht aufzulehnen und die aktuelle Situation nicht zu akzeptieren. Deutschland soll seiner Ansicht nach „als ein Freistaat mit einer vom Volk gewählten Obrigkeit wieder auferstehen“ (Z.127 f.). Diese zentrale Textpassage lässt sich nicht konkret im Drama wiederfinden, obwohl sie die gesamten Aussagen des Flugblattes wiederspiegelt.
Brief Büchners an die Eltern vom 05.April 1833
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Brief Büchners an die Eltern“ verfasst von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahre 1833, handelt es sich um einen Brief an Büchners Eltern in Frankfurt. Thematisiert wird die politische Situation im heutigen Deutschland zur Zeit des Vormärzes. Büchner legt bereits zu Beginn des Briefes seine Meinung zu den gescheiterten Aufständen demokratisch Gesinnter in Frankfurt dar. Seine Eltern hatten ihm von diesen in einem vorherigen Brief berichtet. Büchner unterbreitet diesen seine unmissverständliche Meinung „Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt“ (Z.2 f.). Büchners Meinung nach ist Gewalt somit die einzige Lösung um gegen die Regierung und die Fürsten vorzugehen. Er erläutert zudem dass "Wir wissen, was wir von unseren Fürsten zu erwarten haben" (Z. 3). Büchner ist sich demnach bewusst, dass die Fürsten sich nicht um die Bürger in ihrem Staat kümmern und ihre Forderungen missachten. Dass sie den Forderungen nicht nachkommen zeigt sich auch an Büchners Behauptung "Alles, was sie bewilligten, wurde ihnen durch die Notwendigkeit abgezwungen" (Z.4 f.). Dementsprechend halten die Fürsten und die Regierung die Bürger hin und sprechen ihnen nur die Rechte zu, die sie sich anderenfalls durch Gewalt oder Aufstände erkämpfen würden. Büchner fährt fort mit der Metapher "Und selbst das Bewilligte wurde uns hingeworfen, wie eine erbettelte Gnade und ein elendes Kinderspielzeug, um dem ewigen Maulaffen Volk seine zu eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen" (Z.5 ff.). Das Volk hat demnach den selben gesellschaftlichen Stand wie ein Tier oder ein kleines Kind, was durch den Vergleich der "erbettelten Gnade" (ebd.) oder "ein elendes Kinderspielzeug" (ebd.) deutlich. Zusätzlich wird das Volk als "Maulaffen" (Z.7) bezeichnet, was die Position des Volkes als einfältige Schaulustige darstellt. Die Tatsache, dass die oben genannten Bewilligungen dazu dienen dem „Volk seine zu eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen“ (Z.7 f.) veranschaulicht wiederum die Situation des Volkes, welches durch die erhaltenen Rechte von Aufständen oder ähnlichem abgelenkt wird und die eigentlichen Missstände, unter denen sie leiden, geraten vorerst in Vergessenheit. Aus dieser Metapher heraus zieht Büchner den Vergleich, dass diese Aufstände „eine blecherne Flinte und ein hölzerner Säbel, womit nur ein Deutscher die Abgeschmacktheit begehen konnte, Soldatchens zu spielen“ (Z.8 ff.). Die Metaphern „blecherne Flinte“ (ebd.) und „hölzerner Säbel“ (ebd.) stellen die Zwecklosigkeit dieser Aufstände anhand von tödlichen Waffen dar, die jedoch in einem Material hergestellt wurden, dass diese unbrauchbar und somit ungefährlich macht. Ebenso erläutert er, dass nur ein Deutscher „die Abgeschmacktheit begehen konnte“ (Z.9) mit diesen Waffen „Soldat[...]“ (ebd.) zu spielen. Die Bezeichnung „Soldatchens“ (Z.9 f.) bildet zugleich ein Diminutiv und eine Antithese. Ein Soldat ist in der Regel eine Personifikation von Stärke, das Diminutiv macht diesen jedoch durch die Verniedlichung schwach und bildet somit eine Antithese, die sich gleichzeitig auf die vorherige Metapher beziehen lässt, da ein Soldat mit solchen Waffen zunächst stark wirkt, aber bei näherer Betrachtung als schwach dasteht. Den zweiten Teil seines Briefes leitet Büchner mit der Äußerung „Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor“ (Z.11), welches Verhalten seine zu Beginn erwähnte Ansicht wiederspiegelt. Die Rhetorische Frage „Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand?“ (Z.11 f. betont zusätzlich seine oben genannte Ansicht zum Erfolg der Aufstände durch Gewalt. Die Bezeichnung des „ewigen Gewaltzustand“ (Z.12) verdeutlicht zusätzlich die politische Situation in Deutschland, da die Regierung und Fürsten das Volk gewaltsam dazu drängen ihre Anforderungen zu erfüllen. Büchner beantwortet die Frage daher mit der Begründung „Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind“ (Z.12 f.). Der Kerker steht in diesem Zusammenhang als Metapher für das ungerechte politische System und somit die Missstände von denen die gesamte untere Gesellschaftsschicht betroffen ist. Zusätzlich führt Büchner seine Begründung mit der Erläuterung „wir [merken] nicht mehr, dass wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde“ (Z.13 ff.). Er greift hier die Metapher des Kerkers (vgl. Z.12) wieder auf und ergänzt diese mit Metaphern, wie „angeschmiedeten Händen und Füßen“ (Z.14) und „Knebel im Munde“ (Z.15), die das Volk mit Gefangenen gleich setzen und deren politischen Stand, in dem sie keine Möglichkeit haben frei zu entscheiden oder generell Rechte einzufordern, darlegt.
Abschrift der 2. Klausur
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „An die Familie“ handelt es sich um einen Brief, verfasst von Georg Büchner im Juli 1835 in Straßburg. In seinem Brief thematisiert Büchner die Unterschiede zwischen dramatischen Dichtern, Historikern und Idealdichtern. Der Brief ist in der Literaturepoche des Vormärz entstanden und an die Familie Büchners adressiert. Der zu analysierende Sachtext ist in zwei Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt thematisiert Büchner die Anforderungen, denen dramatische Dichter gerecht werden sollen. Im zweiten Abschnitt setzt er diese Anforderungen in Kontrast zu seiner Vorstellung eines Idealdichters. Der erste Abschnitt (Z.2-15) setzt mit der Aussage Büchners „Was übrigens die sogenannte Unsittlichkeit meines Buchs angeht, so habe ich folgendes zu antworten“ (Z.2 f.) ein. Dieser Wortlaut bildet die Einleitung in die Thematik des ersten Abschnittes. Laut Büchner sei „der dramatische Dichter […] in meinen Augen nicht als ein Geschichtsschreiber“ (Z.3 f.). Büchner ist dementsprechend der Ansicht, dass die kritisierten Unsittlichkeiten in seinem Buch angebracht gewesen seien, da er als dramatischer Dichter automatisch die Rolle eines Historikers einnimmt und die Geschichte daher neutral wiedergegeben müsse. Er bemerkt zudem, dass der Dichter „aber über Letzterem“ (Z.5) stehe. Der Geschichtsschreiber oder Historiker verfüge demzufolge über einen niedrigeren Stellenwert als ein dramatischer Dichter, da der dramatische Dichter laut Büchner einen Geschichtsschreiber verkörpere. Büchner rechtfertigt seine zuvor erwähnte Ansicht mit der Behauptung, „dass [der dramatische Dichter] uns die Geschichte zum zweiten Mal erschafft und uns gleich unmittelbar, statt eine trockene Erzählung zu geben, in das Leben einer Zeit hinein versetzt, uns statt Charakteristiken Charaktere, uns statt Beschreibungen Gestalten gibt“ (Z.5 ff.). Büchner führt in dieser Behauptung die Anforderungen auf, die seiner Ansicht nach einen dramatischen Dichter ausmachen. Als einen Aspekt nennt er, dass ein dramatischer Dichter „die Geschichte zum zweiten Mal erschafft“ (Z.5) und diese im Vergleich zu einem Historiker „unmittelbar“ (Z.5) anstatt wie „eine trockene Erzählung“ (Z.6) wiedergebe. Das Adjektiv „trockene“ (ebd.) in Bezug auf die Erzählungen eines Historikers ist abwertend zu verstehen und bildet somit eine Antithese zum folgenden Wortlaut „in das Leben einer Zeit hineinversetzt“ (Z.6 f.), da dies mit Interesse und Spannung assoziiert wird und somit im Kontrast zum oben genannten Adjektiv steht. Des Weiteren führt Büchner in seiner Behauptung den Parallelismus „uns statt Charakteristiken Charaktere, uns statt Beschreibungen Gestalten“ (Z.8 f.) auf. Der Parallelismus veranschaulicht zusätzlich, dass der dramatische Dichter laut Büchner die Geschichte durch Charaktere und Gestalten in lebendiger Verfassung wiedergebe, anstatt dass er wie ein Historiker die Charakteristik und Beschreibungen einer vergangenen Zeit erläutere. Im weiteren Verlauf erklärt Büchner aus der Perspektive eines dramatischen Dichters, „seine höchste Aufgabe ist, der Geschichte, wie sie sich wirklich begeben, so nahe als möglich zu kommen“ (Z.9 ff.), was zum einen den oben erläuterten Parallelismus bestätigt und zum anderen Büchners persönliches Ziel verdeutlicht. Zum Abschluss des ersten Abschnittes greift er die zu Beginn erwähnte Unsittlichkeit seines Buches noch einmal auf und rechtfertigt diese anhand seiner zuvor aufgeführten Anforderungen eines dramatischen Dichters. Zunächst beschreibt er „Sein Buch darf weder sittlicher noch unsittlicher sein, als die Geschichte selbst“ (Z.11 f.), was vor Augen führt, dass Büchner demnach sein Buch neutral verfasst habe und somit die Realität dem entspricht, was in seinem Buch steht. Letzteres greift Büchner daraufhin noch einmal auf, indem er sich rechtfertigt, dass „die Geschichte […] vom lieben Herrgott nicht zu einer Lektüre für junge Frauenzimmer geschaffen worden [ist], und da ist es mir auch nicht übel zu nehmen, wenn mein Drama ebenso wenig dazu geeignet ist“ (Z.12 ff.). Büchner erklärt somit, dass er nur die von Gott geschaffene Realität wiedergebe. Im zweiten Abschnitt (Z.16-38) führt Büchner zunächst die Aufgaben eines Dichters auf. Dementsprechend erklärt er, „Der Dichter ist kein Lehrer der Moral, er erfindet und schafft Gestalten, er macht vergangene Zeiten wieder auflebe, und die Leute mögen dann daraus lernen, so gut, wie es aus dem Studium der Geschichte und der Beobachtung dessen, was im menschlichen Leben um sie herum vorgeht“ (Z.15 ff.). Zusammenfassend knüpft Büchner mit dieser Erklärung an seine Ergebnisse aus dem ersten Abschnitt an und stellt den Dichter als einen neutralen Beobachter dar, der die Menschen auf vorherrschende Missstände aufmerksam machen soll. Im weiteren Verlauf bezieht sich Büchner wieder auf die in seinem Buch kritisierten Unsittlichkeiten. Er legt dar, wie es aussehen würde, wenn die Dichter diese Unsittlichkeiten generell nicht mehr in ihren Texten erwähnen würden. Büchner behauptet daher sie dürften „keine Geschichte studieren, weil sehr viele unmoralische Dinge darin erzählt werden, müsste mit verbundenen Augen über die Gassen gehen, weil man sonst Unanständigkeiten sehen könnte, und müsste über einen Gott Zeter schreien, der eine Welt erschaffen, worauf so viele Liederlichkeiten vorfallen“ (Z.22 f.). Diese Aufzählung wurde von Büchner in einer Klimax angelegt um die Ironie und die Absurdität, die in dieser Klimax angefangen vom Verbot des geschichtlichen Studiums bis hin zur Beschuldigung Gottes, für alle Liederlichkeiten verantwortlich zu sein, darzustellen. Büchner selbst, so äußert er sich im vorliegenden Brief, antworte auf die Behauptung „der Dichter müsse die Welt nicht zeigen wie sie ist, sondern wie sie sein solle“ (Z.28 f.) mit der Aussage, „dass ich es nicht besser machen will als der liebe Gott, der die Welt gewiss gemacht hat, wie sie sein soll“ (Z.29 ff.). Büchners Aussage ist auf die Projektionstheorie des deutschen Philosophen Ludwig von Feuerbach zu beziehen. In Feuerbachs Theorie projiziert der Mensch alle Eigenschaften und moralischen Vorstellungen des Guten auf Gott mit dem Ziel diese Vorstellung eines Tages selbst zu repräsentieren. Büchner stellt daher den dramatischen Dichter als Beobachter dar, der die Mensch auf die vorherrschenden Missstände aufmerksam machen soll, da die Menschen diese sonst nicht bewusst wahrnehmen und verbessern mit dem Ziel vor Augen eines Tages als ihre Idealvorstellung des Guten zu leben. Am Schluss des Textes geht Büchner noch auf die „sogenannten Idealdichter“ (Z.31 f.) ein. Idealdichter sind Dichter, die, wie die Bezeichnung bereits verdeutlicht, ein bestimmtes Ideal vertreten. Büchner steht diesen kritisch gegenüber. Er bezeichnet ihre Figuren als „Marionetten mit himmelblauen Nasen und affektiertem Pathos“ (Z.33 f.). Die Metapher der „Marionetten“ (ebd.) veranschaulicht, dass die Figuren einem Ideal Folgen und von diesem Abhängig sind. Die metaphorische Beschreibung der „himmelblauen Augen“ (ebd.) und der Wortlaut „affektiertem Pathos“ (ebd.) verdeutlichen, dass die Idealdichter die Welt und auch ihre Werke nach dem vertretenen Ideal richten und somit die vorherrschenden Missstände außer Acht lassen. Büchner setzt sie daher in Kontrast zu Figuren von dramatischen Dichtern die als „Menschen von Fleisch und Blut“ (Z.34) dargestellt werden und „deren Leid und Freude mich mitempfinden macht, und deren Tun und Handeln mir Abscheu oder Bewunderung einflößt“ (Z.35 ff.). Büchner sieht die Figuren der Idealdichter demnach nicht als Charaktere mit realitätsnahen Gefühlen und eigenem Antrieb, sondern als von ihrem Ideal gesteuerte Puppen. Am Ende des Briefes fasst er den Inhalt zusammen: „Mit einem Wort, ich halte viel auf Goethe oder Shakespeare, aber sehr wenig auf Schiller“ (Z.37 f.). Goethe und Shakespeare sind dementsprechend dramatische Dichter und Schiller ist Büchners Ansicht nach ein Idealdichter. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Büchner die dramatischen Dichter als Historiker und neutrale Beobachter sieht, die die Menschen auf vorherrschende Missstände aufmerksam machen. Einige zentrale sprachliche Mittel des Textes sind der Parallelismus in Bezug auf den Unterschied zwischen Historikern und dramatischen Dichtern, sowie die Metaphern am Ende des Textes in Bezug auf Büchners Meinung zu den Idealdichtern.
Aufgabe 2:
Büchners Aussagen treffen in folgenden Punkten auf das Drama „Woyzeck“, ebenfalls verfasst von Georg Büchner und veröffentlicht im Jahr 1879, zu. Büchner führt als einen seiner ersten Punkte die Tatsache auf, dass dramatische Dichter die Geschichte zum zweiten Mal erschaffen und somit die Leser in das Leben in einer anderen Zeit hineinversetzt. Dies wird durch Charaktere und Gestalten, die dieser Zeit entsprechen, verdeutlicht. Woyzeck, Marie, der Tambourmajor, der Hauptmann und der Doktor stammen aus einer Zeit, in der zum einen nicht die moralischen Vorstellungen der heutigen Zeit (uneheliches Kind; Szene 5) vertreten werden, noch die Verhaltensweise und Menschenrechte (Erbsendiät Woyzeck, medizinische Forschung; Szene 8 / Mord an Marie; Szene 20, Szene 26) den heutigen Vorstellungen entsprechen. Als nächsten Punkt nennt Büchner, dass die Geschichte die Realität widerspiegeln soll. Das Drama „Woyzeck“ thematisiert die gesellschaftlichen Missstände in der Literaturepoche des Vormärz und stellt somit die Ungerechtigkeit der Ständegesellschaft und die Armut der unteren Bevölkerungsschicht aus Sicht des Protagonisten Woyzeck, der der untersten Schicht angehört, dar. Bemerkbar werden die gesellschaftlichen Missstände daran, dass Woyzeck zahlreiche Zusatzarbeiten verrichten muss (Hauptmann rasieren; Szene 5 / Forschungsobjekt für den Doktor; Szene 8), bei denen sich die höher gestellten Mitglieder der Gesellschaft über ihn lustig machen oder ihn unter unmenschlichen Bedingungen leiden lassen, um für seine Freundin Marie und ihr gemeinsames uneheliches Kind zu sorgen. Marie betrügt ihn jedoch im Laufe der Handlung mit dem gesellschaftlich höher gestellten Tambourmajor, der in der Lage ist ihr teuren Schmuck zu schenken. Als weiteren Punkt ist die Tatsache zu nennen, dass keine der Figuren im Drama ein klar definiertes Ideal verfolgt, sondern dass sie die guten und schlechten Seiten ihrer Welt ungeschönt miterleben und der Leser damit zum Mitempfinden angeregt wird und ihre Taten daher für diesen nachvollziehbar sind. Insgesamt sind die Aussagen Büchners auf Grundlage der zuvor genannten Punkte auf das Drama „Woyzeck“ zutreffen.
Effi Briest
Inhaltsangabe Effi Briest
Effie Briest ist zu Beginn des Romans ein 17 jähriges Mädchen, das aus adligem Hause stammt. Gemeinsam mit ihren Eltern lebt sie auf dem Gut Hohen-Cremmen. Die Familie erwartet den Landrat Baron von Innstetten aus Kessin, einen ehemaligen Verehrer von Effies Mutter, zu besuch. Der Baron hält bei seinem Besuch um Effies Hand an und diese lässt sich von ihrer Mutter überzeugen sich zu verloben. Sie heiraten und machen eine Hochzeitsreise nach Italien. Danach zieht Effie zu Innstetten nach Kessin. Effie hat von Beginn an Angst vor dem Haus, jedoch freundet sie sich schnell mit Innstettens Hund Rollo und dem Apotheker Gieshübler an. Im Laufe der Zeit langweilt sich Effie zunehmend, da Innstetten arbeiten muss und sie sich nicht mit den übrigen adligen Damen der Gegend anfreunden will. Am Ende des Jahres wird sie schwanger. Effie vertreibt sich die Zeit mit Spaziergängen. Bei einem Spaziergang trifft sie Roswitha, deren frühere Arbeitgeberin gerade gestorben war. Effie bietet ihr eine Stelle als Kindermädchen für ihr Kind an. Effie bekommt eine Tochter namens Annie. Major Crampas, ein ehemaliger Kamerad von Innstetten, der erst vor kurzem nach Kessin gekommen ist gibt Effie die Hauptrolle in einem Theaterstück, bei dem er Regie führt. Daraufhin reiten Effie und Crampas des öfteren gemeinsam aus. An Weihnachten reist die adlige Gesellschaft der Stadt zum Oberförster, doch auf der Rückfahrt müssen sie den Schloon passieren, was für die Kutschen kaum möglich ist. Da Innstetten eine andere Kutsche fahren muss fährt Crampas mit Effie und sie beginnen eine Affäre. Nach einiger Zeit wird Innstetten nach Berlin versetzt und Effie ist begeistert, da sie nicht mehr in dem Haus und in der Nähe von Crampas leben muss. Sie reist nach Berlin und sucht eine neue Wohnung für die Familie. Nach einigen Jahren erkrankt Effie schwer und muss zur Kur nach Bad Ems. Kurz vor ihrer Rückkehr stürzt Annie und schlägt sich den Kopf auf. Innstetten und der Arzt Doktor Rummschüttel machen sich auf die Suche nach Nähzeug und finden dabei Briefe von Crampas an Effie. Innstetten liest die Briefe und trifft sich mit Crampas zum Duell. Dieser verliert das Duell und Innstetten kehrt nach Berlin zurück. Effie bekommt in der Kur einen Brief von ihrer Mutter. In dem Brief schreibt die Mutter das Innstetten sich von ihr Trennt und sie der Ehre halber nicht zu den Eltern zurückkehren kann. Drei Jahre später lebt Effie mit Roswitha, die nach wie vor zu ihr hält, in einer kleinen Wohnung in Berlin. Irgendwann sieht sie ihre Tochter auf der Straße und überzeugt Innstetten davon, dass Annie sieh besuchen darf. Nach Annies Besuch erleidet Effie einen Nervenzusammenbruch. Effies Arzt schreibt daraufhin einen Brief an ihre Eltern in Hohen-Cremmen, die sie daraufhin wieder aufnehmen. Roswitha reist mit ihr und überredet Innstetten Effie den Hund Rollo zu überlassen. Rollo begleitet Effie von nun an auf ihren Spaziergängen bis sie schließlich krank wird und stirbt. Zuvor vergibt sie Innstetten und findet ihren Frieden.