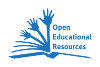Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Benutzer:MGeller
Deutsch,Q1
Mephistosvorstellung
Der Filmausschnitt mit der Vorstellung Mephistopheles wurde 1960 veröffentlicht. Mephistopheles gibt eine sehr lange, detaillierte Beschreibung von sich selber. Bereits im ersten Vers (1336f.) stellt er klar, dass er „[e]in Teil von jener Kraft/ Die stets das Böse will und stets das Gute schafft“ ist. Seiner Meinung nach, ist das Böse das einzig Wahre. Denn nur durch das Böse kann das Gute entstehen. Gut und Böse stehen in einer Abhängigkeit zueinander. Ohne das Eine funktioniert das Andere nicht. Dass Mephistopheles Teil des Bösen ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt mit den Worten „[…][m]ein eigentliches Element […]“ (V. 1344) deutlich. Er stellt sich selbst als Halbes dar, da der Mensch sich „[…] [g]ewöhnlich für das Ganze hält“(V. 1348). Deshalb wäre es ihm lieber, wenn „[…] nichts entstünde […]“ (V. 1341). Wenn nichts Neues mehr entstehen würde, gäbe es auch Nichts mehr zum Zerstören. Dann entstehen auch keine neuen Menschen mehr. Mephistopheles ist mit seinem Element, dem Bösen, der Ursprung. Das Böse ist „[…] [e]in Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar […]“ (V. 1350). Aus dem Bösen, was metaphorisch für die Urfinsternis steht, ist das Licht entstanden. Er und sein Element sind der Ursprung von allem. Die Helligkeit läuft nun der Dunkelheit den Rang ab und macht ihr die Erde streitig. Leider ist das Gute auch in den Menschen tief verankert, sodass das Böse sich nicht vollkommen entfalten kann. Da das Böse diese Verankerung nicht lösen kann, hofft Mephistopheles, dass es nicht lange dauert, ehe es „[…] mit den Körpern […] zugrunde […] [geht]“ (V. 1358). Wenn nämlich niemand mehr auf der Erde existiert, also alle Lebewesen verstorben sind, kann das Gute nicht mehr existieren und das Böse hätte gesiegt. Für Mephistopheles stellt diese „plumpe Welt“ (V. 1364) kaum etwas Bedeutendes dar. Er schafft es aber nicht, ihr beizukommen. Die Versuche „[…] [m]it Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand“ (V. 1367) waren nicht erfolgreich. Das bedeutet, egal, was man probiert, es ist einfach nicht möglich, die Erde und vor allem das Gute auf ihr zu zerstören. Auch der „Tier- und Menschenbrut“ (V. 1369) ist nicht beizukommen. Auch s ie lassen sich von den Taten Mephistopheles, welche stellvertretend für das Böse stehen, nicht beeindrucken. Da das Element des Bösen auf der Erde verdrängt wurde, hat Mephistopheles nun das Element des Feuers für sich entdeckt. „Hätt […] [er sich] nicht die Flammen vorbehalten“ (V. 1377), so hätte er nichts, was seiner Leidenschaft entspricht. Die Flammen oder Feuer allgemein können, genau wie das Böse, sehr große Zerstörung anrichten. Da das Böse mit der Zerstörung nicht weiter gekommen ist, probiert er nun sein Glück mit Feuer als Mittel zum Zweck.
Zusammenfassend wird in diesem Filmausschnitt mit der Vorstellung Mephistopheles sein sehr starker Drang zur Zerstörung und dem Bösen deutlich.
Fausts Selbstdarstellung
Der Auszug (VV.354 – 385) aus dem Drama „Faust - Der Tragödie Erster Teil“ von Johann Wolfgang Goethe ist zwischen 1772 und 1775 im Zeitalter der Aufklärung verfasst worden. Das Drama thematisiert die Suche und den Konflikt im Inneren des Menschen.
Vor diesem Testauszug findet ein Gespräch zwischen dem Teufel und Gott statt, indem sie eine Wette eingehen, dass der Teufel das Böse verbreiten kann. Faust ist auf der Suche nach dem Sinn im Leben und findet in verschiedenen Wissenschaften keine Antwort auf seine Frage. Aufgrund der Wette erscheint der Teufel Faust und schließt auch mit ihm einen Pakt. Er bekommt die Seele Fausts, wenn er ihm bei der Suche nach seiner Antwort hilft. Dazu stellt Mephistopheles eine Verbindung zwischen Faust und Gretchen her. Diese erwartet später ein Kind von Faust, welches sie ertränkt. Außerdem ist sie am Mord ihres Bruders und dem ihrer Mutter beteiligt, weshalb in den Kerker eingesperrt wird. Faust möchte sie befreien, doch Gretchen weigert sich, um auf die gerechte Strafe Gottes zu warten. Dieser erlöst sie von ihrer Schuld.
Im ersten Absatz des Textes (VV. 354 – 365) geht es darum, dass Faust zwar sehr viel weiß, auch verschiedene Wissenschaften studiert hat, aber doch nicht genug weiß, um seine Schüler richtig zu unterrichten beziehungsweise, sie über die Sinnesfragen aufzuklären. Im nächsten Absatz (VV. 366 – 375) stellt Faust fest, dass er doch mehr als andere weiß, und sich vor nichts fürchtet. Im letzten Absatz (VV. 376 – 385) kommt Faust zu dem Beschluss, dass sich nun etwas ändern muss und er sich dazu einen anderen Weg als den bisherigen aussuchen muss. Er probiert den Weg der Magie, sucht also Kontakt zu Übersinnlichem.
Der Textauszug besteht aus 32 Versen. Das Reimschema besteht aus einem unreinen Paarreim: aabcdd. Das Metrum ist nicht eindeutig. Teilweise kann man den Trochäus finden : ,,Habe nun,ach! Philosophie/Juristerei und Medizin" (V.354f.). Da das Metrum unregelmäßig ist, sind auch die Kadenzen nicht eindeutig. Die äußere Form des Monologs ist unregelmäßig mit kleinen regelmäßigen Teilen. Diese Unregelmäßigkeit zeigt, wie aufgewühlt Faust ist. Er beschäftigt sich schon länger mit dem Menschen und seinem Ursprung, also den Sinnesfragen, hat aber bisher keine richtige Antwort gefunden und weiß sich nun nicht mehr anders zu helfen, als sich der Magie hinzugeben. Am Anfang ist Faust noch unsicherer als zu einem späteren Zeitpunkt. Deshalb wird zum Beispiel das Reimschema später auch regelmäßiger, da Faust nun hofft einen Weg gefunden zu haben. Er will es mit der Magie, also mit Kontakt zum Übersinnlichen, versuchen. Dort sollte er dann eine Antwort auf die Sinnesfragen erhalten. Die äußere Form der Verse zeigt also das Innere von Faust.
Faust hat sich schon länger mit Wissenschaften über den Menschen befasst. „Philosophie / Juristerei und Medizin / Und leider auch Theologie“ (V. 354 ff.) sind die Wissenschaften, die Faust studiert hat. Leider haben diese Wissenschaften nicht den gewünschten Erfolg gebracht, obwohl sie „mit heißem Bemühn“ (V. 357) studiert wurden. Deshalb ist Faust nun „so klug als wie zuvor“ (V. 359). Da Faust die Antwort auf seine, schon lange gestellte Sinnesfrage, nicht gefunden hat, er aber Lehrer ist, muss er seine Schüler „an der Nase herum“ (V. 363) führen. Da das eigentlich nicht seine Art ist, „will […] [ihm das] schier das Herz verbrennen“ (V. 365). Das Herz steht hierbei metaphorisch für das Gewissen Fausts.Bisher weiß er aber noch nicht, wie er an seine längst gewünschte Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des Menschen im Bezug auf Gott, das Gute und das Böse kommt. Faust ist sich sehr sicher, dass er „gescheiter als alle die Laffen / Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen“ (V. 366 f.) ist. Er hat keine Angst und will für die Antwort auf seine Frage viel riskieren, da ihm die Unwissenheit „alle Freud [am Leben] entrissen“ (V. 369) hat. Wenn es also keinen Weg zur Antwort auf die Frage nach dem ,,Woher" gibt, will er nicht länger leben. Mit dem Parallelismus „Bilde mir nicht ein was Rechtes zu wissen / Bilde mir nicht ein ich könnte was lehren“ (V. 371 f.) wird nochmal die Unwissenheit Fausts deutlich. Nun hofft Faust endlich einen Weg gefunden zu haben, wie er an die Antwort kommt. Er hat sich „der Magie ergeben“ (V. 377). Anscheinend kann keine Wissenschaft des Menschen auf der Erde eine Antwort liefern, weshalb Faust es mit Übersinnlichem probieren muss. Danach sollte er dann nicht mehr „mit saurem Schweiß / […] sagen brauche[n], was […] [er] nicht weiß“ (V. 380 f.). Mit dem Übersinnlichen sollte es endlich eine Antwort auf die Sinnesfrage geben. Metaphorisch für den Ursprung steht der „Samen“ (V. 384). Aus dem Samen entsteht alles. Pflanzen, Bäume und auch Früchte gäbe es ohne den Anfang des Samens nicht. Faust kann nun endlich etwas tun, um eine Antwort zu finden. Es ist nicht mehr notwendig nur „in Worten [zu] kramen“ (V. 385). Jetzt muss Faust keine Wissenschaften mehr studieren (vgl. V. 354 ff.), sondern kann praktisch nach der Antwort suchen.
Genau wie im gesamten Drama sucht Faust in dieser Textstelle nach dem Ursprung des Menschen im Bezug auf Gott, das Gute und das Böse. Dabei stellt er fest, dass es nur mit einem Studium nicht möglich ist, diesen zu finden, da die verschiedenen Wissenschaften, die sich mit dem Menschen auseinander setzen, keine Antworten liefern.
Zusammenfassend geht es in dieser Textstelle darum, dass Faust nun nicht mehr durch Studieren nach der Antwort auf die Frage nach dem Ursprung sucht, sondern nun Kontakt zum Übersinnlichen herstellt, um dort eine Antwort zu erhalten. == Mephisto Faust Figurenvergleich == Mephisto=überzeugt von seinem Element (das Böse, war vor dem Guten da) Faust zweifelt an seinem Wissen, er weiß als Universalgelehrter viel, aber nicht genug -> mehr Wissen vorhanden, als Menschen denken zu kennen ( Antwort auf die Sinnesfrage) Mephisto nutzt Fausts Lage aus ( streben nach mehr Wissen) -> hat großen Einfluss auf sein Handeln ( will Faust zum Bösen bekehren) Faust ist gutgläubig -> glaubt an Hilfe Mephistos ( letzter Weg, um eine Antwort auf die Sinnesfrage zu finden
Die beiden Personen Faust und Mephistopheles aus dem Drama „Faust – Der Tragödie Erster Teil“ von Johann Wolfgang Goethe werden im Folgenden miteinander verglichen.
Mephistos Element ist das Böse. Seiner Auffassung nach war das Böse vor dem Guten auf der Erde. Die Dunkelheit war mit der Urfinsternis vor der Helligkeit auf der Erde. Er möchte das Gute von der Erde vertreiben, denn nur Zerstörung ist die Aufgabe seines Lebens. So hofft er, ,,mit den Körpern wird’s zugrunde gehen“(V.1358). Deshalb nutzt er die Lage von Faust aus. Faust ist schon lange auf der Suche nach der Antwort auf die Sinnesfragen. Grundsätzlich verkörpert er die gesamte Menschheit, die eigentlich eher zum Guten hingezogen ist, sich aber vom Bösen beeinflussen lässt. Er befindet sich in einer totalen Sinnkrise. Deshalb ist ihm jede Gelegenheit recht, um zu seiner Antwort zu kommen und endlich wieder den Sinn in seinem Leben zu finden, denn ,,[…] [es] möchte kein Hund so länger leben!“(V.376). Obwohl er sogar die Titel ,,Magister […] [und] Doktor“ trägt und ,,Philosophie,/ Juristerei und Medizin/ Und leider auch Theologie!“(V.354ff.) studiert hat, reicht dieses Wissen nicht aus, um die Sinnesfragen zu beantworten. Mephistopheles und Faust handeln also Beide triebgesteuert, um ihre Bedürfnisse zu stillen: Mephistopheles will die Welt zerstören und das Böse verbreiten und Faust möchte um jeden Preis die Sinnesfrage beantworten. Dabei stellt sich Mephistopheles aber so intelligent an, dass Faust diese List nicht bemerkt und gutgläubig die Hilfe annimmt.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Faust und Mephistopheles Parallelen in ihrem Handeln aufweisen. Beide handeln triebgesteuert, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Mephistopheles verkörpert ganz deutlich das Böse, während Faust stellvertretend für die Menschheit zwar mehr zum Guten hingezogen ist, sich aber auch vom Bösen sehr weit beeinflussen lässt.
Berichtigung
Aufgabe 1
Der vorliegende Textauszug aus dem Drama „Faust – Der Tragödie Erster Teil“, welches von Johann Wolfgang Goethe in den Epochen der Klassik (1786-1832) und des Sturm und Drang (1765-1785) verfasst und 1808 (erst-) veröffentlicht wurde thematisiert den Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen im Inneren des Menschen. Der Textauszug „Wald und Höhle“ befasst sich mit der Änderung der Sicht auf die Welt Fausts, wobei er sich in totaler Harmonie mit der Natur befindet.
Faust befindet sich in einer tiefen Sinnkrise. Er wollte begreifen, warum die Menschen leben und wozu überhaupt. Er hatte verschiedene Wissenschaften studiert und muss sich, aufgrund mangelnder Antworten, zum Übersinnlichen wenden. Das geschieht durch den Erdgeist. Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch erschien ihm der Teufel Mephistopheles, der ihm einen Pakt anbietet. Er bekommt die Seele Fausts, wenn er ihm zeigt, was die schönen Dinge im Leben sind. Dazu verjüngt er ihn mit einem Trank. Danach stellt Mephistopheles eine Verbindung zu Gretchen, mit Hilfe eines Schmuckkästchens her, um Faust zu zeigen, was Liebe ist. Diese Liebe verändert Fausts Sicht auf die Welt, was in dieser Textstelle dargestellt wird. Um mit Gretchen allein sein zu können, gibt er ihr einen Schlaftrank für die Mutter, die daran stirbt. Gretchen erwartet von Faust ein Kind, welches sie aber tötet. Als Strafe muss sie in den Kerker, woraus Faust sie befreien möchte. Gretchen verweigert dies und möchte auf die gerechte Strafe Gottes warten, der sie frei spricht.
Der Textauszug besteht aus 24 Versen. Es liegt kein Reimschema vor. Das Metrum ist unregelmäßig. Teilweise kann man einen Jambus finden (vgl. V.2f.). Dem zu Folge sind auch die Kadenzen unregelmäßig. Die Unregelmäßigkeit der Form dieses Textauszuges lässt auf das Innere Fausts hindeuten. Faust hat nach einiger Zeit mit Hilfe des Erdgeists ansatzweise erlebt, was der Sinn im Leben ist. Dabei wurde aber nicht vollkommen geklärt, wozu die Menschen leben und wieder verschwinden, also sterben.
Im Textauszug nimmt Faust wieder Kontakt zum Erdgeist auf. Er bedankt sich für die bisherigen Antworten und Offenbarungen. Bereits die Überschrift des Textauszugs „Wald und Höhle“ zeigt Gegensätze auf. Der Wald steht symbolisch für Weite und Dunkelheit. Die Höhle ist begrenzt. Man kann sich in ihr schützen, zum Beispiel vor Stürmen oder Regen. Die Enge der Höhle erinnert an das gotische Studierzimmer Fausts, welches sehr eng und vollgestopft ist. Der Erdgeist wird als „[e]rhabner Geist“ (V.2) angesprochen. Mit der Wiederholung „gabst mir, gabst mir“ (ebd.) wird deutlich, Faust hat durch den Erdgeist wichtige Erkenntnisse erhalten. Durch diese Erkenntnisse ist Faust in seiner Sinnkrise vorangeschritten. Jetzt wird ihm dieser Fortschritt bewusst, was man an den Worten „[d]u hast mir nicht umsonst / Dein Angesicht im Feuer zugewendet“(V.3f.) erkennen kann. Faust konnte in der „herrlichen Natur“ (V.5) nach diesen Antworten in seiner Sinnkrise suchen. Er hatte nicht nur Zeit die Antwort zu suchen, sondern konnte sie, durch die Kraft des Erdgeists spüren und erleben (vgl.V.6). Neben dem Erleben in der Natur, im Königreich des Erdgeist, konnte Faust auch Einblicke „in [die] tiefe Brust“ (V.8) der Natur erhalten. Die „tiefe Brust“ (ebd.) steht metaphorisch für das Geschehen auf der Erde, also wie Dinge und Abläufe funktionieren. Auch in schweren Zeiten konnte Faust sich auf den Erdgeist verlassen. „Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt“ (V.13), „[…] dann führst du mich zur sichern Höhle“ (V.17). Auch in schwierigen Zeiten hat der Erdgeist Faust nicht alleine gelassen. Er bildet ständig Rückhalt bei Problemen oder schwierigen Situationen. Durch den Erdgeist erst hat Faust eine andere Sichtweise erlangt. Faust sieht sich als ein Teil der Natur, seine Brüder lernt er dadurch erst richtig kennen (vgl.V.11 f.). Auch kann er nun die „Lebendigen“ (V.10), aber auch Pflanzen, wie zum Beispiel Büsche (vgl.V.11 f.) besser verstehen und fühlt sich ihnen sehr verbunden. „Geheime tiefe Wunder öffne[ten] sich "(V.19), sodass Faust die Möglichkeit hatte die Verhaltens- und Vorgehensweisen besser nachzuvollziehen. Er konnte verstehen, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Die Liebe zu Gretchen hat Faust zu dieser Ansicht verholfen. Die Welt kann auch Schutz bieten, wofür metaphorisch der Weg zur „sichern Höhle“ (V.17) steht. Wie schon zu Anfang erwähnt, ist die Höhle klein und eng und man kann sich bei Unwetter unterstellen. Nun erscheinen Faust aber seine Ahnen, die er als „silberne Gestalten“ (V.23) aus „[d]er Vorwelt“ (ebd.) beschreibt. Dieses Erscheinen der Ahnen deutet darauf hin, dass Faust von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Er hatte mit Mephistopheles einen Pakt um seine Seele geschlossen und da er nun eine Antwort auf die Frage, wofür die Menschen leben, fast gefunden hat, tritt dieser Pakt bald in Kraft. Da nun diese Vereinbarung wieder in seine Erinnerung gerufen wird, hat er nun die Lust verloren, weiter zu suchen. Diese „strenge Lust“ (V.24) wird also gelindert (vgl.V.24).
Faust fasst in dieser Textstelle abschließend seine bisher erlangten Erkenntnisse zusammen. Er nennt die Aspekte der engen Verbindung zur Natur und deutet auf die Liebe zu Gretchen hin.
Aufgabe 2
Die Welt- und Menschenbilder Fausts (VV.1-24) und Mephistos (VV.22-54) werden im Folgenden miteinander verglichen.
Mephistos Elemente sind das Böse und die Dunkelheit, welche durch die Urfinsternis schon lange auf der Erde sind. Von den Menschen hält Mephisto daher gar nichts, was mit den Worten „[u]nd dem verdammten Zeug, der Tier- und Menschenbrut / Dem ist nun gar nichts anzuhaben“ (V.54 f.) deutlich wird. Mephisto möchte, dass die Menschen von der Erde verschwinden und dass er, zusammen mit der Dunkelheit, die Erde wieder ganz für sich alleine hat. Auch gegenüber der Erde ist Mephisto nicht besser eingestellt. „[Dem] Etwas, diese[r] plumpe[n] Welt“ (V.40) ist nicht beizukommen (vgl.V.42). So wie die Erde von den Menschen verändert worden ist, gefällt sie Mephistopheles nicht, so dass er sie zerstören oder zumindest verändern möchte. Faust hatte während seiner Sinnkrise große Zweifel an der Menschheit. Mittlerweile hat sich sein Menschenbild wieder in die positive Richtung verschoben. „Geheime tiefe Wunder“ (V.19) öffneten sich Faust. Er bekam Einblicke in den Sinn des Lebens, in die Liebe (seine Liebe zu Gretchen). Er versteht nun besser, wozu Menschen leben. Auch das Weltbild Fausts hat sich in der Phase der Sinnkrise bis jetzt verändert. Er hat „Philososphie/ Juristerei und Medizin/ Und […] Theologie“ (V.354 ff.) studiert, um die Sinnfrage zu beantworten. Dabei verbrachte er sehr viel Zeit in seinem Studierzimmer und hat wenig von der Außenwelt wahrgenommen. Durch den Erdgeist wurde ihm eine neue Sicht auf die Welt eröffnet. Er lernte „[den] stillen Busch, […] Luft und Wasser“ (V.12) kennen und erlangte Einblicke, die er vorher nie erhalten hatte.
Die Menschenbilder Fausts und Mephistos weisen zunächst Prallelen auf. Mephistos ist sehr negativ. Fausts zunächst auch, da er am Wissen der Menschen zweifelt. Nach langer Suche auf die Antwort nach dem Sinn im Leben, verändert sich seine Sichtweise. Auch die Weltbilder der Beiden weisen Parallelen auf und wieder verändert sich Fausts Sichtweise zum Positiven.
Der hessische Landbote
Das Flugblatt „Der Hessische Landbote“ von Georg Büchner, welches 1834 in der Zeit des Vormärz veröffentlicht wurde, thematisiert die Missstände der unteren Gesellschaftsschicht, welche nur für das Wohlergehen der oberen Schichten arbeitet. Pastor Friedrich Ludwig Weide hat im Nachhinein Ergänzungen am Text vorgenommen, welche die Inhalte näher beschreiben.
Im ersten Abschnitt des Textes (Z. 1-22) beschreibt Georg Büchner, dass das Lesen, Besitzen und Schreiben dieses Flugblattes stark bestraft wird. Außerdem rät er, was man unternehmen sollte, wenn man dieses Flugblatt besitzt oder liest. Bereits im ersten Satz wird die Funktion dieses Flugblattes genannt. Es „soll dem hessischen Lande die Wahrheit melden“ (Z. 4f.). Das hessische Land steht hierbei metaphorisch für alle Bewohner. Sie sollen endlich darüber aufgeklärt werden, welche Dienste (hauptsächlich die Bauern) leisten. Vorher gab es keine Wahrheit. Das bisher Gesagte beruht auf Lügen. Georg Büchner riskiert mit der Veröffentlichung dieses Flugblattes sein Leben. Er weiß, dass jeder der die Wahrheit sagt, sogar nur liest, mit dem Tod bestraft wird (vgl. Z. 5ff.). Kritik am bisherigen System wird nicht geduldet, denn die Wahrheit wird von den Obersten, in diesem Fall den Fürsten, bestimmt. Die Klimax „wer die Wahrheit sagt, wird gehenkt, ja sogar der, welcher die Wahrheit liest, wird durch meineidige Richter […] bestraft“ (ebd.) verdeutlicht, wie drastisch Kritik üben unerwünscht bzw. verboten ist. Auch die „meineidigen Richter“ (ebd.) unterliegen den Fürsten, werde also nicht gegen diese sprechen, denn dies sorgt für Probleme. Da Georg Büchner bereits sein Leben für dieses Flugblatt riskiert, versucht er zumindest, die Bevölkerung vor Strafen zu schützen. Im ersten Satz weist er darauf hin, dass man auch der Polizei kein Vertrauen schenken kann, da auch diese von den Fürsten beschäftigt wird. „Sie müssen das Blatt sorgfältig außerhalb ihres Hauses vor der Polizei verwahren“ (Z. 10f.). Damit die Polizei einen nicht direkt mit dem Flugblatt in Verbindung bringen kann, sollte es an einem anderen Ort aufbewahrt werden. So besteht wenigstens noch eine winzige Möglichkeit zu leugnen, dass einem selbst dieses gefundene Flugblatt gehört. Im nächsten Teil weist Büchner darauf hin, dass man das Blatt nur „treue[n] Freunde[n]“ (Z.12) öffentlich überreichen darf. Jedem dem man nicht vertraut, soll man es auch weitergeben, aber so, dass diese nicht wissen, woher die Informationen kamen (vgl. Z. 14ff.). Des weiteren weist Georg Büchner daraufhin, dass man beim Auffinden dieses Blattes durch die Polizei leugnen sollte. Man hatte ,,es eben dem Kreisrat […] bringen" (Z.18) wollen. Die Bauern sollten in jedem Fall nicht direkt mit diesem Flugblatt in Verbindung gebracht werden. Sollte die Polizei einen mit diesem Blatt erwischen, müsste man immer leugnen, es gelesen zu haben. Denn, wie im fünften Satz genannt, trifft die, die es nicht gelesen haben, keine Schuld (vgl. Z. 20ff.). Allerdings ist das ziemlich widersprüchlich, denn wenn man bereits bis zum fünften Punkt gekommen ist, dann hat man bereits das Blatt gelesen, sich also strafbar gemacht. Georg Büchner war es sehr wichtig, dass so viele Menschen, wie irgend möglich diese Aufklärung erhielten. Er wollte, dass die Bauern- und Arbeiterschicht endlich begreift, dass sie nur ausgenutzt wird.
Der zweite Abschnitt des Textes (Z. 23-44) erläutert die genauen Umstände, in denen das hessische Volk leben bzw. schuften muss. Der Abschnitt beginnt mit den beiden Ausrufen „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ (Z. 23). Die „Hütten“ (ebd.) stehen hierbei metaphorisch für die Bauern und Arbeiter, die eher in bedürftigen Verhältnissen lebten. Die „Paläste“ (ebd.) sind der komplette Kontrast dazu. Sie stehen metaphorisch für die Behausung und das Leben der Fürsten. Die Aufforderung, die diese Ausrufe beinhalten, fordert die Bauern auf, sich endlich zu wehren und gegen die Fürsten vorzugehen. Diese Ellipsen wirken wie ein Schlachtruf, welcher zur Revolution anregt. Diese sind so knapp formuliert, dass sie den Menschen in den Köpfen bleiben. Pastor Friedrich Ludwig Weide ergänzte auf diese Ausrufe, dass es so aussieht, „als würde die Bibel Lügen gestraft“ (Z. 24 f.) sein und als hätte Gott innerhalb des Menschen Unterschiede geschaffen. Diese Anspielung auf die Schöpfungsgeschichte wird noch konkretisiert. Die „Bauern und Handwerker [sind] am fünften Tage“ (Z. 26f.) gemacht und zählen somit zu den Tieren. Die „Fürsten und Vornehmen [sind] am sechsten Tag gemacht“ (Z. 27f.) und sind somit mehr wert. Die Vornehmen nutzen die Bauern genau wie die Tiere komplett aus. Diese Behauptung macht dieses Dilemma mit einem starken Vergleich deutlich. Die Fürsten verstehen die Bibel „als hätte der Herr zu […] [ihnen] gesagt: „Herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht“, und hätte die Bauern und Bürgern zum Gewürm gezählt“ (Z. 28ff.). Durch diese Worte soll das Missverständnis der Fürsten der Bibel deutlich werden. Da es nur so aussieht, als hätte Gott das gesagt (vgl. Z. 24ff.), bedeutet das nicht, dass es auch wirklich so ist. Genau dieser Irrtum soll durch dieses Flugblatt aus dem Weg geschafft werden. Die oberen Gesellschaftsschichten brauchen nicht zu arbeiten, denn ihr Leben „ist ein langer Sonntag“ (Z. 32). Der Sonntag ist der siebte Tag der Schöpfung, an dem Gott geruht hatte. Die Fürsten ruhen ihr ganzes Leben lang, da sie sich auf Kosten der Bauern ausruhen können. Sie machen sich ein schönes Leben und „tragen zierliche Kleider“ (Z. 33f.). Selbst „eine eigene Sprache“ (Z. 35), nämlich Französisch, sprechen sie, um sich von der übrigen Gesellschaft, die den hessischen Dialekt spricht, abzuheben. Dass die anderen Menschen, also die Bauern und Handwerker, ihre Lebensgrundlagen sichern, hierfür steht metaphorisch der „Dünger auf dem Acker“ (Z. 36), realisieren sie kaum bzw. kümmern sich nicht darum. Sie kassieren Abgaben und nehmen sich, wieviel und wann sie etwas brauchen und wenn es notwendig ist, treiben sie die Bauern nochmal an, welche gemeinsam mit dem Vieh auf dem Feld schuften müssen (vgl. Z. 37ff.). Dieses Abnehmen der lebensnotwendigen Grundlagen wird mit den Worten „er nimmt das Korn und lässt ihm die Stoppeln“ (Z. 39f.) deutlich. Wobei die Fürsten und Vornehmen sich nicht nur mit dem Korn begnügt haben, sondern auch von allen anderen Dingen Anteile einfordern. Übrig bleibt den Bauern ein leergeräumtes Feld. Im Vergleich zum eben genannten Leben als Sonntag, ist das Leben der Bauern „ein langer Werktag“ (Z. 41). Sie können sich nie ausruhen, da sie sowieso schon um ihre Existenz kämpfen. „Sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische der Vornehmen“ (Z. 43f.). Den Vornehmen geht es eigentlich sowieso schon besser, aber der Schweiß der Bauern macht ihr Leben noch schöner. Sie müssen nichts mehr tun. Diese deutlichen Worte sollen den Bauern die Augen öffnen. Es kann nur etwas an dieser schlimmen Situation geändert werden, wenn sie selber ihre Stimme erheben und ihr Schicksal in die Hand nehmen. Büchner greift in diesem Flugblatt zu sehr deutlichen Vergleichen um die Menschen zu retten. Nur sie selber können sich erlösen.
Die Rettung der unteren Schichten lag Georg Büchner sehr am Herzen. Er riskiert sein Leben dafür, um den Menschen die Augen zu öffnen. Um den Menschen ihre Situation anschaulich näher zu bringen, benutzt er sehr viele Metaphern. Auch Pastor Friedrich Ludwig Weidig hat viel riskiert, da er sich öffentlich über die Bibel äußert und die Menschen aufklärt, wie die Schöpfungsgeschichte abgelaufen bzw. nicht abgelaufen ist, was zu diesem Zeitpunkt der Geschichte eine beachtliche Leistung ist und mit viel Mut verbunden ist, denn auch er riskiert sein Leben für das Leben vieler Menschen.
Vergleich Flugblatt und Woyzeck
Im Folgenden werden die im Flugblatt benannten Missstände der unteren Gesellschaftsschicht mit Beispielen aus dem Drama „Woyzeck“ von Georg Büchner konkretisiert.
Die Bauern lebten zur damaligen Zeit unter bedürftigen Umständen. Sie waren untergeordnet. Auch Woyzeck musste sich als Soldat seinem Hauptmann unterordnen (vgl. Szene 5). Er spielt für den Hauptmann den Laufburschen, um Geld für seine Familie zu verdienen. Zusätzlich zu seinem Hauptberuf als Soldat, ist Woyzeck Versuchskaninchen des Doktors (vgl. Szene 8). Viel zu arbeiten war für die unteren Schickten normal. Das fasst Büchner im Flugblatt zusammen mit den Worten, „das Leben des Bauern [sei] ein langer Werktag“ (Z. 40f.). Die oberen Schichten ruhen sich dagegen aus. Auch das Experiment Woyzecks ruht niemals. Der Hauptmann möchte auch stetig, dass ihm Woyzeck zur Verfügung steht. In seinem Flugblatt behauptet Georg Büchner, die Vornehmen würden eine eigene Sprache sprechen, nämlich Französisch (vgl. Z. 35). Auch im Drama Woyzeck fallen französische Wörter wie „Société“ oder „eine Bête“ (vgl. Szene 3), die in der Alltagssprache integriert wurden, da auf dem Markt auch Vornehme einkaufen. Grundsätzlich hoben sich die Oberen aber durch die Sprache von den Unteren ab. Der Pastor hat im Flugblatt Ergänzungen im Bezug auf die Bibel und die Schöpfungsgeschichte vorgenommen. Die Menschen beriefen sich bei Problemen oft auf die Bibel. Auch Marie schlägt in der Bibel nach, nachdem sie gesündigt hat (vgl. Szene 17). Der Vornehme, im Falle Woyzecks der Hauptmann, treibt den Bauern an, wenn es notwendig ist (vgl. Szene 5 Z. 38ff.). Auch der Tambourmajor hat mehr Geld als Woyzeck und meint, sich nehmen zu können, was ihm gefällt. So nimmt er sich auch Marie (vgl. Szene 6), welche sich darauf einlässt.
Durch den Bezug der genannten Probleme aus dem Flugblatt zum Drama Woyzeck wird deutlich, dass Georg Büchner sich auf Tatsachen beruft. Im Drama werden die in Metaphern benannten Missstände ausführlicher dargestellt. Das Leiden der unteren Schicht wird konkretisiert am Leben einer Familie, der Familie Woyzecks.
Georg Büchner: Brief an die Familie
Der Brief „An die Familie“ von Georg Büchner wurde im Juli 1835 in Straßburg in der Zeit des Vormärz verfasst und thematisiert die These Büchners über die Aufgaben von Dichtern.
Im ersten Sinnabschnitt (Z.1-16) nennt Büchner, was seiner Meinung nach die Aufgaben von Dichtern sind. Seiner Meinung nach ist der „dramatische Dichter […] nichts als ein Geschichtsschreiber“ (Z.1). Er erzählt also nicht irgendeine Geschichte, der er im Drama darstellt, sondern er greift Geschehnisse aus der Vergangenheit auf und konkretisiert diese dann in einer bestimmten Geschichte, im Drama. Damit ermöglicht er dem Leser seines Dramas einen besseren Einblick auf das Passierte (vgl. Z.5) und schärft damit gleichzeitig die Sinne. Somit soll vermieden werden, dass sich schlimme Ereignisse wiederholen. Die Bezeichnung des „lieben Herrgott[s]“ (Z.10, vgl. Z.25) ist widersprüchlich, denn wenn schlimme Ereignisse passieren, kann Gott nicht lieb sein. Da Geschichte nicht verändert werden soll, auch im Kontext eines Dramas nicht, kann Geschichte oftmals auch brutal sein. Dies ist keine „ Lektüre für junge Frauenzimmer“ (Z.11). Frauen wurden zur damaligen Zeit wie unmündige kleine Kinder behandelt. Dem zu Folge kann man ihnen Brutalität in Form einer Lektüre nicht zu kommen lassen, denn Frauen können die Inhalte nicht richtig verstehen und interpretieren. Die Inhalte, die ein Dichter in seinem Drama präsentiert, zeigen nicht auf, wie man sich zu verhalten hat (vgl. Z.12). Sie sollen lediglich auf falsche Verhaltensweisen hinweisen und vermeiden, dass dieses sich wiederholen. Büchner möchte verdeutlichen, wie wichtig Dramen sind. Man kann aus ihnen genauso lernen wie aus dem „Studium der Geschichte und der Beobachtung dessen, was im menschlichen Leben um sie herum vorgeht“ (Z.15f.). Dramen haben wichtige Funktion. Der Beruf des Dichters ist also auch ein sehr wichtiger Beruf.
Der zweite Sinnabschnitt (Z.16-32) befasst sich mit Beispielen Büchners von verschiedenen Tätigkeiten, die man nicht machen sollte, wenn man davon überzeugt ist, dass der Dichter zu viele unmoralische Dinge im Drama verfasst. Wenn Dramen unmoralische Inhalte oder Handlungsweisen verbreiten, dann „dürfte man [auch] keine Geschichte“ (Z.17) mehr studieren. Diese berichtet nämlich dieselben Ereignisse nur direkter und ohne große Umschreibung. Man dürfte auch nicht mehr mit offenen Augen durch die Welt gehen (vgl. Z.18f.), denn auch in der Welt und im täglichen Geschehen passieren unmoralische Dinge, die man nicht in seine Verhaltensweisen übernehmen sollte. „Wenn man [Büchner] […] noch“ (Z. 22) sagt, dass der Dichter nicht die Welt der Realität, sondern die Welt als Wunschvorstellung zeigen muss, dann beruft er sich auf Gott. Gott hat die Welt so gemacht, wie sie sein soll (vgl. Z.25f.), das inkludiert aber auch alle schlechten Ereignisse. Da diese von Gott gewollt sind, kann der Dichter diese also auch in seinem Drama nennen bzw. darstellen. Die Idealdichter, also die, die eine schöne Welt zeigen, zeigen Büchners Meinung nach nur „Marionetten“ (Z.28) (vgl. Z.26ff.). Der Realitätsbezug fehlt, denn diese „Marionetten“ (ebd.) erleben nur Gutes, was aber in keiner Weise das Geschehen und Handeln auf der Welt zeigt. Sie zeigen nicht die wahren Menschen, die den Leser mitfühlen lassen, was gerade passiert, sondern sie zeigen gar nichts (vgl. Z.29ff.). Um Menschen mitzunehmen und Eindruck zu hinterlassen, reicht das zeigen von Idealen nicht aus. Eine Hauptfigur, welche verschiedene Dinge erlebt und in welche die Menschen sich hineinversetzen können, hat laut Büchner einen höheren Stellenwert und funktioniert zu Aufklärung, damit schlimme Ereignisse kein zweites Mal stattfinden. Der Mensch muss kritisch über den Inhalt eines solchen Dramas nachdenken können und Denkanstöße zum Handeln erhalten. Schiller ist ein Idealdichter, denn von ihm hält Georg Büchner kaum etwas (vgl. Z.32).
Im Brief an seine Familie erklärt Büchner, dass der Dichter Vergangenheit darstellen muss, um die Menschen vor Wiederholungen zu beschützen. Seiner Meinung nach hat das Darstellen einer schönen Welt wenig mit der Aufgabe des Dichters zu tun.
Berichtigung 2.Klausur
R-Fehler
Die Aufstände waren vorher schon zum Scheitern verurteilt.
Sie geben einem kein Recht sich zu äußern, wofür metaphorisch der ,,Knebel im Munde“(Z.10) steht.
Auch Taten sind unerwünscht, was mit der Metapher ,,angeschmiedeten Hände […] und Füße[…]“ (Z.10) deutlich wird.
Büchner will sich auch in Zukunft weiter gegen die Zustände auflehnen.
,,Irren ist keine Sünde“ (Z.21).
Eine zusätzliche Abhängigkeit besteht auch zum Doktor (vgl. Sz. 8 und 9).
Z-Fehler
Erreichen sie endlich etwas, bekommen sie es, als wären sie nichts wert.
Im Folgenden werden die benannten Missstände und Ungerechtigkeiten aus dem ,,Brief Büchners an die Familie“, welcher 1833 verfasst wurde, mit dem Drama ,,Woyzeck“, ebenfalls von Georg Büchner, 1879 veröffentlicht, am Beispiel Woyzecks konkretisiert.
Zit-Fehler
Auch Taten sind unerwünscht, was mit der Metapher ,,angeschmiedeten Hände […] und Füße[…]“ (Z.10) deutlich wird.
Gr-Fehler
Georg Büchner ist der Auffassung, dass die Aktionen in Frankfurt geringen bis keinen Erfolg gebracht haben.
Nur die arbeitende Schicht, welche unter Unterdrückung lebte und keine Sicht auf die Realität hatte, konnte zu so einem Zeitpunkt versuchen, gegen die Situation vorzugehen (vgl.6f.).
Die Bauern und Arbeiter sind zum damaligen Zeitpunkt von den Fürsten und Vornehmen unterdrückt (vgl. Z.4). Die Unterdrückten müssen auf die Erfüllung von Bitten lange warten.
Sb-Fehler
Die Frage nach der Realität stellt Büchner seinen Eltern.
Georg Büchner zeigt mit dem Parallelismus ,,Wenn ich an dem was geschehen, keinen Teil genommen und an dem, was vielleicht geschieht, keinen Teil nehmen werde“ (Z.16f.), dass er den Zeitpunkt denkbar unpassend findet.
A-Fehler
Büchner bezeichnet die wenig erfolgreichen Forderungen auch als ,,Kinderspielzeug“ (ebd.), da sie davon ablenken sollen, dass die Menschen eigentlich durch eine ,,eng geschnürte Wickelschnur“ (Z.5) an die Fürsten und den Adel gebunden sind.
Aufstände waren unerwünscht, aber auch kaum möglich, was das Volk aber nicht mitbekommt.
Andererseits wird aber auch deutlich, dass die Bauern eigentlich eine Mehrheit darstellen und dadurch theoretisch mehr bewirken könnten.
Dies hat aber zu wenig Erfolg geführt, da sie sich geirrt haben.
Dieses Scheitern ist darauf zurückzuführen, dass das deutsche Volk lange Zeit zum Handeln braucht.
Woyzeck kann auch diesen beiden eher niedrigen Positionen nicht entkommen, denn wenn er ginge, würde er seine Familie nicht mehr ernähren können.
Effi Briest Analyse 19.Kapitel
Der Roman ,,Effi Briest“ von Theodor Fontane wurde 1894 (erst-)veröffentlicht in der Zeit des bürgerlichen- oder auch poetischen Realismus. Der Roman handelt vom Zwang, sein Ansehen in der Gesellschaft nicht zu verlieren.
Effi Briest wird als Mädchen mit dem ehemaligen Geliebten der Mutter, Baron von Innstetten, verheiratet. Nach der Hochzeit zieht sie mit ihm nach Kessin. Da Innstetten aber weiterhin seiner Arbeit als Landrat nachgeht und dazu viel reist, fühlt sich Effi oft allein gelassen. Sie bildet sich ein, es würde spuken und fürchtet sich. Einige Monate später lernt sie Major Crampas kennen, der das genaue Gegenteil von Innstetten ist. Die Effi und Crampas kommen sich näher und beginnen einen regen Briefwechsel.
Im vorliegenden Textauszug kommt es bei einer Schlittenfahrt zu einem Höhepunkt der Affäre, bevor Effi nach Berlin umzieht.
Nach dem Umzug nach Berlin, Innstetten möchte weiterhin sein Ansehen verbessern, 6 Jahre später, kommt die Affäre Effis und Crampas zu Tage, da Innstetten die Briefe der Beiden findet. Trotz seines Ansehens beendet er die Ehe, weshalb Effi zu einem späteren Zeitpunkt zu ihren Eltern ziehen muss, wo sie schließlich auch stirbt und auf dem Rondell im Garten begraben wird.
Im ersten Abschnitt (Z.1-8) steigt Crampas zu Effi in den Schlitten.
Sie bleibt zu nächst „unschlüssig“ (Z.1), was bedeutet, dass sie nicht genau weiß, ob sie Crampas die Mitfahrt in ihrem Schlitten verwehren kann, oder nicht. Schließlich entscheidet sie aber doch, dass Crampas mit ihrem Schlitten fahren kann. „Crampas nimmt links neben ihr Platz“ (Z.2f.). Sie hatte Crampas doch ein wenig Platz in ihrem Schlitten gemacht. Das Crampas ein „Frauenkenner“ (Z.5) ist, deutet darauf hin, dass er öfter in der Gegenwart von Frauen verkehrt und weiß, wie diese sich verhalten. Er nutzt aber auch Effis Unschlüssigkeit aus, denn er weiß genau, dass diese „sich seine Gegenwart“ (Z.7f.) nicht verbitten wird.
Im nächsten Abschnitt (Z.8-18) fahren die Beiden mit dem Schlitten Effis am Wasser entlang. In der Ferne kann man den Wald sehen.
Innstetten hat als Landrat eine höher gestellte Position, somit steht er auch über seiner Frau. Diese Position wird dadurch deutlich, dass er mit dem Schlitten weiter vorne fährt. Er „hatte sich inzwischen einen anderen Plan gemacht“ (Z. 14f.) und entschieden, nicht den auf der Hinfahrt genutzten Weg wieder zurück zu nehmen. Er ist der Landrat, er entscheidet und macht Pläne, ohne sich mit Anderen abzusprechen oder sich an seine Frau zu erinnern, die sich ständig vor Spuck fürchtet, somit auch im Wald Angst hast. Der Wald wird mit dem Adjektiv „dunkel“ (Z.10) beschrieben. Zudem ist er nicht nur Wald, sondern „Waldmasse[…]“ (ebd.). Diese Beschreibung lässt den Wald noch dunkler und bedrohlicher erscheinen, so dass Effi alleine beim bloßen Anblick schon Angst bekommen musste.
Im nächsten Abschnitt (Z.18-29) realisiert Effi die Heimfahrt durch den Wald und beginnt sich zu fürchten.
Als Effi realisiert, wo sie nun der Weg herführt „[er]schrak“ (Z.18) sie. Die Angst kommt direkt in ihr hoch. Zuvor „waren Luft und Licht um sie her gewesen“ (ebd.), wovor sie sich nicht fürchten musste. „Luft und Licht“ (ebd.) stehen metaphorisch für Freiheit und Weite. Außerdem stehen sie in Kontrast zum dunklen Wald, der eine gewisse Bedrückung und Einengung mit sich bringt. Die Angst breitet sich richtig in Effi aus, als sie „[e]in Zittern überk[ommt]“ (Z.21). Nun braucht sie Halt, welchen sie sich selbst versucht zu geben, indem sie „die Finger fest ineinander“ (Z.21f.) verschränkt. Sie versucht sich irgendwie abzulenken, da ihr Mann, der ihr eigentlich Halt geben sollte, in einem anderen Schlitten fährt. Als Ablenkung fällt ihr aber nur das Gedicht „die Gottesmauer“ (Z.24) ein, welches sie sogleich zu beten beginnt (vgl. Z.26). Allerdings realisiert sie schnell, dass dieses Gedicht ihr eigentlich auch keine Hilfe ist (vgl. Z.27). „Sie fürchtet sich“ (ebd.) weiterhin und doch ist da irgendetwas Magisches in dieser Situation, was mit dem Nomen „Zauberbann“ (Z.28) zum Ausdruck kommt.
Im nächsten Abschnitt (Z.30-33) kommt es zum Höhepunkt der Schlittenfahrt.
Crampas nähert sich Effi an und flüstert ihr „leis an ihr Ohr“ (Z.30). Das er leise spricht, deutet darauf hin, dass er vermeiden möchte, dass irgendjemand außer Effi seine Worte hört. Da sie nicht direkt reagiert, nimmt er ihre Hand (vgl. Z.31), um ihr zu zeigen, dass sie keine Angst haben muss, da er für sie da ist. Er nimmt in dieser Situation die Rolle Innstettens ein. Mit den „heißen Küssen“ (Z.32) drückt Crampas seine eigentlichen, versteckten Gefühle und sein Verlangen für bzw. nach Effi aus. Effi selbst verspürt aber auch Gefühle für Crampas, weshalb sie einer „Ohnmacht“ (Z.33) nahe ist.
Im letzten Abschnitt (Z.33-41) wird die Ankunft der Schlitten im Dorf beschrieben.
Während der Annäherung Crampas hatte Effi die Augen geschlossen, denn nun öffnete „sie die Augen wieder“ (Z.34). Außerdem hat sie alles Bedrohliche hinter sich in der „dunkeln Waldmasse[…]“ (Z.10) gelassen. Im Dorf mit den Häusern mit „Schneedächern“ (Z. 38) ist es wieder hell und auch andere Menschen können die Schlitten sehen. Der Halt vor dem landrätlichen Haus (vgl. Z.40f.) ermöglicht ihr das Aussteigen aus dem Schlitten, indem immer noch Major Crampas verweilt.
Der Text ist aus der auktorialen Erzählperspektive geschrieben, also der Er-/Sie-Erzählperspektive, da der Erzähler die Gefühle Effis kennt „sie fürchtete sich“ (Z.27).
Im vorliegenden Textauszug werden Effi und Crampas und deren Beziehung zueinander ausführlicher beschrieben als Effis Beziehung zu Innstetten, der aber eigentlich als ihr Ehemann eine engere Beziehung haben sollte.
Die Schlittenfahrt wird im Textauszug an einigen exemplarischen Stellen, also der Situation im Wald, beschrieben. Man muss aber davon ausgehen, dass die Schlittenfahrt längere Zeit andauerte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Effi während der Schlittenfahrt mehr Geborgenheit von Crampas erfährt als von Innstetten insgesamt. Des Weiteren wird deutlich, dass Effi schnell dazu neigt, zu erschrecken oder Angst zu bekommen. In diesen Situationen gibt Crampas ihr den nötigen Halt, womit er seine Zuneigung ausdrückt.
Effi Briest Kapitel 24, S.181f.
Der Roman „Effi Briest“ von Theodor Fontane wurde 1894 in der Zeit des Poetischen Realismus verfasst und thematisiert den Drang, das gesellschaftliche Ansehen nicht zu verlieren bzw. dieses zu verbessern.
Effi von Briest heiratet den ehemaligen Geliebten der Mutter, Geert von Innstetten. Dieser reist aufgrund seines Amtes als Landrat viel umher und Effi ist oft allein. Auch mit ihrer Tochter fühlt sie sich weiterhin allein, weshalb sie die nötige Zuneigung von Major Crampas nimmt. Die Mutter weiß von der Einsamkeit Effis und diskutiert im vorliegenden Textauszug mit ihrem Mann über den Verlauf des Lebens Effis. Später werden sich Effi und Innstetten trennen und sie zieht zu ihren Eltern zurück.
Die Eltern von Effi bewohnen Hohen-Cremmen, wo sie zu einer Diskussion über die veränderte Lebensumstände Effis kommen. Bereits zu Anfang fragt Herr von Briest, wie seine Frau Effi finde (vgl. Z. 4). Für sie stellt sich kaum eine Veränderung ein, denn sie findet sie „[l]ieb und gut wie immer“ (Z. 5). Diese Aussage der Mutter Effis deutet darauf hin, dass, sofern sich eine Veränderung einstellen würde, sie diese ihrem Mann nicht präsentieren würde. Sie zerbricht sich sonst damit das Band, welches zwischen Mutter und Tochter existiert. Im Leben der von Briests stellt Gott eine wichtige Rolle dar. Die Eltern können Gott nicht genug dankbar für ihre wunderbare Tochter Effi sein (vgl. Z. 5f.). Allerdings freut sich die Tochter mehr über den Aufenthalt in Hohen-Cremmen, als über ihr Leben in Kessin (vgl. Z. 7f.). Dies beunruhigt den Vater und er drückt dies mit der Formulierung des Konjunktiv I aus. „Eigentlich ist es, als wäre dies hier immer noch ihre Heimstätte“ (Z. 10f.). Es scheint nur so, denn normalerweise wohnt Effi mit Innstetten und Annie in Kessin im landrätlichen Haus. Trotzdem fühlt sie sich zu Hause (im zu Hause ihrer Kindheit) wohler als in Kessin. In den Augen des Vaters hätte es Effi mit ihrem Mann und Kind nicht besser treffen können. Den Mann vergleicht er mit einem „Juwel“ (Z. 11f.) und das Kind bezeichnet er als „Engel“ (Z. 12). „Juwel[en] (ebd.) sind sehr wertvoll und an „Engel“ (ebd.) kommt man nicht heran, da sie über den Menschen stehen.
Herr von Briest findet Effi eine „prächtige Tochter“ (Z. 14), allerdings auch manchmal zu prächtig. Sie muss doch hin und wieder mehr an ihre Umwelt denken und sich nicht auf sich fokussieren. Dieses relativ wenige Beachten der Familie findet Herr von Briest „ungerecht gegen Innstetten“ (Z. 16). Dadurch kommt dem Vater der Gedanke, dass da etwas anderes sein könnte, weshalb er sein Frau auch direkt fragt „[o]der ist da doch irgendetwas im Wege?“ (Z. 20). Eine gewisse Vorahnung existiert im Vater bereits, was die Ehe Effis betrifft. Es kommt ihm vor als ob Effi Innstetten mehr achtet und schätzt als wirklich liebt (vgl. Z. 21). Das ist aber auch nicht gut, denn immer zu seinem Partner aufschauen, zerstört irgendwann den winzigen Bann, der besteht. „[E]rst ärgen sie sich, und dann langweilen sie sich, und zuletzt lachen sie“ (Z. 24f.). Diese Klimax zeigt, dass keine Beziehung auf Basis von Liebe mehr besteht, sondern dass aus der Ehe eine lockere Freundschaft wird. Herr von Briest richtet diese Äußerung sogleich an seine Frau und erwähnt kurz danach die „Schätzung“ (Z. 28), womit die gesellschaftliche „Schätzung“ (ebd.) gemeint ist. Das Ansehen spielt zur damaligen Zeit eine wichtige Rolle.
Über die Veränderungen durch Liebe oder Schätzung haben die Eltern Effis schon öfters geredet. Die Mutter behauptet, dass es aber nichts bringt, da der Vater die Art des „Alles-wissen-wollen“ (Z. 33) an den Tag legt, wobei er allerdings ziemlich „naiv“ (ebd.) vorgeht. Effis Mutter ist weder allwissend (vgl. Z. 34), noch „ein Orakel“ (Z. 36f.), sodass auch sie nicht alles weiß. Das „Orakel“ (ebd.) und auch der „Engel“ (Z. 12) sind etwas, an das der Mensch nicht rankommt. Diese beiden Phänomene stehen über dem Mensch. Nicht nur Effi hat ein inneres Geheimnis, auch die Mutter gibt die Wahrheit nicht „klipp und klar“ (Z. 38) dar (vgl. Z. 41). In ihren Worten spielt sie auf die Beziehung zu ihrem Mann an. Auch sie schätzt Herr von Briest für sein Ansehen und Vermögen und hat ihn eher weniger aus Liebe geheiratet. Effi ist „schlau“ (Z. 43) und weiß deshalb, dass dies zu vermeiden ist. Diese Schlauheit kann aber auch Probleme bereiten (vgl. S. 182 Z. 1), denn sie fürchtet und hält sich nicht besonders an Gott und die damit verbundenen zehn Gebote. Sie lässt Gott einen guten Mann sein (vgl. Z. 6) und lebt nicht nach ihm.
Im Dialog kann man viele hypotaktische Sätze finden. Besonders Frau von Briest benutzt diese, um nicht direkt auf den Punkt kommen zu müssen, sondern um geschickt um Themen herumzureden. Sie versucht damit ihre Unsicherheit zu kaschieren (vgl.Z.30ff.). Aufgrund dieser Ausschweifungen ist der Redeanteil von Frau von Briest höher (26 Zeilen) als der von Herrn von Briest (21 Zeilen). Er drückt sich viel deutlicher aus und bringt den eigentlichen Inhalt auf den Punkt. Des Weiteren ist auffällig, das Herr von Briest sehr viele Fragen an seine Frau stellt. ,,Wie findest du Effi?" (Z.4). Durch diese Fragen versucht er so viele Informationen wie möglich von seiner Frau zu erhalten. Der Dialog ist in der Zeitdeckung geschrieben. Es scheint, als könne der Leser Teil dieses Dialogs sein und aber nicht eingreifen. Er weiß nur, was er hört bzw. was er im vorherigen Geschehen des Buches herausgefunden hat.
Zusammenfassend wird deutlich, dass die Mutter bereits eine Vorahnung auf das Nachfolgende hat, woran sie sich mitschuldig fühlt, während der Vater immer noch seine glückliche Effi sieht. Dies wird durch Aussagen und Fragen der Beiden deutlich.
Figurenvergleich Marie - Effi
Zwischen der Figur Marie aus dem Drama „Woyzeck“ von Georg Büchner, veröffentlicht 1857, und Effi aus dem Roman „Effi Briest“ von Theodor Fontane, veröffentlicht 1898, bestehen Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten, die im Folgenden dargelegt werden.
Marie hat mit Woyzeck ein uneheliches Kind, was zur damaligen Zeit nicht gern gesehen war. Sie sind nicht verheiratet (vgl. Sz.2), weshalb sie unter anderem von der Nachbarin verspottet wird (vgl.Sz.2) Des Weiteren stammen sie und Woyzeck aus ärmlichen Verhältnissen. Um seine Familie ernähren zu können, muss Woyzeck neben seiner Arbeit als Soldat (vgl. Sz.5) auch noch seiner Arbeit als Teilnehmer eines Experiments des Doktors (vgl. Sz.8) nachgehen. Dabei hat er kaum Zeit für seine Familie. Als Marie mit dem Tambourmajor in Kontakt tritt, gefällt dieser ihr sofort, da dieser wohlhabender ist, als ihr eigener Freund (vgl. Sz.6). Sie nimmt von ihm Geschenke an und reagiert auf seine schmeichelnden Sprüche (vgl. Sz.6), obwohl sie weiß, dass eigentlich Woyzeck ihr Freund ist und nur für sie arbeitet. Ihr Wunsch nach Reichtum und Ansehen wird durch den Kontakt zum Tambourmajor gestillt. Später stirbt Marie, weil ihr Freund Rache übt und sie deshalb ermordet (vgl.Sz.20).
Effi ist im Gegensatz zu Marie mit Innstetten verheiratet (vgl. S. 15 Z. 2) und hat mit ihm ein eheliches Kind Annie (vgl. S. 97 Z. 31). Bereits vor ihrer Ehe stammt Effi aus einer reichen Familie, die in einem „Herrenhaus“ (S. 5 Z. 2) wohnt. Allerdings heiratet sie Innstetten nicht aus Liebe, sondern weil er der Geliebte ihrer Mutter war und ein hohes Ansehen genießt (vgl. S. 8 Z. 40), was zur damaligen Zeit eine wichtige Rolle spielt. Aufgrund dieses Ansehens und seinem Beruf ist Effi oft allein und sie sehnt sich nach Zuneigung, weshalb sie die Affäre zu Major Crampas eingeht. Dieser gibt ihr diese nötige Zuneigung. Innstetten hatte aus Rache Major Crampas ermordet, da dieser sich an seiner Frau vergangen hat. Dieser Tod rettet sein gesellschaftliches Ansehen, da er sich nur von seiner Frau getrennt hat, die wiederum dadurch ihr gesellschaftliches Ansehen verloren hat. Genau wie Marie, stirbt Effi später, allerdings wird sie nicht ermordet, sondern erkrankt stirbt in Folge dessen (S.249f.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Effi, als auch Marie, obwohl sie aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten stammen, beide eine Affäre eingehen, um ihre inneren Wünsche zu stillen, denn beide bekommen diese Wünsche von ihren Partnern nicht erfüllt. Beide Männer verbringen viel Zeit mit ihren Berufen und die beiden Frauen bleiben mit ihren Kindern allein zu Hause. Am Ende sterben jedoch beide Frauen.
24.Kapitel
Der Roman „Effi Briest“, welcher von Theodor Fontane 1894/95 in der Zeit des Poetischen Realismus verfasst wurde, thematisiert den Drang, das gesellschaftliche Ansehen nicht zu verlieren bzw. dieses zu verbessern.
Effi von Briest heiratet den ehemaligen Geliebten der Mutter, Landrat Geert von Innstetten. Dieser muss beruflich viel reisen, weshalb Effi oft alleine ist. Auch dieses Mal muss Innstetten reisen und zwar nach Berlin, um einen Kollegen zu vertreten. Effi verbringt die Zeit bei ihren Eltern in Hohen-Cremmen mit Tochter Annie und dem Kindermädchen Roswitha. Innstetten findet nach Beendigung seiner Reise zu Hause in Kessin die Briefe, die Effi ihrem Liebhaber Crampas geschrieben hatte, der ihr in dieser Zeit des Alleinseins nötige Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Innstetten trennt sich von Effi, woraufhin sie zu ihren Eltern zieht und dort auch verstirbt.
Der Textauszug aus Kapitel 24 lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen. Im ersten Abschnitt (Z. 1 – 11) wird das Zimmer Effis genau beschrieben. Bereits im ersten Satz wird deutlich, dass sich die Handlung in einem „Zimmer“ (Z. 1) abspielt. Dabei handelt es sich um das Zimmer, welches Effi bereits in Kindertagen bewohnte. Durch dieses „Zimmer“ (ebd.), welches metaphorisch für Einengung steht, wird die Lust Effis nach Abenteuer und Freiheit zurückgedrängt. Das „Zimmer“ (ebd.) hat einen Ausblick zum „Garten hinaus“ (Z. 2), sodass Effi auf den, von ihr geliebten, Teich und die geliebte Schaukel blicken kann. Diese beiden Orte symbolisieren Effis Drang nach Abenteuer und Freiheit. Mit dem ständigen Blick auf den Garten macht sich in Effi eine Unruhe breit, die durch die Antithese „ging sie auf und ab“ (Z. 3) deutlich wird. Um in die Einengung Freiheit und Abwechslung zu bringen, ist der untere Teil des Fensters geöffnet (vgl. Z. 3). Dadurch kommt Luft in den Raum zu der Effi schon als Kind eine Verbindung hatte, in dem sie in ihr geschaukelt ist. Das sorgte in ihr für ein Gefühl von Freiheit, die durch weitere Wörter der Windmetaphorik wie „Zuge“ (Z. 4), „Zugwind“ (Z. 5) und „frei“ (ebd.) ergänzt und bekräftigt wird. Des Weiteren ist am Zimmer Effis besonders, dass Kriegsszenen in Goldrahmen (vgl. Z. 7) an der Wand hängen. Dass Kriegsszenen golden eingerahmt werden, deutet darauf hin, wie wichtig das Militär zur damaligen Zeit war. Allerdings kann Effi diese Szenen nicht besonders leiden (vgl. Z. 10), da sowohl Crampas, als auch Innstetten für das Militär tätig sind und sie somit an diesem ihr wichtigen Ort immer an die beiden erinnert wird. Um ihre Abneigung zum Ausdruck zu bringen, „schüttelt […] [sie] den Kopf“ (Z. 9). Diese Aktion sticht aufgrund des parataktischen Satzbaus heraus, denn die beschreibenden Sätze sind hypotaktisch geschrieben (vgl. Z. 1 ff.). Die Aussage Effis „'Wenn ich wieder hier bin […]'“ (Z. 9) deutet auf zukünftige Besuche Effis bei ihren Eltern hin.
Im zweiten Abschnitt (Z. 11 – 20) wird der Garten näher beschrieben. Außerdem geht Effi auf das abrupte Ende ihre Kindheit ein. Effi schließt das eine Fenster (vgl. Z. 11) und lässt damit Teile der Vergangenheit hinter sich, welche sie unruhig machten. Im Anschluss setzt sie sich an das zweite geöffnete Fenster (vgl. Z. 11f.), was darauf hindeutet, dass sie ruhiger wird. Der anschließend folgende parataktische Satz „Wie tat ihr das alles so wohl“ (Z. 12) ist eine Anspielung auf Kessin. In Kessin kommt Effi nicht zur Ruhe. Obwohl sie in Hohen-Cremmen nicht mehr zu Hause ist, fühlt sie sich dort viel besser. Anhand dieses Satzes wird die Erzählperspektive des auktionalen Erzählers deutlich. Der Satz steht in der erlebten Rede, welche in der 3. Form steht. Effis Gedanken werden vom allwissenden Erzähler an den Leser transferiert. Im weiteren Verlauf wird die Sonnenuhr (vgl. Z. 13) beschrieben. Diese steht auf dem Rondell, auf welchem Effi später begraben wird. Auch die „Rhabarberstauden“ (Z. 16) stehen in der Nähe bzw. auf diesem Rondell. Dass die Blätter der Stauden „herbstlich gelb“ (Z. 16) verfärbt sind, weist auf ein Voranschreiten der Zeit hin. Effi verändert sich, denn auch ihre Kindheit gehört der Vergangenheit an. Dieses Vergehen der Zeit macht Effi nachdenklich. „[S]ie musste des Tages gedenken […], wo sie hier mit Hulda […] gespielt hatte“ (Z. 16 ff.). Auch in diesem Satz wird der Leser über die Gedanken Effis durch den auktiorialen Erzähler informiert. Effi erinnert sich an ihre Kindheit, in der sie viel Zeit mit ihren Freundinnen im Garten verbracht hat. Durch die Parenthese „nun erst wenig über zwei Jahre“ (Z. 17) wird die rasche Voranschreitung der Schritte im Leben Effis deutlich. Außerdem zeigt diese Parenthese, dass eine Zeitstraffung vorliegt. Dies wird auch nochmal deutlich, wenn sie die Treppe raufkommt, und eine Stunde später verlobt ist (vgl. Z. 19 f.). Innerhalb kurzer Zeit wurde Effi vom spielenden Kind zur verheirateten Frau, die in wenigen Tagen ihren zweiten Hochzeitstag feiert.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Effi aufgrund des Aufenthalts in Hohen-Cremmen und des bevorstehenden Hochzeitstages aufgewühlt ist. Die gewohnte Umgebung gibt ihr aber Halt.
Fricke
Der Sachtext „Zwischen Fremdbestimmung und Selbstbefreiung – Zur Deutung einer Emanzipation“ aus Heinrich von Kleist, unter Gerhard Fricke ,,Die Marquise von O…“, herausgegeben von W. Pütz, veröffentlicht zu einem unbekannten Zeitpunkt im Reclam Verlag als Kindle Version befasst sich mit der Handlung der Marquise von O…, die in der Religion die Kraft findet, sich und ihre Kinder zu retten.
Der Text lässt sich in sechs Abschnitte unterteilen.
Im ersten Abschnitt (Z. 1 – 11) wird die Situation der Marquise von O… beleuchtet. Dazu wird aus der Novelle zitiert. Durch ihre Schwangerschaft muss die Marquise sich „erstmalig heftig der Autorität ihres Vaters“ (Z. 5) widersetzen. Bereits mit den beiden Nomen, formuliert als Antithese, „Fremdbestimmung und Selbstbefreiung“ (Z. 1) wird die zwiespältige Situation der Marquise deutlich. Die Metapher ,,Tiefe“ (Z.10) steht für die Demütigung in der Realität. Die Eltern glauben der Marquise nicht, dass diese den Vater ihres Kindes nicht kennt.
Im nächsten Abschnitt (Z. 12 – 20) formuliert der Autor seine Hauptthese. Er deutet die Handlung der Marquise als „eine Rückbesinnung auf Gott“ (Z. 13f.). Einerseits ist sie unschuldig (vgl. Z. 15f.), da sie den Vater des Kindes wirklich nicht kennt und bei ihrer Rettung gutgläubig dachte, ihr wird nur geholfen. Andererseits ist „sie verloren“ (Z. 20), da sie eigentlich von ihren Eltern voll und ganz abhängig ist, in materieller und finanzieller Sicht. Außerdem noch, da die Realität zeigt, dass sie nicht unschuldig sein kann, da sie sichtbar schwanger ist.
Im dritten Abschnitt (Z. 21 – 30) beleuchtet Fricke noch einmal die problematische, aussichtslose Lage der Marquise und ihrer Kinder. Eigentlich ist es „das höchste Glück […], die Gewissheit, Mutter zu sein“ (Z. 21ff.). Allerdings ist es im Fall der Marquise nicht ganz unproblematisch. Durch diese Darstellung wird dem Leser die missliche Lage der Marquise nah gebracht. Jede „moralisch rettende Erklärung der Wirklichkeit liegt völlig außerhalb […] der Möglichkeit“ (Z. 26ff.). Die Marquise kann sich mit keiner Erklärung aus ihrer Lage befreien. Das normalerweise ,,höchste Glück“ (Z.21) wird der Marquise zum Verhängnis.
Im vierten Abschnitt (Z. 31 – 47) thematisiert der Autor seine detaillierte Deutung der Marquise und ihrer Reaktion in dieser Situation. Der Autor bezeichnet das, was die Eltern davon abhält der Marquise zu glauben, als einen „teuflischen Dämon[en]“ (Z. 32), der die Eltern, dargestellt mit den Nomen ,,Liebsten und Nächsten“ (Z. 32) im Superlativ, beeinflusst und davon abhält, das Richtige zu denken (vgl. Z. 32ff.). Durch diese Metapher wird deutlich, dass die Marquise keine Unterstützung von ihren Eltern erhält. Als der Marquise dies selbst bewusst wird, bricht „eine Kraft hervor“ (Z. 38), die sie mächtig macht, sich und ihre Kinder zu retten. Diese ,,Kraft“ (ebd.) wird vorher bereits angedeutet (vgl.Z.37). Sie kann sich nichts vorwerfen und vereint ihre Reinheit mit dem Glauben (vgl. Z. 42ff.), der sie dann von ihrer Familie abspaltet. Diese anfänglich aussichtslose Lage der Marquise sorgt nun für eine Rettung ihrer Kinder und ihr selbst, welche der Autor als verborgene Kräfte deutet.
Im vorletzten Abschnitt (Z. 49 – 68) charakterisiert der Autor das Verhalten der Marquise. Nach einer kurzen Einleitung erfolgt eine rhetorische Frage (vgl. Z. 52f.). Mit dem parallelen Satzanfang „Hier“ (Z. 54, 57) wird die Frage beantwortet. Die Marquise wird ebenso wie Kleist als ein „heroische[r] Mensch[…]“ Z. 50f.) bezeichnet. „[H]eroisch“ (ebd.), weil die Marquise etwas unternimmt, was Frauen zu dieser Zeit nicht gemacht haben. Frauen haben sich nicht der Autorität eines Mannes wiedersetzt. Die Marquise steht ihrem „Schicksal Auge in Auge gegenüber […]“ (Z. 59). Sie muss einen Weg finden, dieses zu verändern.
Im letzten Absatz (Z. 69 -78) werden die zuvor genannten Punkte noch einmal wiederholt und gefestigt. Der Autor beschreibt die Umänderung der Marquise als „Frömmigkeit“ (Z. 70) hinzu „heroische[r] Haltung“ (Z. 72), die durch ihre Umwandlung eine Rettung von sich und von ihren Kindern herbeiführt. Sie ist trotzdem bereit, sich dem Teufel zu unterwerfen, der ihre eigentlich netten Eltern zu einer schlechten Seite gekehrt hat (vgl. Z. 76f.)
Zusammenfassend beschreibt der Autor also die heldenhafte Handlung der Marquise, um den Leser von ihrer Sinneswandlung zu überzeugen. Dabei bezieht er sich sowohl auf den Originaltext, als auch auf eine Deutung von Gerhard Fricke.
Zwischen Fremdbestimmung und Selbstbefreiung
Der Text „Zur Darstellung der Vater-Tochter-Beziehung“ von Wolfgang Pütz verfasst über die Texte „Der Fall der Frau Marquise. Beobachtungen zu Kleists << Die Marquise von O…<<“ von Heinz Politzer, veröffentlicht in „Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 51“ handelt von der Deutung der liebesähnlichen Beziehung zwischen Vater und Tochter.
Der Text lässt sich in vier Abschnitte unterteilen. Im ersten Abschnitt (Z. 1-13) erläutert Wolfgang Pütz die Meinung Heinz Politzers zur Darstellung der Beziehung zwischen der Marquise und ihrem Vater. Es liege nicht nur eine elterliche Beziehung vor, sondern „eine[…] inzestuöse[…] Beziehung“ (Z. 3). Der Vater sehe in der Tochter also mehr als nur seine Tochter. Diese neuartige, vorbildlose Erscheinung (vgl. Z. 6f.) komme durch die „sprachlich unerhörte Erzählung“ (Z. 4) zum Ausdruck. Nicht nur die Beschreibung bzw. Nennung eines solchen Ereignisses ist also „unerhört“ (Z. 3, 4), sondern auch die sprachliche Beschreibung bzw. Gestaltung der Erzählung ist fehlerhaft. Durch die Handlung der Marquise gerate der Dichter ins Stocken, weshalb jene ihn vor einem Ziehen ins Lächerliche bewahre (vgl. Z.7). Die Hingerissenheit des Vaters zur Tochter wird auch deutlich, wenn der Autor ,,den Dativ mit dem Akkusativ“ (Z. 12f.) ersetzt. Die Besonderheit der Situation wird durch eine gezielte Verwendung eines anderen Kasus deutlich gemacht.
Im zweiten Absatz (Z. 13-28) befasst sich Wolfgang Pütz mit der Verschweigung bzw. Umschreibung einer Umarmung in einem Gedankenstrich. Anschließend beschreibt er, dass der Vater die Tochter sogar küsst (vgl. Z.21ff.). Diese Reihenfolge erscheint paradox, da eine Umarmung weniger dramatisch ist, als seine eigene Tochter zu küssen. Durch diese Dramatik wird dem Leser die Realität gezeigt. Mit diesem Text bestätige sich die Bezeichnung Kleists als „ , großen Manieristen´“ (Z. 16) mit dem Ludwig Tieck in betitelt hatte. Es sei „bezeichnend, dass [Kleist] […] die Umarmung […] in einem Gedankenstrich verschweigt“ (Z. 19ff.) Des Weitern sei in der Szene eine „Vereinigung des Vaters mit der Tochter“ (Z. 21f.). Diese „Vereinigung“ (ebd.) kann man sowohl körperlich, als auch räumlich sehen. Körperlich, da die Marquise auf dem Schoß ihres Vaters sitzt und räumlich, da sie aufgrund der Verzeihung mit ihren Kindern wieder zurück zu den Eltern zieht. Den Gedankenstrich betitelt Pütz hierbei als „Zensur“ (Z. 24). Die Verhaltensweisen werden dazu mit einer Personifikation benannt. Die Gefühlslage des Vaters „bricht hier mit nackter Leidenschaftlichkeit aus“ (Z. 24f.). Diese metaphorische „Leidenschaft“ (ebd.) werde aber als Normalität gezeigt, „als wäre sie standesgemäß und gesellschaftsfähig“ (Z. 28). Diese Beschreibung steht im Konjunktiv II, wodurch die Irrealität deutlich wird. Es kann nicht Normalität sein, dass ein Vater eine Liebesbeziehung dieser Art zu seiner Tochter führt. Es wird aber beschrieben, als wäre es Normalität.
Der dritte Abschnitt (Z. 29-35) befasst sich mit der Marquise und ihren Gefühlen in der Lage. Auch die Marquise fühlt sich „in den Armen des Vaters“ (Z. 29f.) wohl, denn sie bekomme, was sie normalerweise nicht bekommen könne. „Hingabe, Bewusstsein und Genuss“ (Z. 31) seien die Gefühle, die die Marquise in dieser Szene beflügeln. Ihr Mann war bereits gestorben und somit gab es Situationen wie diese nicht mehr. Diese Gefühle oder auch Verlangen sorgen dafür, dass die Marquise als Frau erkannt werde (vgl. Z. 32). Durch die Offenbarung ihrer Gefühle sorgt die Marquise eigentlich für die „ ,Versöhnung' “ (Z. 33) zwischen ihrem Vater und sich. Diese „ ,Versöhnung' “ (ebd.) gibt die weitere Richtung in ihrem Leben an. Sie ist schwanger, was zunächst auf wenig Begeisterung trifft (vgl. Z. 34), und sorgt nun aber für eine Lösung ihrer Situation (vgl. Z. 35). Die eigentliche Abhängigkeit zu den Eltern tritt nun wieder in Kraft.
Im letzten Abschnitt (Z. 36-45) thematisiert Pütz das Verhalten des Vaters genau. Er ist der autoritäre Vater (vgl. Z. 39), der den Mann, der seine Tochter geschwängert hat, nun ausgespielt hat, da die Tochter auch zu ihm ihre Gefühle zeigt. So kann er auch weiterhin bestehen, als der Graf auftaucht und sich als Vater des Ungeborenen entpuppt (vgl. Z. 40ff.).
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Vater eine sehr enge Beziehung zur Tochter aufbaut, damit diese ihn auch nach dem Auftauchen des Vaters ihres Kindes nicht verlässt. Er demonstriert mit dieser Szene seine Macht.
Feedback: 1. Mehr als nur seine Tochter? Als was sieht er sie genau? 2. Wer ist der Dichter? Und warum gerät er ins stocken? Was wird eigentlich damit ausgesagt?
Berichtigung
W-Fehler:
Der Sachtext ,,Aufklärung und Gesellschaftskritik“, herausgegeben von Wolfgang Pütz 2013 als Kindle-Version, bezieht sich auf die Novelle ,,Die Marquise von O…“ von Heinrich von Kleist, welche 1808 veröffentlicht wurde.
Z-Fehler:
Ganz besonders auf der inhaltlichen Ebene zeigt Kleist verschiedene Unmöglichkeiten, aber eigentlich Merkwürdigkeiten auf.
Die Tochter muss sich außerdem, genau wie die Mutter, dem Vater unterordnen.
Auch die Mutter, die die Versöhnungsszene beobachtet, verhält sich, Pütz Meinung nach, fragwürdig.
Die Betitelung des Werks als ,,Generalangriff auf die Konvention“ (Z.10), wobei Generalangriff metaphorisch den Inhalt der ,,Marquise von O…“ mit den Darstellungen impliziert.
In Addition zum Handeln des Königs von Preußen wurden ,,in Berlin die drei bedeutensten Aufklärungszeitschriften“ (Z.21) herausgegeben.
Diese Möglichkeit bekräftigt die zuvor Genannten Worte, Kleist sein mit seinen Worten ,,Erbe der Aufklärung“(Z.11).
Es ist fragwürdig, ob ein Vater eine solche Liebesbeziehung zu seiner Tochter führen muss.
Des Weiteren finde ich fragwürdig, dass er den Brief, worin er den Rausschmiss der Familie seiner Tochter nicht selber schreibt, sondern diktiert (vgl.Z.399).
Dies wird mit den Worten und ihrer Handlung ,,Mein teuerster Vater!“(Z:637), wonach sie die Arme nach ihm ausstreckt(vgl.Z.638), deutlich.
Gr-Fehler:
Unterschwellig zeige Kleist, was ihm am damaligen System nicht passe und worin er die Notwendigkeit sehe, etwas zu ändern.
Diese Grundlagen seien veraltet und müssten sich aufgrund kritischer Texte wie Kleists auf eine Abschaffung oder zumindest Erneuerung vorbereiten.
Mit dem Militär ist gemeint, das auch dieses nicht fehler- und folgenlos handelt.
Solche Vorstellungen würden nur ,, ,unreflektierten Gewohnheiten oder vordergründigen Interessen entspringen‘“(Z.26f.).
Erst als dieser sie seines Hauses verweist, kommt ihr der Gedanke bzw. durchfährt sie etwas, dass ihre Situation ändert (vgl.Z.410ff.).
Zit-Fehler:
Die ,,Wertungen, Vorstellungen und Haltungen bestimm[en] das innere Geschehen“ (Z.6f.).
Das Hauptaugenmerk liege schon länger auf der ,,Kritik an Vorurteilen, insbesondere [der] Kritik an vorteilshaft fixierten Autoritäten“ (Z.24f.).
,,Die kritische Subversion konventioneller Wertungen, Vorstellungen und Handlungen bestimm[e] das innere Geschehen“(Z.6f.).
R-Fehler:
Er verdeutlicht, was ihm am bisherigen System nicht passt, indem er es in dieser Novelle zum Ausdruck bringt.
A-Fehler:
Weil Menschen ihr Handeln nicht überdenken und andere Interessen haben, kopieren sie die Handlungsweisen, die ihnen vorgelebt werden.
Sb-Fehler:
Das ,,Beispiel der Marquise selbst gegen Unmündigkeit“(Z.9f.) ist für mich auch nachvollziehbar.
Religion,Q1
Feuerbach
Die These Feuerbachs wird auch Projektionstheorie genannt, da Feuerbach der Auffassung ist, der Mensch projiziert alles Gute, all seine Wünsche mit Hilfe von Fantasie auf Gott. Der Mensch sucht sich ein Wesen, welchem er sich gegenüber stellen kann. Er verbindet alle guten Eigenschaften, alle gegensätzlichen Eigenschaften mit diesem Wesen, welches er Gott nennt. Gott ist das genaue Gegenteil des Menschen. Der Mensch kommt nicht an Gott heran, denn er schreibt ihm all die Aspekte und Eigenschaften zu, die er selber nicht erreichen kann oder die sein großes Ziel sind. Der Mensch schreibt Gott Vollkommenheit zu, da er seiner Meinung nach selbst Vollkommenheit nicht erreichen kann. Er braucht etwas Vollkommenes, an dem er sich festhalten kann. Der Mensch schreibt Gott auch aus diesem Grund Seligkeit zu, denn er selbst möchte selig sein, kann diese Seligkeit aber nicht erreichen. Gott ist die Bündelung aller Wünsche des Menschen. Diese Bündelung kann man auch „projizieren“ nennen, weshalb die Theorie Feuerbachs „Projektionstheorie“ heißt. Alle Wünsche, zusammen mit der Fantasie, des Menschen werden gebündelt und sind zusammen als Projektion Gott. Dabei hat jeder Mensch eine andere Vorstellung von Gott, da jeder andere Wünsche und andere Wege zu seinem Glück hat.
Freud
Sigmund Freud (1856-1939) ist davon überzeugt, dass die Religion eine Illusion ist.
Es liegt in der Natur des Menschen, dass man nach jemandem sucht, der einen beschützt. Schutz und Geborgenheit werden an die Religion abgegeben Kinder werden von ihren Eltern beschützt und geliebt. Wenn sie älter werden, wir dieses Bedürfnis nach Schutz und Liebe an die Religion weitergegeben. Diese schafft Antworten auf unerklärliche Fragen und Rätsel, die den Wissensdurst der Menschen stillt. Dadurch werden Beziehungen zwischen Körperlichem und Seelischem entwickelt oder verstärkt. Dieser Aufbau von dieser Beziehung und das Wissen, dass jemand oder etwas da ist, was einen beschützt, sorgt dafür, dass der Mensch sich selber beruhigt. Eine schwere innere Last fällt ab. Desweiteren ist Sigmund Freud aber auch davon überzeugt, dass religiöse Lehren nicht nachweisbar oder wiederlegbar sind. Den Menschen, die daran glauben, kann man keine Vorwürfe machen. Gegensätzlich sollte man aber auch die Menschen nicht kritisieren, die nicht daran glauben.
Religion soll also das Gefühl von Geborgenheit oder Liebe vermitteln. Gleichzeitig soll man selber sich aber auch eine Meinung darüber bilden, was man glauben möchte und was nicht und andere für ihre Meinungen respektieren.
Religionskritik
Religion ist etwas, womit Menschen sich beruhigen. „Es ist jemand da, der mir in schweren Zeiten zur Seite steht“ denken viele Menschen. Gott ist niemand, der Probleme beheben kann. Der Glaube alleine gibt Kraft. Man kann aber auch ohne Religion schwere Zeiten durchstehen. Gott existiert nicht alleine durch den Glauben, er existiert durch Liebe. Menschen leben friedlich und liebevoll gemeinsam. Durch die Liebe zum Nächsten entsteht auch eine Verbindung zu Gott. Gott spiegelt Stimmungen, Gefühle und Wünsche der Menschen in den jeweiligen Momenten wieder. Durch Verhaltensweisen kann man Verbindungen zu Gott aufbauen ohne dass man direkt zu ihm betet oder ihn anspricht.
Lukasevangelium 15,11-32
Der Bibelauszug aus dem Lukasevangelium 15,11-32 verdeutlicht am Beispiel eines Vaters mit seinen zwei Söhnen Gottes Handeln im Bezug auf die Menschen.
Der Vater dieses Gleichnisses stellt Gott dar. Seine beiden Söhne stehen stellvertretend für den Teil der gläubigen Menschen (der ältere Sohn) und für den Teil der Menschheit, die sich auch schon mal von Gott abgewendet hat (der jüngere Sohn).
So wie der Vater Vertrauen in seinen jüngeren Sohn hat, als er ihn um seinen Erbteil bittet (vgl.V.12), so hat Gott Vertrauen in die Menschen. Er zwingt die Menschen nicht an ihn zu glauben. Sie sollen für sich entscheiden, was das Beste ist und womit sie glücklich werden. Dennoch sorgt er dafür, dass es den Menschen gut geht. Dies wird daran deutlich, dass die ,,Tagelöhner […] des Vaters […] mehr als genug zu essen“ (V.17) haben. Sofern die Menschen an Gott glauben, so wird es ihnen gut gehen. Gott ist also in der Hinsicht gerecht, dass er auf ihre Gebete mit ausreichend Liebe antwortet. Der Vater, also Gott, empfängt jeden, der zu ihm kommt, mit offenen Armen. Er erwartet auch die wieder, die sich vor einiger Zeit von ihm abgewendet haben. Er verzeiht Sünden und liebt bedenkenlos, denn obwohl der jüngere Sohn die Hälfte seines Vermögens durch seine verschwenderische Zeit verloren hat, nimmt der Vater ihn wieder zurück. Er errichtet für ihn sogar ein großes Fest mit ,,Mastkalb“ (V.23) und dem ,,besten[n] Gewand“ (V.22). Gott freut sich noch mehr über die, die zurückkommen, da sie merken, dass Gott mit seiner Liebe doch gut für sie ist, als über die, die die ganze Zeit etwas anbeten, ohne sich darüber eine eigenen Meinung zu bilden. Dadurch wird wieder deutlich, dass Gott die Menschen nicht zwingt, an ihn zu glauben. Er freut sich jedoch umso mehr, wenn Menschen über ihr Handeln nachdenken und dadurch zu Gott finden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gott Vertrauen in die Menschen und ihr Handeln hat. Er liebt die Menschen und verzeiht ihnen ihre Sünden. Er lässt Menschen frei entscheiden, ob sie glauben wollen und lässt sie ziehen, wenn sie sich gegen den Glauben entschieden haben.
Aufgabe gestellt
1.Der Text „Gott führt uns durch Leid zum Heil“ vom Katholischen Katechismus der Bistümer Deutschlands aus dem Patmos 1955 thematisiert die Rolle des Leids.
Leid hat eine Aufgabe. Wenn Gott den Menschen Leid zufügt bzw. sie Leid erfahren lässt, hat das immer einen positiven Hintergedanken. Leid kann auch eine Art Prüfung sein, die den Menschen testen soll, inwieweit sie Leid ertragen können. Die Menschen können Gottes Absicht nicht nachvollziehen. Auch Christus hat Leid erfahren und der Mensch kommt ihm durch Leid näher.
2.Meiner Meinung nach sind die Aussagen des Textes von Zeile 9 bis 19 nur teilweise nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar, dass Leid die Menschen erfasst, um diese vom Bösen zu schützen. Nur die Frage ist, was als „böse“ definiert / bezeichnet wird. Wenn jede Tat des Menschen, die Gott nicht gefällt, mit Leid bestraft wird, warum entstehen dann Kriege, welche nichts Gutes in sich tragen? Müssen die Kriegführenden dann nicht mit Leid besprochen werden? Tatsache ist, wenn Gott Leid steuern kann, muss er aktiv in das Leben auf der Erde eingreifen können. Gott reinigt uns von Fehlern und Unvollkommenheit durch Krankheit, Armut und anderem Mühsal. Ich denke, durch Armut haben die Menschen keine Möglichkeit mehr, mit Geld Fehler zu begehen. Dafür müssen sie sich andere Möglichkeiten suchen, um irgendwie überleben zu können. Dadurch begehen sie möglicherweise aber wieder Fehler, sind also nicht rein von Fehlern. Nur die alten wurden bereinigt. Des Weiteren finde ich, dass Menschen durch Krankheit nicht von Fehlern und Unvollkommenheit bereinigt werden können. Erkranken Menschen tödlich, sind sie zwar von Fehlern bereinigt. Aber was bringt ihnen diese Entlastung, wenn sie sterben? Dann müsste man davon ausgehen, dass die Menschen ihre Reinheit nach dem Tod weiter benötigen. Den für mich am besten nachvollziehbarsten Punkt bildet die Aussage: „Gott lässt das Leid auch dazu über uns kommen, dass wir uns im Guten bewähren“ (Z.16f.). Leid sorgt dafür, dass die Menschen über ihre Vergangenheit nachdenken und über das, was ihnen am liebsten ist, weil sie verstehen wollen, warum sie Leid erfahren müssen. Dieses Nachdenken ändert ihre Sicht und entweder bestehen sie die Prüfung, indem sie weiterhin an Gott glauben oder sie fallen durch, da sie sich abwenden.
Zusammenfassend finde ich, dass die Aussagen des Textes nur dann zutreffend sind, wenn man davon ausgeht, dass Gott das Geschehen auf der Erde aktiv beeinflusst und darin eingreifen kann.
Gottesbild Veränderung
Nach dieser Unterrichtsreihe hat sich mein Gottesbild nicht wirklich verändert. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Gott nicht aktiv in das Handeln auf der Erde eingreifen kann. Gott bestraft die Menschen nicht für ihre Sünden oder fügt ihnen Leid zu, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Diese Gottesbilder sind für mich wenig plausibel.
Schmidt
ausgezeichnetes Buch reißt alte Wunden (durch Feuerbach) wieder auf
• Theologie zur Anthropologie radikal, neuzeitlicher Weg -> Veränderungen
• Feuerbach nicht gewusst, dass komplexes Gehirn aus religiösen Erfahrungen entstanden -Religion, die in allen Entwicklungsstufen begleitet und Wünsche/Vorstellungen erfüllt
• Potenzial des Urphänomens wird ausgeschöpft durch neue Denkanstöße
• Weiterentwicklung möglich, ohne Nachweise zu schaffen
• Evolution gab Sprache -Sprache eröffnet Möglichkeiten
• Sprache ist auch ohne Begriffe möglich
• man kann durch Sprache auch Gottesbilder transportieren oder wandeln
• mit Weiterentwicklung des Menschen auch Weiterentwicklung der Religion, also Gottesbilder, Sprache, Symbole
• Vorstellungen der Menschen schon in Gott, Gott aber auch mehr als das, ein Weiterdenken ist auch möglich
• möglicherweise ist Gott auch ganz anders – keine Projektion, dann lediglich nur ausschließen, was Gott nicht ist, möglich
• mehrere Möglichkeiten miteinander verknüpfen möglich
Historische Daten zu Jesu
(1) Aufgrund des zur Geburt Jesu herrschenden Königs Herodes (tot 4 v.Chr.), muss Jesus bereits zwischen 8 v.Chr. und 4 v.Chr. geboren sein. Er verkörpert den Messias. Zum Geburtsort ist man zu keinem klaren Entschluss gekommen. Er war Jude.
(2) Jesu Mutter Maria war verlobt mit Josef (Zimmermann und Bauhandwerker). Seine Kindheit verbrachte Jesus in Galiläa und seine Mutter war Zeugin seines späteren Handelns.
(3) Jesus ließ sich von Johannes taufen, vertrat jedoch ein weicheres, liebevolleres Gottesbild und verbreitete dieses auch.
(4) Er zog als Wanderprediger durch das Land und verbreitete seine Gottesbotschaft. Die Begleitung von Erscheinungen wie Heilungen unterstützten ihn bei seinen Predigten. Er vergab Sünden und achtete alle Menschen. Auf diese Art und Weise fand er viele Freunde.
(5) Das Gericht Gottes sollte allerdings alle treffen, die sich seinem Gottesbild nicht anschließen wollten.
(6) Er sammelte Jünger um sich, aber im inneren Kreis waren mehr als die erwarteten zwölf.
(7) Sein Auftreten brachte auch Streit mit sich, denn es gab auch komplett gegenteilig Gläubige.
(8) 30 n.Chr. feierte Jesus in Jerusalem Pesachfest, allerdings kann man die genauen Worte nicht mehr nennen.
(9) Kurze Zeit später fand die Auslieferung und die erniedrigende Kreuzigung statt.
(10) Nach dem Tod verbreiteten die Jünger die Nachricht von der Gegenwärtigkeit Jesu an die der heutige Glaube anknüpft.
4 Evangelien
Vom Evangelium Jesu zu den vier Evangelien
(1) Das Evangelium wurde von Jesus nicht schriftlich hinterlassen. Auch die Jünger hatten nicht den Auftrag Jesu Worte zu verschriftlichen. Die Worte hatten sich in ihre Köpfe gesetzt.
(2) Die Jünger haben dann nach seinem Tod das Evangelium verkündet und begonnen, dieses festzuhalten. So entstanden kleine Geschichten über Abschnitte des Leben Jesu.
(3) Die älteste Überlieferung entstand zwischen 70 und 100 n.Chr.. Die vier Evangelisten haben die Geschichten gemeinsam geordnet und zusammengestellt. Nachdem Markus seine Texte "Evangelium" genannt hatte, nannten auch die anderen Evangelisten ihre Texte so.
Nicht Biographie, sondern Glaubenszeugnis
Das Informieren der Nachwelt war für die Evangelisten nicht das Wichtigste. Sie waren Zeugen des Glaubens und gaben keine 100 prozentigen historischen Daten. Ihre Absichten waren es die Worte Jesu zu präsentieren und zu verbreiten. Dabei steckten sie nur einen historischen Rahmen.
Grüne Box
Jesus von Nazaret bildet die zentrale Figur des Christentums. Obwohl Jesus die zentrale Rolle bildet, kann man kaum historische Fakten festlegen, denn die Evangelien sind Glaubenszeugnisse geschichtlicher Erzählungen. Die Schwerpunkte liegen unterschiedlich: Markus: Gottessohn, Matthäus: Messias, Lukas: guter Heiland, Johannes: Sohn des Vaters
Parallelen Antithesen
Die Antithesen widerlegen die zuvor genannten Gebote bzw. religiösen Regeln. Jesus stellt neue Handlungsweisen und Regeln auf, an die sich die Menschen halten sollen. Dies wird durch Imperative wie ,,soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen“ (Mt 5,22) deutlich. Diese neuen Handlungsweisen erweitern die vorherigen Regeln des Zusammenlebens. Auch in der Rede Jesu vom Reich Gottes verwendet er Imperative (vgl. Mk 1,14). Er fordert die Menschen auf, sich auf das Reich Gottes vorzubereiten, da dieses nahe sei (ebd.). Die Antithesen bestehen zunächst immer aus einem Einleitungssatz mit direkter Anrede ,,Ihr habt gehört“ (Mt 5,38), dann aus einem Thorazitat (vgl. Mt 5,21), worauf die Worte ,,Ich aber sage euch“ (Mt 5,44) folgen. Letztendlich stellt er einen neuen Lehrsatz auf, der den vorherigen erweitert. Im Gegensatz dazu kann man in der Rede Jesu vom Reich Gottes keine so deutliche Struktur erkennen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Jesus in beiden Texten die Menschen bzw. das Volk direkt anredet um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen.
Mt 20,1-15
2.2 Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-15) wird Jesu Gottesbild deutlich. Gott, für den in diesem Gleichnis metaphorisch der Gutsbesitzer steht, behandelt alle Menschen, in diesem Fall Arbeiter, gleich (vgl.V.10). Es ist ihm egal, was sie getan haben oder wie viel sie arbeiten, er stellt sie gleich. Gott wird von den Menschen gleichzeitig aber auch als ungerecht empfunden. Sie denken, „mehr zu bekommen“ (V.10), da sie mehr bzw. länger gearbeitet haben. Dabei bedenken sie nicht, dass sie zuvor einen Lohn vereinbart hatten. Gott steht demnach zu seinen Vereinbarungen, da er den Arbeitern „einen Denar für den Tag“(V.2) gibt.
2.3 Anhand dieses Gleichnisses kann man erkennen, dass Gleichnisse sehr bildhaft dargestellt werden. Die handelnden Personen symbolisieren jemand anders. So steht der Gutbesitzer hier für Gott, die Arbeiter für die Gläubigen. Des Weiteren kommt auch in diesem Gleichnis zuerst eine scheinbare Ungerechtigkeit vor. Bei näherem Betrachten fällt allerdings auf, dass wenn man die Ungerechtigkeit auf Gott bezieht, diese keine Ungerechtigkeit mehr zu sein scheint. Die Arbeiter, die schon länger arbeiten, bekommen den selben Lohn wie die Arbeiter, die erst zur letzten Stunde angeworben wurden. Dies scheint ungerecht, da längere Arbeit theoretisch höher bezahlt werden müsste. Allerdings muss man dann bedenken, dass die Menschen des Morgens einen Lohn festgelegt hatten und die Arbeiter der letzten Stunde, ohne zu wissen, was sie bekommen würden, gearbeitet haben. Ihnen war der Lohn weniger wichtig als die Arbeit an sich.
2.4 Jesus hat seine Botschaften in Gleichnissen erzählt, damit die Menschen sich die Situationen und Inhalte besser vorstellen können. In diesem Gleichnis kann der Leser sich mit den Arbeitern identifizieren. Viele Menschen haben schon mal eine solche anscheinende Ungerechtigkeit erlebt. Sie gehen davon aus, ungerecht behandelt zu werden und versetzen sich dabei nicht in Andere, da sie nur an sich und die Ungerechtigkeit denken können. Der Leser soll darauf hingewiesen werden wie solche Situationen ablaufen. Er soll dafür sensibilisiert werden, in Zukunft in diesen Situationen auch an die Anderen zu denken. Jesus versucht durch seine Botschaften, formuliert als Gleichnisse, die Menschen auf ein besseres Miteinander hinzuweisen, denn nur dadurch kann man Gott näher kommen.
Gleichnis im Modernen
Ein Junge nahm an einem Zukunftstag in der Schule teil. Dort stellten alle Schüler ihre Zukunftspläne vor. Der Junge wollte Astronaut werden. Die Klasse lachte über diese komische Vorstellung und war der Meinung, so eine Person könne man als Astronaut nicht brauchen. Auch die Lehrerin belächelte ihn, sagte aber nichts. Traurig ging der Junge nach Hause, traf auf dem Rückweg einen älteren Jungen und erzählte diesem von seiner Zukunftsvorstellung. Der andere Junge lachte ihn nur aus. Zu Hause sprach ihn seine Schwester auf seine Zukunftspläne an. Sie lachte auch, als ihr Bruder ihr tatsächlich von seinem Traum erzählte. Traurig lief der Junge in den Park, wo eine ältere Dame auf ihn aufmerksam wurde. Sie kamen ins Gespräch und diese Dame war die Erste, die ihm Mut machte. Diese Begegnung hatte in dem Jungen etwas ausgelöst, was in innerlich wandelte. Er verbesserte seine Schulnoten und gewann an Selbstvertrauen. Einige Jahre später konnte der Junge tatsächlich seinen Traum verwirklichen.
Unterschiedliche Worte Jesu
Ich erkläre mir die unterschiedlichen Worte dadurch, dass die unterschiedlichen Evangelisten die selbe Vorlage durch das Evangelium von Markus hatten, aber doch andere Hauptaugenmerke legen wollten, um ihren Text anders zu gestalten. Markus hat Jesu letzte Worte aus Psalm 22 abgeschrieben. Matthäus hatte Markus Text als Vorlage, wollte aber seine Interpretationen und den Fokus eher auf diese Angreifbarkeit der Religion legen, nachdem Jesus gestorben war. Lukas Formulierung unterscheidet sich komplett von denen der vorherigen Evangelisten. Seine Interpretation der letzten Worte ist nicht die Frage, ob Gott Jesu verlassen habe (vgl. Mk 15,34), sondern das Jesu Gott das volle Vertrauen schenkt (vgl. Lk 23,46). Ich denke durch diese komplett andere Interpretation wollte Lukas seine Sicht auf Jesu verdeutlichen. Zudem hat er dadurch etwas, was sein Evangelium von den anderen abhebt. Im Evangelium des Johannes richtet Jesu seine letzten Worte nicht an Gott, sondern an seine Mutter (vgl. Joh 19,26). Hinzu kommt noch, dass jeder Worte und Erzählungen anders interpretiert und somit anders formuliert.
Heaven nicht sky
Der Text „Heaven – nicht sky“ von Hans Kessler aus „Christ in der Gegenwart“, veröffentlicht in der Ausgabe 16 2006 befasst sich mit der symbolischen Bedeutung des Himmels.
Der Text lässt sich in drei Abschnitte unterteilen. Der erste Absatz (Z.1-13) bildet die Einleitung in die Thematik: Ostern und die Auferstehung Jesu. Zur Einleitung dieses Absatzes benutzt Kessler eine Frage (vgl. Z. 1.f). Im darauffolgenden Absatz erläutert er, was die zuvor angesprochenen „Ostertexte“ (Z. 2) verdeutlichen bzw. behaupten. Allerdings sei das Nomen „Auferstehung“ (Z. 10) nur die begrenzte Bedeutung für das, was Jesus wirklich wiederfahren ist. Die Texte seien nicht wörtlich zu verstehen.
Der zweite Absatz (Z. 14-35) beschäftigt sich damit, wie man die Auferstehung wirklich zu verstehen hat. Es beginnt mit einer Erklärung bzw. Definition was ist, und was nicht. Nicht die „Wiederbelebung der Leiche“ (Z. 14) stehe im Zentrum. Jesus wird nicht zurück zu menschlichen Gestalt werden, denn das bedeutet, dass Jesus erneut sterben kann. Es steht die neue „Dimension der Wirklichkeit“ (Z. 19) im Fokus. Etwas zuvor nicht Bekanntes steht nun im Fokus der Persönlichkeit Jesu.
Im letzten Absatz (Z.36-50) beleuchtet Kessler den Punkt der Überzeugung von Juden und Christen. Sie denken, dass immer Jemand da ist. Dieser Jemand begleitet sie.
Zusammenfassend behandelt der Text also den Begriff der Auferstehung Jesu, welcher nicht wörtlich zu verstehen ist und die Rückkehr Jesu als nicht menschliche Gestalt und dessen Nichtgreifbarkeit.
Johannesevangelium 20,24-29
Aus dem Ausschnitt aus dem Johannesevangelium 20,24-29 kann man schließen, dass durch Glauben und Vertrauen immer eine Verbindung zu Gott besteht. Für und aufgrund dieses Vertrauens brauchen die Menschen keine Beweise dafür, dass es Gott wirklich gibt. Auch die Menschen, die nach der Zeit Jesu leben, können so an Gott glauben und ihm vertrauen.
Aufgabe gestellt
1.Die Jünger aus dem Ausschnitt des Lukas Evangelium (Lk 24,13-35: Die Begegnung mit dem Auferstandenem auf dem Weg nach Emmaus) brauchen erst ein Jesus typisches Handeln, in diesem Fall das Teilen des Brotes, ehe sie verstehen, dass Jesus der Messias bei ihnen ist und nicht von den Hohenpriestern und Führern hingerichtet wurde. Obwohl sie zuvor ein Brennen in der Brust verspürten, was metaphorisch für die Verbindung steht, haben sie nicht erkannt, dass Jesus bereits unter ihnen weilt und ihnen Beistand leistet. Dabei ist allerdings wichtig, dass Jesus nicht als Mensch anwesend ist, obwohl dies beschrieben wird. Die Auferstehung Jesu ist nicht wörtlich zu verstehen, sodass dieser nicht als Mensch auf die Erde zurück gekehrt ist.
2. Das Bild von Brooks-Gerloff ,,Unterwegs nach Emmaus“ ,1992 veröffentlicht, zeigt drei Personen, wovon eine nur schemenhaft dargestellt ist. Die drei Personen gehen durch diese Wüste. Die linke Person trägt ein dunkel braunes Gewand. Dieses ist am Nacken dunkler als an seinen Beinen, wo dies in ein hellbraun über geht. Der Kopf ist nach unten geneigt. Die Person hat braune Haare. Die Arme sind nach vorne gebeugt. Der Mann trägt keine Schuhe und seine Füße sind in der Bewegung des Gehens gezeigt. Der mittlere Mann trägt ein langes, braunes Gewand und eine helle, beige/weiße Hose. Auch dieser Mann trägt keine Schuhe. Seine nackten Füße sieht man ebenfalls in der Gehbewegung gezeigt. Die linke Fußsohle ist für den Betrachter sichtbar. Der Kopf dieser Person ist leicht nach vorne geneigt und sie hat ebenfalls braune Haare. Von der rechten Person kann man nur Umrisse erkennen. Man kann durch diese Person hindurch sehen. Der Kopf ist leicht gebeugt und die Arme zeigen nach vorne. Auch diese Person ist beim Gehen dargestellt. Der Hintergrund des Bildes ist eine Wüste. Die Wüste ist orange-gelb. Links kann Felsen erkennen. Und auch am Horizont erkennt man Felsen. Am rechten Bildrand ist die Wüste hell, fast weiß. Sie mündet in eine Schlucht. Der Himmel über der Wüste ist hautfarben. Ganz rechts ist der Himmel grau.
3. Mit Hilfe des Textes ,,Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus (Lk 24,13-25)“ kann man das Bild so deuten, als hätten die Jünger, dargestellt durch die beiden Männer im braunen Gewand, sich Jesus Anwesenheit nur vorgestellt. Die durchsichtige Person stellt Jesus dar, der die Jünger in ihren Gedanken begleitet hat, aber nicht körperlich anwesend war. Sie sahen in Jesus den Retter, der Israel erlösen sollte. Doch ihre Hoffnungen wurden zerstört als Jesus hingerichtet wurde. Jesus wurde aber nur körperlich hingerichtet. Seine Unterstützung gibt er den Menschen weiter, auch wenn er nicht als menschliche Person unter den Menschen verweilt. Deswegen ist die dritte Person auf dem Bild auch nur schemenhaft dargestellt. Jesus ist anwesend, aber nicht körperlich als Mensch unter den Jüngern. Bezogen auf das Leben heutzutage bedeutet dies, dass Jesus auch uns Unterstützung bieten kann, ohne dass er als Mensch anwesend ist.
Deutsch,Q2
Die blaue Blume, Eichendorff
Das Gedicht „Die blaue Blume“ von Joseph von Eichendorff, veröffentlicht 1818 in der Epoche der Romantik, thematisiert die Suche nach dem idealen Leben.
Das Gedicht lässt sich in drei Abschnitte entsprechend der drei Strophen einteilen. Die erste Strophe bildet eine Einleitung in die Sehnsucht und Wünsche des lyrischen Ichs. Das lyrische Ich sucht „die blaue Blume“ (V. 1), welche metaphorisch für die Idealität des Lebens steht. Die Farbe ,,blau" (ebd.) symbolisiert Weite und Sehnsucht, eben diese Sehnsucht nach Idealität. Die Anapher „Ich suche“ (V. 1, 2) leitet die beiden Verse ein. Diese Wiederholung deutet darauf hin, dass das lyrische Ich schon längere Zeit nach dieser ,,Blume"(V.1) sucht. Ein Paradoxon entsteht allerdings, wenn es heißt „und finde sie nie“ (V. 2), denn das lyrische Ich sucht nach einer Blume, obwohl es genau weiß, dass es diese bis jetzt noch nicht gefunden hat und nicht sicher ist, ob es diese je finden wird. Das lyrische Ich erträumt sich (vgl. V. 3) durch die Blume „ gutes Glück“ (V. 4). Es versetzt sich mit dieser Suche in eine Welt, außerhalb des reellen Alltags. Die Alliteration (vgl.V.4) macht dies deutlich, da Glück normalerweise immer gut ist. Innerhalb der ersten Strophe findet man kein Reimschema. Durch die Unregelmäßigkeit wird auf die lange Suche hingewiesen, welche bisher ohne Erfolg war.
Die nächste Strophe, ebenfalls bestehend aus vier Versen, handelt von der bisherigen Suche. Das lyrische Ich suchte immer mit Begleitung der Harfe (vgl. V. 5), welche Musik symbolisiert, an verschiedenen Orten nach der „blaue[n] Blume“ (V. 1). Auch mit der Musik verschafft sich das lyrische Ich eine Auszeit aus dem Alltag. Durch die Aufteilung des damaligen Deutschlands, das so noch nicht existierte, in viele verschieden kleine Fürstentümer, waren die Menschen tagtäglich mit viel Arbeit beschäftigt, damit sie überleben konnten. Eine geregelte Einheit, nach der sich die Menschen sehnten, gab es nicht. Diese Musik begleitet es auf seiner langen Suche. So war das lyrische Ich in „Länder[n], Städt[en] und Au’n“ (V. 6). Mit dieser Antiklimax wird die vergebliche Suche deutlich. Mit der Konjunktion „ob“ (V. 7) wird bedingt, dass sich das lyrische Ich Klarheit schaffen wollte, ob um es herum nicht doch die Antwort zu finden ist. Auch in dieser Strophe kann man kein eindeutiges Reimschema erkennen.
In der dritten Strophe, auch vier Verse, kommt eine gewisse Resignation des lyrischen Ichs zum Ausdruck. Genau wie die zweite Strophe wird auch diese Strophe mit den Worten „Ich wandre“ (V. 5, 9) eingeleitet. Eine Wanderung deutet immer auf eine längere Strecke hin. Auch das lyrische Ich ist schon längere Zeit (vgl. ebd.) unterwegs. Trotz des Vertrauens zu Gott ist es zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Es hat „gehofft [und] vertraut“ (V. 10) „[d]och, ach“ (V. 11), es ist nicht zu einem Erfolg gekommen. Nirgendwo (vgl. V. 11) war die blaue Blume gefunden worden. Das lyrische Ich kommt mit seiner Suche zum Ende. Die Interjektion ,,ach" (ebd.) deutet das heran nahende Ende der Suche an. Doch es gibt noch Hoffnung. Diese wird durch den Partikel ,,noch"(V.11) dargestellt. Die Ziele und Wünsche der damaligen Gesellschaft, symbolisiert durch eben diese „blaue Blume“ (V. 1), waren bisher unmöglich zu finden.
Abschließend wird durch dieses Gedicht mit Hilfe von Metaphern deutlich, dass die Idealität des Lebens nicht zu erreichen ist und dass die Menschen zur damaligen Zeit trotz dieses Wissens weiter nach dieser gesucht haben, da sie sich davon mehr als von ihrem Alltag und der vergeblichen Lage ihres Landes erträumt haben.
Zentrale Merkmale der Romantik
Im Folgenden wird auf zentrale Merkmale der Epoche der Romantik eingegangen.
Hauptmerkmale romantischer Gedichte bestehen unter anderem in der Handlung von Sehnsüchten und Reisen. Das lyrische Ich befindet sich oftmals auf dem Weg oder ist im Aufbruch in ein neues Leben. In diesem neuen Leben erhofft das lyrische Ich sich Unbegrenztheit und Freiheit. Der Romantiker sieht im Mittelalter die bisher beste Zeit. Es war für ihn die Zeit der Einheit und Ordnung. Angelehnt an das Mittelalter sucht das lyrische Ich bessere gesellschaftliche Strukturen. Gleichzeitig kommt aber auch die Sehnsucht zu einer geliebten Person hervor. Dabei wird die Unerreichbarkeit dieser deutlich.
Generell werden in romantischen Gedichten Verweise zu den Gefühlen und dem Inneren des lyrischen Ichs geleistet. Die Flucht in die Fantasie (kann auch durch musische oder künstlerische Elemente ausgedrückt werden) lenkt das lyrische Ich ab oder unterstützt es bei seine Gefühlen und Gedanken. Zentrale Elemente romantischer Gedichte sind zudem Träume oder Albträume. In Träumen kommen wieder Bilder der Sehnsucht zu Tage, welche durch das Unterbewusstsein hervorgebracht werden. Gleichzeitig können Albträume aber auch Schreckensbilder hervorrufen und diese drückt der Dichter aus.
In vielen romantischen Gedichten dient die Natur als Schauplatz des Geschehens. Das lyrische Ich flüchtet sich mit seinen Gefühlen und Sehnsüchten in die Natur, in welcher es sich Antwort
Kleine Aster
Das expressionistische Gedicht „Kleine Aster“ von Gottfried Benn wurde 1912 als Teil einer Gedichtsreihe von fünf Gedichten veröffentlicht und beinhaltet eine detaillierte Beschreibung einer Obduktion.
Das Gedicht besteht aus einer Strophe mit 15 Versen. Es lässt sich aber in drei Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt erstreckt sich von V. 1 – 3. Der Titel ,,Kleine Aster" deutet zunächst auf ein harmonisches Naturgedicht hin, was im weiteren Verlauf aber wiederlegt wird. Das lyrische Ich beschreibt, wie ein neuer Leichnam in die Obduktion gebracht wird. Der neue Leichnam ist von einem „ersoffene[m] Bierfahrer“ (V. 1). Das Adjektiv „ersoffen“ (ebd.) deutet abwertend auf die Todesursache hin. Der Fahrer ist ertrunken. Der beschriebene Prozess spielt sich in der Vergangenheit ab, was durch die Formulierung „wurde […] gestemmt“ (V. 1) deutlich wird. Mit dem Verb „stemmen“ (ebd.) wird das Gewicht des Fahrers angedeutet. Es handelt sich hierbei um keinen leichten Mann. Im Mund des Leichnams befindet sich eine „dunkelhelllila Aster“ (V. 2). Dieser Neologismus stellt gleichzeitig auch ein Paradoxon dar. Entweder ist die Blume dunkel- oder helllila. Beides gleichzeitig ist aber unmöglich, wodurch diese Besonderheit der Blume deutlich wird.. Das Enjambement (V. 2, 3) beschreibt diesen Prozess des In-den-Mund-Klemmens. Der erste und dritte Vers reimt sich.
Im zweiten Abschnitt (V. 4 bis 12) beschreibt das lyrische Ich den Vorgang des Sezierens. Dabei schnitt das lyrische Ich von der Brust aus bis zum Schädel (vgl. V. 4 ff.), wo es auf „sie“ (V. 8) gestoßen ist. Das Personalpronomen „sie“ (ebd.) steht für die Aster, die sich im Mund des Leichnams befunden hat. Das lyrische Ich beschreibt diesen Prozess eher als einen maschinellen Vorgang und geht dabei kaum mehr auf den Bierfahrer ein. Es entsteht das Gefühl einer Entpersonalisierung. Diese Beschreibung deutet auf die wirtschaftliche Lage der Menschen hin. Durch die Industrialisierung in Deutschland haben die Menschen vermehrt in Fabriken an Maschinen gearbeitet. Persönlichkeit war dabei hinten angestellt. So geht dann auch die Persönlichkeit in der Autopsie verloren. Das lyrische Ich behandelt an Stelle des Leichnams, die Blume im Mund wie eine Person (vgl. V. 10). Es packt diese „in die Brusthöhle“ (V. 10), die dadurch wie eine Art Vase erscheint. Dort zwischen dem Obduktionsmaterial (vgl. V. 11) kann die Blume zur Ruhe kommen.
Im letzten Abschnitt des Gedichts (V. 13 – 15) richtet sich das lyrische Ich an die Aster, als würde es mit einer Person sprechen. Mit Hilfe von Imperativen fordert das lyrische Ich die Blume auf, sich satt zu trinken (vgl. V. 13). Dieser Vers wird mit der Bezeichnung der Brusthöhle als Vase weitergeführt und schließlich mit einem Ausrufezeichen abgeschlossen. Die Aster soll trinken, denn im nächsten Vers entsteht eine Andeutung auf ihren Tod. „Ruhe sanft“ (V. 14) ist diese Andeutung, die durch das Schließen der Brusthöhle schließlich bewahrheitet wird. Als letzten Vers wird der Titel „kleine Aster“ (V. 15) wiederholt. Auch dieser Vers endet mit einem Ausrufezeichen, was den Wünschen des lyrischen Ichs Nachdruck verleiht.
Durch die Beschreibung des Prozesses einer Autopsie wird die Distanzierung der Menschen verdeutlicht. Durch die Industrialisierung gingen die Menschen in Fabriken arbeiten. Tagtäglich waren sie mit Maschinen beschäftigt, wobei das Zwischenmenschliche verloren ging. Der nüchterne Umgang mit dem Tod steht kontrastär zur vorrangegangenen Zeitepoche der Romantik.
Hab isch gesehen mein Kumpel
Der Text „Hab isch gesehen mein Kumpel – Wie die Migration die deutsche Sprache verändert hat“ von Uwe Hinrichs, wurde 2012 veröffentlicht und liefert Erklärungsansätze, wie Sprachveränderungen der deutschen Srache zu Stande kommen.
Der Text gliedert sich in sieben Abschnitte. Der erste Abschnitt erstreckt sich von Zeile eins bis zwölf und thematisiert, wie es in der Vergangenheit mit Deutsch und dem Kontakt zu anderen Sprachen war. Bereits im Titel nennt der Autor ein Beispiel zur Veränderung der deutschen Sprache. „Hab isch gesehen mein Kumpel“ stellt eine Inversion dar. Neben dieser Umstrukturierung des Satzes findet man neue Anwendungen der Rechtschreibung und andere Verwendung des Kasus. Mit dem anderen Teil der Überschrift (vgl. Titel) wird deutlich, woher Sprachveränderungen kommen. Da das Verb „haben“ (Titel) im Perfekt steht, wird deutlich, dass die Veränderung der deutschen Sprache bereits begonnen hat. Zu Beginn stellt der Autor die These auf, dass die deutschsprachigen Gebiete schon immer von anderssprachigen Ländern umgeben seien (vgl. Z. 1f.). Dadurch wird die deutsche Sprache schon immer mit anderen Sprachen konfrontiert. Allerdings kam es zur „Nachkriegszeit und zur Zeit des Wirtschaftswunders [zur] weichen Variante des Sprachkontakts“ (Z. 4ff.). Diese metaphorische „weiche Variante“ (ebd.) sei „gesteuert, kulturell abgefedert und ohne wirkliche soziale Konsequenzen“ (Z. 7f.) gewesen, was so viel bedeutet wie, die Sprachen sind aneinander gestoßen, haben sich aber gering verändert und schon gar nicht miteinander vermischt.
Im zweiten Absatz (Z. 13 bis 18) wird ein weiterer Kontakt zwischen Sprachen benannt. In den Siebzigern trete diese neue Form erstmalig auf (vgl. Z. 13). Mit der adversativen Konjunktion „jedoch“ (Z. 13) wird dieses Phänomen eingeleitet.
Im dritten Absatz (V. 19 bis 40) wird durch die rhetorische Frage „Wie […] haben die jüngsten Sprachkontakte das Deutsche verändert? […] (Z. 19f.) eingeleitet, die im Anschluss ausführlich beantwortet wird. Der Autor benennt, welche Sprachelemente zuerst vereinfacht werden oder gar ganz wegfallen. Es seien die Elemente, die der Sprecher „am allerwenigsten benötigt“ (Z. 23f.). Beispiele dazu sind der Kasus oder die Verknüpfungsregeln, die im mündlichen Sprachgebrauch nicht mehr angewendet werden. Diese Aussage wird durch den Fall des Verlustes des Genitivs bekräftigt. Bastian Sick schrieb zu diesem Kampf einen Bestseller (vgl. Z. 26 f.). Auch die anderen Kasus werden immer häufiger falsch angewendet oder anderweitig ersetzt. Selbst schriftlich könnten vor allem junge Menschen nicht mehr zwischen richtig und falsch unterscheiden (vgl. Z. 26 ff.). Die grammatikalischen Fehler können also nicht mehr identifiziert werden und werden dem zu Folge aufgenommen.
Im nächsten Abschnitt (Z. 41 bis 57) zeigt der Autor zukünftige Folgen auf. Mehrsprachige Gruppen vereinfachen Grammatik, damit sie ihren lückenhaften Wortschatz verbessern können (vgl. Z. 45 f.). Diese „Strategie [um] die Sprachstruktur zur vereinfachen“ (Z. 50 f.) macht es anderssprachigen Menschen einfacher. Allerdings stehen Sprachwissenschaftler dieser Methode eher kritisch gegenüber, denn das Plusquamperfekt, der Konjunktiv und das Futur II verwende in Zukunft kaum noch jemand. Diese Zeiten seien dann überflüssig (vgl. Z 53 ff.).
„Eine zweite Quelle für Sprachveränderungen“ (Z. 58) wird im nächsten Abschnitt (Z. 58 bis 83) näher erläutert. Migranten übernehmen ihre Satzstrukturen, also die Satzstrukturen ihrer Muttersprache und wenden diese auf die deutsche Sprache an. Das „zweisprachige Milieu […] festigt“ (Z. 63) diese und sorgt damit für eine Etablierung unter anderem im Kiezdeutsch. Dort lassen sich Rückschlüsse auf das Arabische oder Türkische ziehen (vgl. Z. 67). Es bilde sich eine neue Art des Komparativs mit „mehr“ oder man finde auch neue Ausdrücke mit dem Verb „machen“ (vgl. Z. 74, 81).
Im vorletzten Absatz (Z. 84 bis 105) wird erklärt, wie diese Strukturen zum Teil der deutschen Sprache werden. Der Autor stellt dazu eine These auf. „Sprachkontakt führ[e] immer zu Sprachvermischung und zu neuen Sprachstrukturen“ (Z. 91 ff.). Seiner Meinung nach wird immer weniger korrigiert, sondern mehr kopiert, wodurch Elemente irgendwann automatisch etabliert werden. „Viele Regeln [seien] vereinfacht oder lösen sich ganz auf, die Sprache [werde] einfacher“ (Z. 103 ff.).
Im letzten Absatz schließlich stellt Uwe Hinrichs heraus, warum Sprachwissenschaftler bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes kaum Forschungen durchgeführt haben und äußert abschließend dazu seine Meinung. Die Wissenschaft könne eventuell diskriminierend wirken, wenn sie die Sprachveränderungen auf das Zusammentreffen anderer Sprachen zurückführen (vgl. Z 109 ff.), vermutet der Autor. Das bedauere er sehr, da dies die gemeinsame Projektarbeit verhindere (vgl. 115 f.). „Was man nicht brauch[e], dass schleif[e] sich in der Sprache schnell ab“ (Z. 119 f.). Unbenutzte Wörter und Zeiten gehören dadurch wohl bald der Vergangenheit an.
Abschließend kritisiert Hinrichs die Nichterforschung, da bekannte Strukturen so bald der Vergangenheit angehören werden.
Religion,Q2
Christentum heute
Eine der größten Weltreligionen ist das Christentum. Laut einer Studie im Jahr 2005 des Pew Research Centers war das Christentum die größte Weltreligion. Mit einer Mitgliederzahl von etwa 2,28 Milliarden Mitgliedern lag das Christentum noch weit vor dem Islam (1,75 Milliarden Anhänger). Die katholische Kirche ist Teil des Christentums und obwohl immer weniger Menschen Gottesdienste besuchen, stiegen die Mitgliederzahlen immer weiter an. Bis 2014 waren 1,3 Milliarden Menschen Mitglied der katholischen Kirche.
Entgegen dieses weltlichen Anstieges erleidet die katholische Kirche in Deutschland jährlich eher Verluste. Im Jahr 2011 waren in Deutschland bei einer Gesamtbevölkerung von 80.328.000 Menschen, 24.473.000 der katholischen Kirche angehörig. Das entspricht etwa 30,5%. Vergleicht man dazu aktuelle Zahlen von 2018 (Die Gesamteinwohnerzahl beträgt 83.019.000, davon sind 23.002.000 Mitglieder der katholischen Kirche. Das entspricht etwa 27,7%.), so erkennt man einen Verlust von 2,8%.
Auch weitere europäische Länder wie Österreich oder die Niederlande verzeichnen eher einen Abfall der Mitgliederzahlen. Betrachtet man auch dort die Zahlen aus dem Jahr 2011 (Österreich 64,3% /Niederlande 26%) und vergleicht diese mit nachfolgenden Jahren (Österreich 2018, 57% / Niederlande 2015,24%), so kann man auch in diesen europäischen Ländern Verluste feststellen.
Demnach stellt sich die Frage, auf welchen Kontinenten das Christentum Mitglieder gewinnt, wenn die allgemeinen Zahlen ansteigen, die von exemplarischen europäischen Ländern aber absinken.
Früher lebten die meisten Christen in Europa und Nordamerika (mehr als 80%). Die Herkunftsländer haben sich heutzutage verschoben. Zwei Drittel der heutigen Christen kommt aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Ein weiteres Anhängerwachstum in diesen Regionen der Erde ist anzunehmen. Dem zu Folge gehen Experten davon aus, dass die afrikanischen Länder in Zukunft am meisten Anhänger des Christentums beheimaten werden (etwa 1,7 Milliarden).
(Quelle: Wikipedia, Mitgliederentwicklung in den Religionsgemeinschaften und https://www.tagesspiegel.de/kultur/zukunft-der-religion-das-christentum-steht-vor-einer-revolution/19253464.html)
Heiße Eisen
Demokratie in der Kirche:
Ein Blick auf die Geschichte
Lange Zeit waren demokratische Ansätze und Kirche nicht miteinander zu vereinen. Man nahm an, dass die Macht von Gott komme und nicht das Volk zu bestimmen habe.
Keine Demokratie in Glaubensfragen
In Bezug auf biblische Inhalte sei keine Demokratie möglich. Abstimmungen würden an diesen Inhalten nichts verändern können.
Demokratische Vergabe kirchlicher Ämter?
Es besteht bis heute die Frage, ob Kirchenämter durch demokratische Abstimmungen besetzt werden sollen oder ob, wie bisher, die geistlichen über diese Ämter abstimmen und diese besetzen sollen.
Perspektiven der Geschichte
Schaut man in die Vergangenheit, kann man erkennen, dass bereits Päpste bei Abstimmungen mit nicht-geistlichen gewählt wurden. Teilweise gab es zumindest ein Zustimmungsrecht für das Volk (siehe Papst Nikolaus II.).
Chancen für heute
Immer mehr Menschen wünschen sich ein Mitspracherecht in Bezug auf kirchliche Ämter. Sie denken, dass eine isolierte Wahl nur unter Geistlichen nicht immer zum besten Ergebnis führen kann. Bisherige demokratische Ansätze sollen gestärkt werden.
Die Rolle der Frau in der Kirche:
Gesellschaftliche Benachteiligungen
Die Beziehung zwischen Frau und Kirche hat sich heutzutage stark verändert. Dem zu Folge wissen moderne Frauen, dass sie in der Kirche stark benachteiligt werden, genau wie in der Arbeitswelt.
Kirchliche Benachteiligungen
Die heutige Gesellschaft fordert ebenso Gleichberechtigung in der Kirche. So sollen Frauen alle Ämter ausüben dürfen. Allerdings lehnt die Kirche das ab. Sie verweisen darauf, dass nur Männer zu Priestern bestimmt seien.
Das Wort einer Heiligen
Edith Stein formulierte im Jahr 1931 bereits die Verlangen der Frau in Bezug auf das Einbringen in kirchliche Ämter und Institutionen. Allerdings stellte sich damals die Frage, ob dies praktisch durch zuführen war.
Positive Entwicklungen
In Bezug auf Arbeit der Frau in der Kirche hat sich schon Einiges stark verbessert. So können sich Frauen heutzutage viel aktiver in die Gestaltung der Gottesdienste mit einbringen. Frauen bekleiden zu dem hohe Ämter in den Behörden des Vatikans oder sind Professoren der Theologie.
Kirche im Netz
Die Website „evangelisch.de“ existiert seit 2019 und wird von der evangelischen Kirche betreut. Die Seite befasst sich mit vielen verschiedenen religiösen Themen wie der Bibel und den Glaubensbekenntnissen, informiert aber zeitgleich auch über aktuelle Nachrichten oder verschiedene gesellschaftliche Aspekte. Die Seite weißt außerdem auf weitere Seiten wie „rundfunk.evangelisch“ oder „predigten.evangelisch“ hin, bei denen man noch weitere Informationen erhalten kann.
https://www.evangelisch.de/nachrichten?kamp=menu
Eine andere kirchlich geprägte Website ist „Kirche + Leben im Netz“. Diese Website ist Teil eines online Magazins. Auch diese Seite informiert über kirchliche Nachrichten und berichtet über kirchliche Aktionen. So hat man die Möglichkeit genaue Informationen über kirchliche Institutionen wie „Misereor“ zu erhalten, oder sich einfach über Bistümer oder Bischöfe zu informieren.
https://www.kirche-und-leben.de/
Als Gegenstück zu Website „evangelisch.de“ gibt es auch die Website „katholisch.de“. Diese Website informiert ebenfalls über verschiedene aktuelle Nachrichten, welche mit Kirche zusammenhängen. Gleichzeitig hat man aber auch die Möglichkeit, sich über den Vatikan oder verschieden Hilfswerke zu informieren. Die Seite bietet zu dem auch die Möglichkeit zur Seelsorge. Dieser Unterpunkt ist noch in weitere Unterbereiche aufgeteilt, in welchen Seelsorge durch die katholische Kirche möglich ist.
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel
Eine etwas andere Darstellung von Kirche im Netz zeigt die Seite „domradio.de“. Diese Seite bietet neben den aktuellen kirchlichen Nachrichten auch die Möglichkeit online den eigenen Radiosender wie TV-Sender zu nutzen. Die jeweiligen Programme bieten Überblick, wann welche Themen angesprochen werden. Außerdem kann man sich verschieden thematische Podcasts runterladen oder sich auch verschieden Evangelien anhören.
Auch eine Art von Kirche im Netz stellt die Seite des Kölner Doms dar. Neben der Präsentation des Doms mit seiner Geschichte und der Möglichkeit Führungen zu buchen, kann man sich auch über zum Beispiel die Domseelsorge informieren. Außerdem werden die weiteren Möglichkeiten der Dominstitutionen aufgezeigt.
https://www.koelner-dom.de/home/
Die „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen“ betreibt ebenfalls eine eigene Website. Die Arbeitsgemeinschaft nutzt die Seite zur Darstellung ihres Konzeptes, greift aber auch aktuelle Ereignisse auf. Diese Seite gliedert sich in weitere Seiten entsprechend der Gemeinschaften in den einzelnen Bundesländern auf.
Die Seite „kirche.tv“ befasst sich mit Fernsehbeiträgen die Bezug zu Religion und Kirche herstellen oder religiöse Thematiken diskutieren. Auch findet man auf dieser Website ganze Gottesdienste, Bibelclips oder soziale Aktionen, die mit Kirche in Verbindung gebracht werden können. Eine Live-Übertragung bei wichtigen Veranstaltungen aus dem Vatikan wird auch geboten.
https://fernsehen.katholisch.de/
Nostra Aetate
1. Das Textdokument „Erklärung Nostra Aatate über das Verhältnis des Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“ stellt Bezüge zwischen dem Christentum und den anderen Weltreligionen her.
Im ersten Absatz weist das Dokument auf den Wandel in der Gesellschaft und den damit verbundenen Wandel des Zusammenlebens hin. Dieser stellt den Anlass dieses Dokuments dar. Alle Völker haben den selben Ursprung und werden auch zu diesem Ursprung zurück kehren. Dadurch erhoffen sich viele Menschen von der Religion Antwort auf ihre existenziellen Fragen. Diese treten unabhängig von der Religion auf.
Im zweiten Absatz werden der Buddhismus und der Hinduismus thematisiert. Im Laufe der Zeit haben die Menschen immer eine Verbindung zu etwas Transzendentem gespürt. Diese Verbindungen haben sich auch im Laufe der Zeit verändert. Wie auch die Gesellschaftsstruktur entwickelt sich diese Verbindung weiter. Diese Suche unterscheidet sich in den beiden Religionen: Hinduismus und Buddhismus. Im Hinduismus bedient man sich an Mythen und Mediation, während man im Buddhismus gelehrt wird, den Weg zur höchsten Erleuchtung zu erreichen. Generell weisen die Lehren, Riten und Lebensregeln den Weg zum besseren Leben. Die katholische Kirche respektiert diese Ansichten und Weisen des Glaubens, stimmt allerdings nicht in allen Ansichten überein. Daher betont sie, dass Christus für sie den Weg zum wahren Leben darstellt. Ein Austausch über dieses Denken soll in Zusammenarbeit geschehen. Es wird dazu geraten.
Im dritten Absatz beschreibt das Dokument das Denken der katholischen Kirche über die muslimische Religion. Auch dieser Religion spricht sie ihren Respekt aus. Sie stellt Parallelen heraus, auch wenn diese nicht ganz übereinstimmen. Die Vergangenheit beider Religionen ist aber vorbelastet und soll deswegen hinter sich gelassen werden. Ein Neuanfang im Sinne des friedlichen Zusammenlebens ist angestrebt.
Der vierte Absatz bezieht sich auf das Judentum. Auch zu dieser Religionsrichtung bestehen Parallelen. Christentum und Judentum teilen sich die Offenbarung des alten Testaments. Auch wenn einige Ansichten etwas auseinandergehen, erhofft die katholische Kirche eine gemeinsame Zukunft in enger Zusammenarbeit. Auch deshalb soll man den Tod Christi keinem Juden vorwerfen. Das Kreuz soll der Kirche als Zeichen Christi, der universellen Liebe Gottes und als Quelle aller Gnaden dienen.
Der fünfte Absatz beschäftigt sich mit Nichtgläubigen. Niemand kann zum Glauben an Gott gezwungen werden. Es ist der freie Wille eines jeden Menschen, sich des christlichen Glaubens anzuschließen, auch wenn er als Abbild Gottes geschaffen wurde. Dadurch ergeben sich die selben Rechte eines jeden Menschen. Kirche verweigert Diskriminierung gegenüber anderen Menschen. Man soll Nächstenliebe und Gleichheit leben, um zu zeigen, dass man Gott angehört und seine Werte vertritt.
2. Im letzten Absatz des Dokuments mit dem Titel „Universelle Brüderlichkeit“ wird deutlich, dass alle Menschen Kinder Gottes sind und dass er keine Unterschiede in Hautfarbe, Glaubensrichtung oder ähnlichem macht. Menschen sollen diese Werte der Gleichheit vermitteln. Meiner Meinung nach kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Menschen diese Gleichheit ausleben können. Heut zu Tage ist Diskriminierung und Hass an der Tagesordnung. Immer weniger Menschen leben diese Gleichheit aus. Ich kann mir vorstellen, dass durch die Abnahme des christlichen Glaubens oder auch der Teilnahme an Religion allgemein diese Lebensformen verloren gehen. Werte werden nicht mehr vermittelt und können dem zu folge auch nicht praktiziert werden. Man kann Menschen nicht zu ihrem Glauben zwingen, doch sollten die Menschen trotzdem die allgemeinen Werte ausleben, die das Zusammenleben der Menschen untereinander vereinfachen. Die katholische Kirche sagt im Dokument „Nostra Aetate“ aus, dass nur die Menschen, die die Werte Gottes und die Lebensweise Christi ausleben und weiter verbreiten, die eigentliche Söhne Gottes sind. Ich stimme dieser Aussage vollkommen zu. Ich denke, wer sich nicht an die Gebote der Nächstenliebe, der Gleichheit und des Friedens hält, kann eigentlich kein Sohn Gottes sein, da alle diese Werte das Verkörpern, was im christlichen Glauben Fundament ist. Auch wer am Glauben Zweifel hegt, kann diese Werte ausleben, da sie das Zusammenleben der Gemeinschaft erleichtern. Grundsätzlich hat jeder Mensch als Grundlage seines Handelns diese Werte, allerdings müssen diese nicht unbedingt ausgelebt werden.
Meiner Meinung nach fast dieser letzte Absatz also die Grundsätze der christlichen Glaubensrichtung zusammen, die aber als Grundsätze des menschlichen Zusammenlebens aufgefasst werden können. Die Verbreitung dieser ist wichtig, aber es nicht möglich diese überall auszuleben.