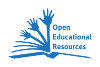Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Benutzer:FabLangen
Inhaltsverzeichnis |
Faust
Selbstdarstellung Mephistos
Der vorliegende Textauszug von Vers 1335 bis Vers 1378 ist 1790 mit dem Drama ,,Faust" von Goethe veröffentlicht worden und thematisiert die Selbstdarstellung Mephistos. Mephistopheles stellt sich zu Beginn selbst als ,,Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft (V. 1336 f.), dar und drückt damit aus, dass er zwar Böses bewirken will, es aber dennoch nicht schafft, da er nicht mächtig genug ist. Er ist der Meinung, dass alles, was entsteht, mit Recht ,, zugrunde geht" (V. 1340), er findet also, dass Alles zerstört werden muss, weshalb es ihm auch lieber wäre, wenn ,,nichts entstünde" (V. 1341). Mit dieser Einstellung kann er das Böse mit Recht als sein ,,eigentliches Element" (V. 1344) bezeichnen. Er stellt sich außerdem als ,,Teil der Finsternis" (V. 1350) dar, aus der das Licht entstanden ist, das die Finsternis auf die Nacht beschränkt und somit verdrängt hat (vgl. V 1352). Er kann es nicht leiden, dass an den Menschen immer wieder das Licht, die Metapher für das Gute, sichtbar wird und hofft daher, dass es mit den Menschen ,,zugrunde gehn" (V. 1358) wird. Doch nicht nur die Menschen will er vernichten, sondern am liebsten die ganze Welt. Das versucht er mit ,,Wellen, Schütteln, Stürmen, Brand" (V.1367), doch am Ende bleiben immer ,,Meer und Land" (V. 1368). Das zeigt erneut die Unterlegenheit des Bösen gegenüber dem Guten und die Machtlosigkeit Mephistos. Dass er nicht in der Lage ist, die Welt und Gottes Schöpfung auszulöschen und die Tatsache, dass, egal wieviele er schon begraben hat, immer wieder neue Lebewesen geboren werden, lassen ihn verzweifeln (vgl. V.1371 ff.). Als Element, durch das er wirkt, ist ihm dennoch die Flamme, die gefährlich und zerstörerisch ist, zugeordnet, was das einzige ist, das er für sich hat (vgl. V 1377f.). Zusammenfassend kann man Mephisto als das Böse beschreiben, das alles Gute der Welt und die Welt selbst vernichten möchte, dazu aber nicht in der Lage ist, weil das Gute es immer siegt.
Faust-Monolog
Der Textauszug ist ein Auszug des Dramas „Faust – Der Tragödie erster Teil“, welches von 1775 bis 1806 von Johann Wolfgang Goethe geschrieben worden ist, somit in den Epochen der Aufklärung (1720-1785), des Sturms und Drangs (1767-1785), der Klassik (1786-1805 und der Romantik (1795-1835) entstanden ist und die Versuchung, sich zu Bösem verleiten zu lassen, thematisiert. In der vorliegenden Szene führt Faust einen Monolog, in dem er an seinem ungestillten Wissensdurst verzweifelt, nachdem Gott und Mephistopheles, der Teufel, eine Wette eingegangen sind: Während der Herr glaubt, dass Mephisto den wissbegierigen Wissenschaftler namens Faust nicht vom rechten Weg abringen könne, ist Mephisto anderer Meinung. Im Anschluss an die Szene, in der Faust sich vorstellt, beschwört er einen Erdgeist, der seinen Wissensdurst stillen soll, doch da das nicht geschieht können nur Glockenklang und Chorgesang an Ostern verhindern, dass er mithilfe von Gift Suizid begeht. Daraufhin machen er und sein Famulus Wagner einen Spaziergang, bei dem sie bemerken, dass sie ein Pudel verfolgt, der, wie sich im Haus des Faust herausstellt, Mephisto in einer Hundsgestalt ist, mit dem Faust anschließend einen Pakt eingeht, dass er Mephisto seine Seele verspricht, wenn Mephisto ihm hilft den Genuss des Lebens zu erfahren. Mephisto verjüngt Faust und verkuppelt ihn mit der jungen Margarete, Gretchen genannt, die er schwängert, nachdem er Gretchen überredet hat, ihrer Mutter ein Schlafmittel zu verabreichen, damit sie ihre Ruhe haben. Doch dieses Schlafmittel bedeutet den Tod der Mutter und Mephisto verleitet Faust dazu, Gretchens Bruder Valentin zu erstechen, nachdem dieser sie angriff, da Faust seiner Schwester die Ehre nahm. Faust und Gretchens Wege trennen sich vorerst, doch als er mitbekommt, dass sie aufgrund des Mordes an ihrem Kind im Kerker sitzt, zieht er los, um sie zu retten, doch sie weigert sich und ergibt sich dem Urteil Gottes, anstatt Mephisto und ihm zu folgen. Die vorliegende Textstelle ist ein Auszug eines Monologs von Faust, als er das erste Mal in Erscheinung tritt. Faust ist ein wissbegieriger Mann, der, wie er zu Beginn des Monologs erläutert, „Philosophie, / Juristerei und Medizin, / Und leider auch Theologie“ (V. 354 ff.) studiert hat. Dass er vier Studiengänge absolviert hat, die teilweise Geisteswissenschaften und alle sehr schwer sind, zeigt seine große Wissbegierde. Doch ihm ist das Wissen, das er sich angeeignet hat nicht genug, da er denkt er sei „so klug als wie zuvor“ (V. 359), weshalb er auch bereut diese Fächer gelernt zu haben, was durch den Ausruf „ach" (V. 354) und das Adverb „leider" (V. 356) deutlich wird. Mit diesem Vergleich drückt er aus, dass er sich auch nach vier erfolgreich absolvierten Studiengängen nicht schlauer als früher fühlt, was ihn unzufrieden macht. Das drückt er durch die Verwendung des Adjektivs „arm“ (V. 358) aus. Wieviel theorethisches Wissen er sich angeeignet hat wird durch die Aufzählung und Anapher „Heiße Magister, heiße Doktor gar" (V. 360) ausgedrückt, da er die beiden höchsten akademischen Grade erreicht hat Er gibt auch „schon an die zehen Jahr“ (V. 361) sein Wissen an seine Schüler weiter, die er „[h]erauf, herab und quer und krumm / […] an der Nase herum[zieht]“ (V. 362 f.). Diese Metapher verbildlicht, dass er seinen Schülern sein Wissen zum Auswendiglernen weitergibt, aber nicht aud Verständnis der Schüler trifft, da er selber nicht in der Lage ist, alles zu verstehen, was er gelehrt bekommen hat. Während des Unterrichtens merkt Faust, dass sie „nichts wissen können“ (V. 364). Da er dies in einem Ausruf formuliert (vgl. V. 364), wird die Empörung über diese Erkenntnis erkennbar Wie sehr ihn diese Erkenntnis wirklich bedrückt, wird durch die von ihm genutzte Metapher, dass dies ihm „schier das Herz verbrennen [will]“ (V. 365), ausgedrückt. Dabei steht das Feuer in seinem Herzen metaphorisch für das Streben nach Wissen, was ihn unglücklich macht, da der Wille so groß ist, er es aber nicht schafft den Sinn zu begreifen. Auch wenn er schlauer als viele Menschen mit teilweise ebenfalls guter Bildung, aufgezählt sind das „die Laffen / Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen“ (V. 366 f.), ist, er weder zweifelt (vgl. V. 368) noch Angst vor dem Tod, in seinen Worten metaphorisch als Hölle und Teufel (vgl. V. 369) dargestellt, ist ihm „alle Freud entrissen [worden]“ (V.370), weil er eingesehen hat, dass er nichts wirklich weiß (vgl. V. 371), nichts lehren kann (vgl. V. 372) und auch keinen Menschen bessern kann (vgl. V. 373).Dass er sich nicht einbildet etwas zu wissen odeer etwas lehren zu können, ist in einer Anapher geschrieben (vgl. V. 371 f.), die verdeutlicht wie pessimistisch er dem sich bereits angeeigneten Wissen gegenüber steht und dass er sich für unfähig hält. Das Verb „entreissen"(V. 370) verdeutlicht die Brutalität, mit der der Wissensdurst sein Leben beeinflusst und ihm den Willen, unter solchen Umständen weiterzuleben, genommen hat. Weil er zusätzlich zu dem ungestillten Wissensdurst kein luxuriöses Leben führt, weil er „weder Gut noch Geld [also Besitz]“ (V. 374) noch die „Ehr und Herrlichkeit der Welt [also Ansehen]“ (V. 375) hat wird, die Lust zu leben weiter vermindert.. Wenn nicht einmal ein Hund unter den Umständen weiterleben wollen würde (vgl. V. 376),, was eine Hyperbel ist und zeigt, für wie wenig lebenswert Faust sein Leben hält, möchte auch er das nicht und hat sich, um das Wissen zu erlangen, etwas Übermenschlichem, „der Magie[,] ergeben“ (V.377). In diesem Fall ist das Nomen „Magie" eine Metapher für etwas Übermenschliches, einen Erdgeist, den er beschwört, in der Hoffnung, dass ihm „durch Geistes Kraft und Mund“ (V. 378) übermenschliches Wissen zu Teil wird. Er hofft dadurch nicht mehr Dinge lehren zu müssen, deren Sinn er nicht versteht (vgl. V. 381), und dass er erkennt, was „die Welt / Im Innersten zusammenhält“ (V. 382 f.). Er möchte nun das Wissen beziehungsweise das Leben erfahren und „nicht mehr in Worten kramen“ (V. 385), wobei die Worte metaphorisch die Theorie, in der er die Antworten auf seine Fragen nicht weiter suchen will, verbildlichen sollen. Auf die Form der Textstelle bezogen kann man feststellen, dass das Metrum unregelmäßig ist, während das Reimschema in den Versen 354-357 ein Kreuzreim und in den übrigen Versen ein Paarreim ist. Das Wechseln des Reimschemas trennt die ersten vier Verse vom Rest, da es dort inhaltlich um die Studiengänge geht, die er absolviert haben und ihm so sehr viel Wissen versprechen sollten, während in den übrigen Versen deutlich wird, dass Faust dennoch unzufrieden ist, da er dennoch nicht versteht, „was die Welt / im Innersten zusammenhält " und somit den Sinn des Lebens nicht versteht. Das unregelmäßige Metrum kann auf das Unverständnis dieser Sinnfragen hinweisen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Faust eine hochbegabte Lehrperson ist, die sehr wissbegierig ist. Das zu wissen, was er weiß, reicht ihm nicht aus, sodass er Dinge erfahren möchte, die übermenschlich sind. Weil es Faust so fertig macht diese Dinge nicht zu verstehen, dass er so nicht weiterleben will, wendet er sich an die Geister, um sich dieses Wissen anzueignen.
Figurenvergleich Faust-Mephisto
Das Drama „Faust - Der Tragödie Erster Teil“ ist 1808 von Johann Wolfgang von Goethe veröffentlicht worden und handelt von Faust, der seinen Wissensdurst nicht stillen kann und deshalb einen Pakt mit Mephisto eingeht, der ihm verspricht, ihn glücklich zu machen, wenn er im Gegenzug Fausts Seele erhält. Faust ist männlich und der Protagonist des Dramas. Er ist ein Wissenschaftler mit den Titeln „Magister“ (V.360) und „Doktor“ (ebd.), der vier Studiengänge, nämlich „Philosophie, / Juristerei und Medizin, / Und […] Theologie“ (V. 354 ff.), belegt hat, mit dem Ziel, zu erkennen, „was die Welt / Im Innersten zusammenhält“ (V. 382 f.). Außerdem ist er Lehrer, doch beim Unterrichten merkt er, dass die Menschen „nichts wissen können“ (V. 364). Diese Erkenntnis, dass er trotz den vier Fächern, die er studiert hat und seinen beiden Titeln, nicht in der Lage ist, die für ihn so wichtigen Sinnfragen zu beantworten, „will [ihm] schier das Herz verbrennen“ (V. 365). Er hofft, dass ihm „durch Geistes Kraft und Mund“ (V.378) übermenschliches Wissen zu Teil wird. Doch da er erneut enttäuscht wird, schließt er sich Mephisto an, um Glück zu erfahren. Mephisto, der Teufel, ist eine wichtige Nebenrolle des Dramas. Er ist der Gegenpart zum Herrn, mit dem er eine Wette abschließt, dass er es schaffen kann, Faust auf den falschen Weg zu bringen. Er stellt sich selbst als „das Böse“ (V.1343) dar und ist der Meinung, dass „alles was entsteht / [wert ist] dass es zugrunde geht“ (V.1339 f.) und dass es besser wär, „dass nichts entstünde“(V.1341), weil er Gottes Schöpfung als schlecht empfindet. Mephisto steht für die Zerstörung und die Bekämpfung des Guten, was das Böse verdrängt und somit mächtiger ist (vgl. V. 1350 ff.). Mephisto ist allerdings nicht in der Lage dazu, für Zerstörung zu sorgen, da „am Ende Meer und Land“ (V.1368) bleibt und immer wieder neue Lebewesen geboren werden (vgl. V. 1372). Das deprimiert ihn so, dass er glaubt, er hätte nichts für sich, wenn er sich nicht das Element der Flamme gesichert hätte (vgl. 1377 f.). Er ist listig, weil er Fausts Verzweiflung ausnutzt, um ihn zu kontrollieren und negativ zu beeinflussen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Faust und Mephisto beide gute Voraussetzungen haben, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen, aber dennoch nicht in der Lage sind, was sie umso mehr deprimiert. Mephisto, der das Böse im Menschen symbolisiert, nutzt die Enttäuschung Fausts aus, um ihn auf den falschen Weg zu bringen, was seine Hinterlist zeigt. Dennoch ist Mephisto dem Guten unterlegen und nicht so mächtig, wie er vorgibt zu sein.
Korrektur der Klausur
R-Fehler:
Da das allerdings nicht geschieht, können nur Erinnerungen, die an Ostern geweckt werden, Faust vom Suizid abhalten.
Dass ihm die Natur ein Genuss ist, zeigt erneut die Lebensfreude Fausts.
Des Weiteren bedankt sich Faust dafür, dass es ihm gegönnt ist, "in ihre tiefe Brust / Wie in den Busen eines Freunds zu schauen"(V.8 f.).
Die Metapher, dass er ihr in die Brust schaue, soll die Nähe zur Natur verbildlichen.
Weil Mephisto die Natur so verachtet, versucht er, als Teil des Bösen, sie zu zerstören "[m]it Wellen, Schütteln, Stürmen, Brand" (V.43), was ihm aber nicht gelingt (vgl. V.44).
Während Faust also der Meinung ist, dass Gottes Schöpfung herrlich ist und er froh ist sie erfahren zu dürfen und Teil von ihr zu sein, hasst Mephisto sie über alles, das sie unzerstörbar ist und ihn und das Böse verdrängt.
Z-Fehler:
Die vorliegende Textstelle ist ein Auszug der Szene "Wald und Höhle" aus dem Drama "Faust - Der Tragödie Erster Teil", welches 1808 von Johann Wolfgang Goethe veröffentlicht wurde, in den Epochen des Sturm und Drangs, der Romantik und der Klassik entstanden ist und den Konflikt zwischen Gut und Böse im Innern eines jeden Menschen thematisiert.
Faust und Gretchen sind so verliebt, dass er sie schwängert.
Dass er sich im Feuer gezeigt hat (vgl. ebd.), ist eine Metapher, die das Übermenschliche symbolisisert, weil der Mensch Feuer nicht vollständig kontrollieren kann.
Er ist froh, dass er Gretchen gefunden hat, die er liebt und dass die Gefühle erwidert werden, sodass er ihr so nah und vertraut sein kann wie einem Freund.
Zudem sagt Faust, dass er an die Vorfahren und Geister denkt wenn er den "reinen Mond" (V.20)sieht.
Die Szene "Wald und Höhle" (VV.1-24) zeigt, dass Faust die Natur als "herrlich" (V.5) ansieht.
A-Fehler:
Somit ist Faust der Meinung, dass die Elemente, als Teil der Natur, (vgl. V.12) seine "Brüder" (V.11) sind, also auch beachtet und als nahezu gleichgesetzt gesehen werden müssen.
Er hasst den Kreislauf, der dafür sorgt, dass immer wieder neue Lebewesen geboren werden (vgl. V.48 f.) und dass diese überall zu finden sind (vgl. V.50), sodass lediglich die "Flamme" (V.53) ihm allein bleibt.
Gr-Fehler
Von Vers 13 bis 19 sind mehrere Metaphern zu finden, die verbildlichen sollen, dass der Erdgeist ihn bewahrt und zu sich selbst führt, wenn etwas Schlimmes passiert, was viele negative Folgen hat.
Außerdem ist er der Meinung, dass sie dem Menschen "zum Königreich" (ebd.) gemacht wurde, was heißt, dass der Mensch sowohl Herrscher über sie sein soll, aber er auch eine Verantwortung für sie trägt und er somit mit ihr im Einklang leben muss.
Sb-Fehler:
Durch diese Metaphern verbildlicht er die Situation, in der Faust depressiv war, aber vor dem Suizid bewahrt wurde, zu sich selbst fand und zu lieben lernte, was er dem Erdgeist zuschreibt.
Zit-Fehler:
Faust ist durch die Liebe so glücklich gestimmt, dass er dem Erdgeist dafür dankt, dass er ihm alles gab, worum er ihn gebeten hat (vgl. V.3).
Woyzeck
Analyse: Der Hessische Landbote
Der vorliegende Sachtext „Der Hessische Landbote“ ist 1834 von Georg Büchner als Flugblatt veröffentlicht worden, nachdem er von Pastor Friedrich Ludwig Weidig überarbeitet worden ist, und übt Kritik an der Ständegesellschaft, unter der das einfache Volk 1834 leiden musste. Zu Beginn des Flugblatts nennt Büchner den Anlass für sein Schreiben, nämlich das Melden der „Wahrheit“(Z.5) an die gesamte hessische Bevölkerung, was er durch die Metapher ausdrückt, dass es dem „hessischen Lande“ (Z.4) gewidmet ist. Er möchte die Wahrheit verbreiten, obwohl das aufgrund der Zensur zu diesem Zeitpunkt sowohl für ihn, als auch für die Leser schwere Folgen haben kann. Grund dafür ist die fehlende Meinungs- und Pressefreiheit und dass über solche Verstöße „meineidige Richter“ (Z.7) urteilen, die sich also nicht daran halten, was Recht ist, sondern danach, wie der Fürst die Situation einschätzt. In dieser Gesellschaft war es daher üblich, dass derjenige, der „die Wahrheit sagt“ (Z.5) gehenkt wird und dass sogar diejenigen, die ein solches Schreiben, welches Kritik übt, lesen, bestraft werden. Aus diesem Grund, um die Leser zu schützen, gibt er ihnen fünf Tipps: die Leser sollen das Schreiben außerhalb ihres Hauses aufbewahren, damit es nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden kann (vgl. Z.10 f.), sie dürfen es persönlich nur Freunden weitergeben (vgl. Z.12 f.), Fremden hingegen nur heimlich unterjubeln (vgl. Z. 14 f.), wenn man mit dem Schreiben erwischt wird, soll man behaupten, man hätte es gerade dem Kreisrat bringen wollen (vgl. Z.16 ff.) oder behaupten, man hätte es nicht gelesen, da den Nicht-Lesern keine Strafe droht (vgl. Z.20 ff.). Dadurch, dass Büchner sagt, man solle es auch Fremden „heimlich hinlegen“ (Z.15), will er die Verbreitung seines Flugblatts vorantreiben. Anschließend folgen die Ausrufe „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ (Z. 23), durch die Büchner zur Revolution gegen die Fürstentümer aufruft. Die Antithese der Hütten und der Paläste (vgl. ebd.) zeigt nochmal deutlich den Anlass, nämlich dass das einfache Volk unter Armut leidet, während der Adel ein Leben voller Reichtum genießt. Dass diese Revolution durch Gewalt erfolgen soll, wird durch das Nomen „Krieg“ (ebd.) verdeutlicht. Unterstrichen wird die zuvor genannte antithetische Wirkung durch einen Parallelismus in den eben zitierten Ausrufen. Es folgt ein Einschub des Pastors Friedrich Ludwig Weidig, der sagt, dass es aussehe, „als würde die Bibel“ (Z. 24 f.) lügen, wenn man die Art der Staatsführung, die in Hessen zu dem Zeitpunkt vorliegt, als richtig ansieht, da sie dem Leben nach der Bibel widerspricht. Laut der Bibel sind am fünften Tag die Landtiere und am sechsten Tag die Menschen, die über die Tiere herrschen sollen, geschaffen worden. Der Fürst gestaltet das Leben aber so, dass es aussieht, als „hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage“ (Z.24 ff.) geschaffen, sodass sie zum Tier gehören, über das die Fürsten und Vornehmen herrschen, die somit am sechsten Tag geschaffen worden wären. Somit würden die Armen zum „Gewürm“ (Z. 31) zählen, was metaphorisch die Unterlegenheit gegenüber den Vornehmen und ihre Minderwertigkeit ausdrückt. Anschließend bezeichnet Büchner das Leben der Vornehmen als einen „lange[n] Sonntag“ (Z. 32), da diese sich auf der Arbeit der Armen ausruhen können und zudem, aufgrund ihres Wohlstandes, jeden Tag sogenannte Sonntagskleidung tragen können. Ein weiteres Zeichen für die starke Trennung von arm und reich ist, dass die Reichen eine „eigne Sprache“ (Z.35) sprechen, nämlich Französisch, was bei diesen sehr beliebt war. Im Kontrast dazu liegt das Volk, metaphorisch gesehen, vor diesen wie „Dünger auf dem Acker“ (Z.36), ist also nur dazu da, das Leben der Vornehmen zu fördern und es angenehm leicht zu machen. Die Vornehmen lassen die Armen nämlich arbeiten (vgl. Z. 37 ff.) und bringen sie anschließend um ihren Ertrag, indem sie „das Korn“ (Z. 40) nehmen und den Armen lediglich die „Stoppeln“ (ebd.) zurücklassen. Antithetisch zum Leben der Reichen bezeichnet Büchner das Leben der Armen als einen „lange[n] Werktag“ (Z. 41), da sie ihr Leben lang für die oberen Schichten arbeiten müssen. Zudem verzehren die Vornehmen deren „Äcker“ (Z.42), hier als Hyperbel für den Ertrag, um zu zeigen, dass auch zehn Prozent Abgaben das Volk stark treffen. Die harte Arbeit hat außerdem negative Folgen für den physischen Zustand der Bauern (vgl. Z.43). Dennoch genießen die Reichen ihr Leben und dass dieses durch die Armen so erleichtert wird, was hier durch die Metapher des Salzes „auf dem Tische des Vornehmen“ (Z.44) verbildlicht wird. Abschließend kann man sagen, dass Büchner und Weidig mit diesem Flugblatt zur Revolution aufrufen wollen, da ihnen das Leben in einer solchen Gesellschaft voller Ausbeutung und im Konflikt mit der Bibel missfällt. Mit der Kritik an die Fürsten gehen die Autoren ein großes Risiko ein, da die Veröffentlichung solcher Schriften zu Zeiten der Zensur mit dem Tod bestraft wurden. Das ist es ihnen aber wert, da sie ihre Kritik, dass die Armen wie Tiere behandelt, untergeordnet und ausgebeutet werden, nicht mehr für sich behalten wollen.
Parallelen zwischen "Der Hessische Landbote" und "Woyzeck"
Da das Flugblatt „Der Hessische Landbote“ (1834) und das Drama „Woyzeck“ (1879) beides Schriftstücke Georg Büchners sind, lassen sich im Hinblick auf das Leben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Parallelen zwischen Drama und Flugblatt ziehen.
In seinem Flugblatt wird angesprochen, dass zu dieser Zeit keine Meinungen anderer zugelassen wurden, auch wenn es sich um die Wahrheit handelte, was auch in „Woyzeck“ deutlich wird, als Woyzeck sich unterordnet und den Aussagen seines Hauptmanns lediglich zustimmt (5. Szene).Jedoch ist in Woyzeck keine Rede von Zensur, die im Flugblatt hingegen indirekt angesprochen wird, da Tipps gegeben werden, mit denen die Verbreitung der Wahrheit, trotz Zensur, erfolgen kann
Der Hauptkritikpunkt des Sachtextes ist, dass die Reichen auf die Kosten der Armen leben und dass sie allgemein viele Privilegien den ärmeren Bevölkerungsschichten gegenüber haben.
So muss die arme Bevölkerung den ganzen Tag arbeiten, um die Familie ernähren zu können, so wie Woyzeck, der keine Zeit für seine Frau und seinen Sohn hat (4. Szene), weil er, neben seinem schlecht bezahlten Beruf, Nebenjobs, wie das Teilnehmen an einem gesundheitsschädigenden Experiment (8. Szene) und das Rasieren seines Hauptmannes (5. Szene) , absolvieren muss, um seiner Familie das Überleben zu ermöglichen.
Der Adel hingegen muss kaum arbeiten, sodass der Tambourmajor Zeit hat, um mit Marie zu tanzen (12. Szene), während Woyzeck teilweise abends noch arbeitet (4. Szene).dennoch mangelt es den oberen 10000 an nichts. Obwohl die Armen die hart arbeitende Bevölkerung bilden, wird deren Arbeit kaum gewürdigt, Woyzeck wird sogar vor den Studenten gedemütigt und so behandelt, als sei er nicht mehr als ein Versuchsobjekt (10. Szene), während der Tambourmajor, der weniger arbeitet, sogar Ansehen vom Prinzen erlangen kann (6. Szene). Dass sich der Adel als wertvoller ansah, wird ebenfalls durch die Arroganz des Tambourmajors (6./15. Szene) deutlich.
Die Ergänzungen durch Pastor Weidig und somit die Verbindung zur Bibel bringen etwas Religiöses mit sich und auch in „Woyzeck“ wird deutlich, dass Religion damals eine große Rolle spielte, als Marie in der Bibel Hilfe sucht (17. Szene).
Zusammenfassend kann man sagen, dass im Drama „Woyzeck“ die gesellschaftlichen Bedingungen erkennbar werden, unter denen dessen Autor laut seinem Flugblatt selbst gelebt hat. Es wird deutlich, dass die arme Bevölkerung nicht menschlich behandelt wurde, sowohl bezüglich der Bezahlung, als auch bezüglich des Umgangs mit diesen. Man hatte, wenn man als Kind einer armen Familie geboren wurde, keine Möglichkeit irgendwie Ansehen und ein lebenswertes Leben zu erlangen, es sei denn, man lässt sich, wie Marie, auf jemand Adeligen ein.
Analyse: Brief an die Familie
Der Sachtext „Brief An die Familie“ ist im Juli 1835 von Georg Büchner veröffentlicht worden und thematisiert die Aufgabe, die ein Dramatiker durch seine Stücke zu erfüllen hat.
Den vorliegenden Textauszug aus dem Brief Büchners beginnt er mit seiner Definition des Dramatikers. Er vergleicht die Rolle des „dramatische[n] Dichter[s]“ (Z.1) zunächst mit der eines Wissenschaftlers aus dem Bereich der Geschichte, indem er sagt ein Dramatiker sei „nichts als ein Geschichtsschreiber“ (Z.1 f.). Allerdings fährt er mit einer Einschränkung durch die adversative Konjunktion „aber“ (Z.2) fort, denn der Dramatiker stehe über dem Geschichtsschreiber (vgl. ebd.), da es bestimmte Unterschiede gibt, die er nun aufzählt und jeweils mit der Präposition „statt“ (Z.4) in Form einer Anapher einleitet. Während der Geschichtsschreiber eine „trockne Erzählung“ (ebd.), also eine bloße Wiedergabe der Fakten, gibt, ist es des Dramatikers Aufgabe, den Leser/Zuschauer des Dramas „in das Leben einer Zeit“ (Z.5) hineinzuversetzen. Außerdem soll er den Menschen „statt Charakteristiken Charaktere“ (Z.6) und „statt Beschreibungen Gestalten“ (ebd.) geben. Er muss also die Fakten eines historischen Ereignisses oder einer bestimmten Zeit in Form einer Geschichte und deren Charakteren, an denen das Leben zu dieser Zeit erkennbar werden soll, darstellen, während Wissenschaftler lediglich die Fakten aufzählen.
Obwohl das Leben in Form von einer Geschichte wiedergegeben werden soll, muss darauf geachtet werden, dass man „so nahe als möglich“ an die wahre Geschichte herankommt, was nur möglich ist, wenn die an der Realität orientierte Geschichte „weder sittlicher noch unsittlicher“ (Z.9) wiedergegeben wird, die Realität also nicht durch Verharmlosung oder Übertreibung verfälscht wird, auch wenn die Realität, die vom „lieben Herrgott“ (Z.10), hier ironisch zu verstehen, geschaffen wurde, sich nicht als „Lektüre für junge Frauenzimmer“ (Z.11) eignet. Durch diese Aussage Büchners wird zum einem klargestellt, dass wenn man realitätsnah schreibt keine Geschichte mit Happy-End entsteht, aber auch, dass der Autor von Mädchen denkt, dass diese die Realität nicht verkraften.
Des Weiteren wird gesagt, dass ein Dichter „kein Lehrer der Moral“ (Z.12) ist, da das Ziel sei, Geschichten und Charaktere zu erfinden, die vergangene Zeiten darstellen sollen (vgl. Z.12 f.), damit die Menschen „daraus lernen“ (Z.14) können. Den Bezug zum Geschichtsstudium stellt Georg Büchner durch den Vergleich her, dass man daraus lernen solle „wie aus dem Studium der Geschichte“ (Z.15), was die Ähnlichkeit der Berufe des Dramatikers und des Historikers erneut zeigt.
Für beide gilt, dass das Ziel nicht sein kann, Moral zu lehren, da auch im Geschichtsstudium „sehr viele unmoralische Ding“ (Z.18) erzählt werden, weil diese im realen Leben nun einmal vorkommen. Denn wenn man von dem Unmoralischem in der Welt nichts wissen wolle, müsse man „mit verbundenen Augen“ (Z. 19) umherlaufen und bei Gott darüber klagen, dass in seine Schöpfung so viele ungerechte und unmoralische Dinge integriert sind (vgl. Z. 20 f.).
Aus dem Grund, dass das Unmoralische, ebenso wie das Gute, ein Teil der Realität ist, will Büchner die Welt so darstellen wie sie ist, weil Gott sie „gewiss gemacht hat, wie sie sein soll“ (Z. 25 f.) und er sich von den „sogenannten Idealdichter[n]“ (Z.26 f.), die realitätsfern und lediglich über Idealvorstellungen schreiben, abgrenzen möchte. Diese bezeichnet er als „Marionetten“ (Z.28), was metaphorisch dafür steht, dass sie schreiben, was ihnen vorgegeben wird. Er schreibt diesen auch „himmelblau[e] Nasen“ (ebd.) zu, welche ebenfalls als Metapher dienen und die Gutgläubigkeit und den fehlenden Realismus dieser verbildlichen. Außerdem wirft er ihnen „affektierte[n] Pathos“ (Z.28 f.) vor, was so viel wie aufgesetzte Leidenschaft bedeutet und aussagt, dass ihre Werke lediglich der Darstellung der Realität, wie sie erwünscht wird, dient. Im Gegensatz zu Büchner sollen diese keine Charaktere erfinden, deren Gefühle oder Handeln Eindrücke hinterlassen (vgl. Z. 30 ff.). Am Schluss des Textausschnitts zieht Büchner das Fazit, dass er „sehr wenig auf Schiller“ (Z.32) halte, wodurch er ausdrückt, dass Schiller seiner Meinung nach zu den Idealdichtern zählt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Büchner die Dramatiker als Historiker beschreibt, die allerdings historische Fakten und das Leben in bestimmten Zeiten in erfundenen Geschichten und anhand erfundener Charaktere verbildlichen. Ihre Aufgabe ist es, den Menschen ein Gefühl zu geben, wie das Leben innerhalb bestimmter Epochen gewesen sein muss und somit sind sie verpflichtet realitätsnah zu schreiben, anstatt etwas zu harmlos oder zu extrem darzustellen. Seiner Meinung nach ist die Welt, wie sie ist, so von Gott gewollt, weshalb er nichts von den Dichtern hält, die die Realität verfälscht und idealistisch darstellen. Indem er Schiller als einen solchen Idealdichter bezeichnet, zeigt er, dass er sowohl ihn als Dichter, als auch seine Werke, nicht mag.
Effie Briest
Inhalt
- Die noch junge und kindliche Effi, Tochter aus der Adelsfamilie Briest aus Hohen-Cremmen, wird mit dem Ex-Freund ihrer Mutter, Landrat Innstetten, verheiratet
- Effi und Innstetten ziehen gemeinsam nach Kessin, wo Effi sich aufgrund des Spuks in ihrem Haus nicht wohlfühlt, was Instetten aber wenig interessiert
- 9 Monate nach der Hochzeit bekommt Effi ihre Tochter Annie - Um sich von der Angst abzulenken, nimmt Effi an den gemeinsamen Ausritten von Innstetten und Crampas teil
- Weil Instetten beruflich viel unterwegs ist, führt Effi die Ausritte alleine mit Crampas fort, welcher Interesse an ihr zeigt und Effi erzählt, dass Innstetten ein Erzieher sei und er soch den Spuk zunutze mache
- Als Effi und Innstetten an einer Schlittenpartie teilnehmen ist auch Crampas vertreten, mit dem Effi auf der turbulenten Rückfahrt alleine in einer Kutsche fahren, was zum Höhepunkt der Affäre führt
- Effi versucht das zu verheimlichen und ist froh als Innstetten beschließt nach Berlin zu ziehen, um seine Karriere zu fördern
- Effi hofft, dass sie die Affäre geheim halten kann, doch Innstetten findet geheime Briefe, die ihr Crampas geschickt hat, woraufhin Instetten Crampas zum Duell herausfordert, was für Crampas tödlich endet
- Innstetten trennt sich von Effi, woran auch er leidet
- Effi zieht mit der früheren Angestellten Roswitha in eine kleine Wohnung in Berlin
- Ihre Tochter Annie besucht sie, doch es wird schnell klar, dass Innstetten sie beeinflusst hat, was Effi krank macht
- Auch ihre Eltern distanzieren sich von ihr und verweigern, dass Effi bei ihnen einziehen kann
- Erst als der Arzt das für notwendig hält, zieht Effi zu ihren Eltern
- Dort scheint sich ihre Gesundheit zu bessern, doch sie stirbt trotzdem in jungen Jahren und wird im Rondell im Garten der Eltern, wo zuvor eine Sonnenuhr war, beerdigt
Analyse TA 19. Kapitel
Der Roman „Effi Briest“ ist von Theodor Fontane 1895 in der Epoche des Poetischen Realismus veröffentlicht worden und thematisiert die Bedeutung des Ansehens in der Gesellschaft im 19. Jahrhundert.
Im vorliegenden Textauszug kommt es zum Höhepunkt der Affäre von Protagonistin Effi Briest und Major Crampas, als sie zu zweit die Rückfahrt nach Kessin in einem Schlitten bestreiten und Effi die Angst überkommt.
Effi ist eine junge Frau, die sich teilweise kindisch verhält und mit dem Ex-Liebhaber ihrer Mutter, Baron von Innstetten verheiratet worden ist. Nach der Hochzeitsreise ziehen sie gemeinsam nach Kessin und bekommen ihre Tochter Annie. Effi fühlt sich in dem Haus aber nicht wohl, weil sie glaubt, dass es dort spuke. Innstetten scheint das aber wenig zu interessieren, was gemeinsam mit seinen häufigen Dienstreisen als Landrat dazu führt, dass Effi, weil sie sich einsam fühlt, Ausritte mit Crampas unternimmt, der offensichtlich an ihr interessiert ist und ihr auch erzählt, dass Innstetten den Spuk nutze, um sie zu erziehen. Als Innstetten und Effi eine Schlittenpartie bestreiten, ist unter anderem Crampas anwesend, der dann die Rückreise mit Effi bestreitet, was Auslöser der vorliegenden Situation ist.
Im Anschluss fällt es Effi schwer die Affäre geheim zu halten, weshalb sie sehr erleichtert ist, als Innstetten erzählt, dass sie nach Berlin ziehen werden, damit Innstetten einen Beruf im Ministerium ausüben kann.
Sechs Jahre später findet Innstetten allerdings Briefe, die Crampas Effi geschickt hat, wodurch die Affäre dennoch aufgedeckt wird. Um seinen Ruf nicht zu schädigen sieht er sich gezwungen Crampas zum Duell herauszufordern, bei dem Crampas stirbt, und sich von Effi zu trennen, auch wenn erweiß, dass er sich selbst dadurch mit ruiniert, weil er Effi sehr liebt.
Effi zieht mit Hausmädchen Roswitha in eine kleine Wohnung in Berlin und hat keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter. Beim ersten und einzigen Treffen der beiden wird schnell klar, dass Innstetten Annie so beeinflusst hat, dass sie sich von der Mutter distanziert, was Effi zusammenbrechen und krank werden lässt. Erst als der Arzt es für notwendig hält, kann Effi zu ihren Eltern zurück ziehen, die zuvor den Kontakt weitestgehend abgebrochen haben, nachdem sie von der Affäre erfahren hatten. Effis gesundheitlicher Zustand verbessert sich zwar vorerst, sie stirbt aber dennoch mit circa 30 Jahren und wird im Rondell im Garten der Eltern begraben, in dem Effi als junges Mädchen viel Zeit verbracht hat.
Zu Beginn der vorliegenden Textstelle wird bereits deutlich, dass Effi nicht genau weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll, da sie, als Crampas sich zu ihr setzen will, zunächst „unschlüssig“ (Z.1) ist. Das hätte von Crampas gegebenenfalls missinterpretiert werden können, doch er als „Frauenkenner“ (Z.5), hat Verständnis für ihre Reaktion, weil er versteht, dass sie die einzig richtige Reaktion auf diese Situation zeigt (vgl. Z. 6 f.). Obwohl Effi sich ein wenig unwohl fühlt, kann sie sich „seine Gegenwart [nicht] verbitten“ (Z. 7 f.), ihm die Anwesenheit also nicht verbieten. Die Rückfahrt verläuft zunächst wie „im Fluge“ (Z. 8), was metaphorisch für die hohe Geschwindigkeit des Schlittens oder aber für die Zeit, die gemeinsam schneller zu vergehen scheint, stehen kann.
Doch am anderen Ufer erwarten sie „dunkle Waldmassen“ (Z. 10). Sowohl das Adjektiv „dunkel“ (ebd.), als auch das Nomen „Masse“ (ebd.) sorgen für eine bedrückende Atmosphäre. Diese und die Tatsache, dass Innstetten, der im vordersten Schlitten sitzt, die Route durch diesen Wald wählt und somit auch die übrigen Schlitten durch diesen führt (vgl. Z.10 ff.), beunruhigen Effi zutiefst. Die Entscheidung diesen Weg zu nehmen könnte den Egoismus Innstettens zeigen, da dieser eigentlich wissen müsste, wie schreckhaft und ängstlich seine Frau ist.
Effi schreckt, wie zu erwarten war, zusammen (vgl. Z. 18 f), als auch ihr Schlitten den Weg über den „schmaleren Weg“ (Z. 17) wählt. Zusätzlich zum schmalen Weg sorgt auch die Waldmasse, welche mit dem Adjektiv „dicht“ (Z. 18) beschrieben wird, für ein bedrückendes und einengendes Gefühl.
Im Kontrast zum dunklen beengenden Wald stehen „Luft und Licht“ (Z. 19), welche Effi zuvor umgeben haben und für Freiheit und Leben stehen. Nun hat sie aber nur noch „dunkl[e] Kronen“ (Z. 20) „über“ (Z. 21) sich. Der Fakt, dass sie nicht nur neben sich, sondern auch über sich von den Bäumen umgeben ist, verstärkt die bedrückende Atmosphäre. Das „Zittern“ (ebd.) ist ihre erste Reaktion darauf, welche ihre Angst deutlich werden lässt.
Dass sie die Finger ineinander schiebt, „um sich einen Halt zu geben“ (Z. 22) zeigt, dass sie sich allein gelassen fühlt, weil Innstetten eben nicht da ist, um ihr Halt zu geben. In diesem Moment verfolgen sie wieder Bilder und Gedanken, was durch das Verb „jagen“ (Z. 22 f.) veranschaulicht wird. Dass Effi Halt braucht wird auch deutlich als sie „bete[t]“ (Z.25), dass Gott eine „Mauer“ (ebd.) um sie baue, welche sie schützen soll. Sie merkt aber schnell, dass diese Worte nichts bringen, dass sie „to[t]“ (Z. 27) sind. Diese Adjektiv stärkt erneut die Verdeutlichung der Angst Effis.
Die Antithese, dass sie sich „fürchte[t]“ (Z. 27), sich aber wie in einem „Zauberbann“ (Z. 28) fühlt, verdeutlicht ihre Unklarheit über ihre Gefühle in Crampas Nähe, da sie zwar weiß, dass es falsch ist, sich aber dennoch bei ihm wohler zu fühlen scheint.
Crampas spricht sie daraufhin „leis“ (Z. 30) mit ihrem Namen an, was Crampas fürsorglichen und behutsamen, aber auch verführerischen Umgang zeigt. Dass seine Stimme dabei „zitter[t]“ (Z. 31), könnte wiederum deutlich machen, dass er mit ihr fühlt.
Effi hält ihre Hände immer noch „geschlossen“ (Z. 32), was ihre Anspannung zeigt, aber auch dass sie sich Crampas gegenüber nicht weiter öffnen möchte. Dass Crampas diese Anspannung auflockern möchte, macht er deutlich, indem er „ihre Hand“ (Z. 31) nimmt und „die Finger“ (ebd.) löst. Diese küsst er (vgl. Z. 33), um seine Liebe auszudrücken, und dass die Küsse mit dem Adjektiv „heiß“ (Z. 32) beschrieben werden, bringt die Leidenschaft zum Ausdruck.
In diesem Moment verspürt Effi eine „Ohnmacht“ (Z. 33), welche als Metapher für die Schwäche steht, die sie in seiner Gegenwart überkommt.
Das anschließende Öffnen der Augen (vgl. Z.34) bringt das Ende der Angst mit sich, weil sie den Wald verlassen haben. Auch das „Gelaut der vorauseilenden Schlitten“ (Z. 35 f.) sorgt für eine beruhigende Atmosphäre. Dazu tragen auch die „kleinen Häuser“ (Z. 38) bei, die im Kontrast zu den „dunkle[n] Waldmassen“ (Z. 10) stehen, die Effi verängstigt haben.
Die Geschehnisse werden von einem auktorialen Er-/Sie-Erzähler erzählt, der die Gefühle von Effi, aber auch die Gedanken von Crampas kennt. Es handelt sich außerdem um eine Zeitraffung, da die Fahrt durch den Wald länger als eine Minute gebraucht haben wird. In der vorliegenden Textstelle wird zudem das Verhältnis zwischen Major Crampas und Effi deutlich: Crampas ist sehr interessiert an Effi und geht dementsprechend offensiv vor, während sich Effi eher zurückhält, da sie weiß, dass die Affäre unmoralisch ist. Dennoch mag sie Crampas und lässt die Affäre zu, da sie unter Einsamkeit leidet.
Abschließend kann man sagen, dass in diesem Romanauszug das Verhältnis zwischen Effi und Crampas den Höhepunkt erreicht, da es sehr leidenschaftlich zugeht. Der auktoriale Erzähler sorgt dafür, dass vor Allem die Gefühle und Gedanken, die Effi in dieser beängstigenden Situation durch den Kopf gehen, betont werden, aber auch die Gedankengänge von Crampas nachvollziehbar werden. Durch die Verwendung von Adjektiven und Metaphern, wie „dunkle Waldmassen“ wird außerdem die Atmosphäre, die Effi bedrückt und verängstigt hat, spürbar. Zuletzt kann man auch erkennen, dass Effi selber nicht wirklich weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll, da sie weiß, dass es falsch ist, Innstetten zu betrügen, ihr aber dennoch die Nähe zu Crampas gefällt.
Analyse TA 24. Kapitel
Der Roman „Effi Briest“ ist von Theodor Fontane 1895 in der Epoche des Poetischen Realismus veröffentlicht worden und thematisiert die Bedeutung des Ansehens in der Gesellschaft im 19. Jahrhundert.
Inhaltlich geht es in der vorliegenden Textstelle um einen Dialog zwischen Herrn und Frau von Briest, die sich darüber unterhalten wie Effi sich verhält und die Frage stellen, ob Effi glücklich sei.
Dieser Dialog kommt zustande, weil ihre Tochter Effi, welche von ihren Eltern als 17-jähriges Mädchen bereits mit einem früheren Liebhaber von Frau von Briest, Landrat Innstetten, verheiratet worden ist, nun nach einer gemeinsamen Reise mit Innstetten noch eine Woche bei ihren Eltern geblieben ist, während Innstetten bereits zurück nach Berlin gereist ist. Auch die Tochter Annie ist gemeinsam mit Effi in Hohen-Cremmen geblieben. Zu diesem Zeitpunkt weiß allerdings noch niemand von der Affäre, die Effi mit Major Crampas eingegangen ist.
In der Textstelle kommt die Sorge des Vaters zum Ausdruck, dass Effi nicht glücklich sei und keine Liebe empfinde zum Ausdruck, was sich im weiteren Verlauf des Dramas bestätigt, da die Affäre der beiden aufgedeckt wird, welche auch nur zustande gekommen ist, weil Effi in der Ehe unglücklich ist, da Innstetten aufgrund seines Berufs im Ministerium wenig Zeit für Effi hat, welche sich oft einsam fühlt und keine Zuneigung von Innstetten erfährt. Als die Affäre von Innstetten aufgedeckt wird, informiert er die Eltern, was zur Folge hat, dass Effi sowohl von Innstetten, der Effi immer noch liebt, sie aber verstoßen muss um sein Ansehen nicht zu gefährden, als auch von ihren Eltern abgelehnt wird. Außerdem tötet Innstetten Crampas im Verlauf eines Duells. So zieht Effi mit der ehemalig gemeinsamen Haushälterin Roswitha in eine Wohnung in Berlin, wo Annie sie lediglich einmal besuchen kommt, aber so erzogen wurde, dass sie sich Effi gegenüber sehr distanziert verhält. Das alles belastet Effi so sehr, dass sie krank wird, sodass Effi wieder zu ihren Eltern zieht. Dort scheint sich ihr Gesundheitszustand zwar zu bessern, aber sie stirbt dennoch in jungen Jahren und wird unter dem Rondell im Garten der Eltern begraben.
Die Textstelle beginnt durch die Rückfrage des Vaters an seine Frau, wie sie Effi fände (vgl. Z.4), welche zu Beginn schon mögliche Sorgen des Vaters zum Ausdruck bringt.
Frau von Briest antwortet allerdings, dass Effi so sei „wie immer“ (Z. 5), was entweder zeigt, dass sie sich keine Sorgen macht oder nicht über das Thema sprechen möchte. Sie ist froh eine so „liebenswürdige“ (Z. 6), „dankbar[e]“ (ebd.) und „glücklich[e]“ (Z.7) Tochter zu haben. Dass Effi glücklich sei, wieder „unter [ihrem] Dach zu sein“ (Z. 7 f.), zeigt, dass Effi sehr an ihrer Heimat und dem Elternhaus hängt, weil sie eben noch sehr jung ist und die Nähe zu ihren Eltern immer noch zu brauchen scheint. Unter ihrem Dach sein (vgl. ebd.) ist eine Metapher beziehungsweise ein pars pro toto, welches für das Elternhaus und somit die Nähe und den Schutz der Eltern steht.
Herrn von Briest ist sie noch zu sehr kindlich (vgl. Z. 9), weil sie sich verhalte „als wäre dies hier immer noch ihre Heimstätte“ (Z. 10f.). Durch den Konjunktiv drückt er aus, dass das Haus eben nicht mehr ihre Heimat darstellen soll, da Effi mittlerweile erwachsen geworden sein müsste und „doch den Mann und das Kind“ (Z. 11) hat, auf die sie den Fokus legen soll, anstatt ständig die Nähe zu ihrem Elternhaus und somit ihrer Kindheit zu suchen. Er bezeichnet den Mann als „Juwel“ (Z. 11f.), was zeigt, dass Briest ihn schätzt, aber ihn auch auf das Ansehen und den Wohlstand reduzieren könnte, sodass das Menschliche fehle. Das Kind hingegen bezeichnet er als „Engel“ (Z. 12), was eindeutiger ist und das Annie so als liebenswürdig und himmlisch beschreibt. Auch wenn sie Mann und Kind hat, scheint es ihm so, als sei für sie das Elternhaus in Hohen-Cremmen immer noch die „Hauptsache“ (Z. 13), also die Priorität in ihrem Leben. Deshalb empfindet er es als käme ihre neue Familie gegen die Eltern nicht an (vgl. Z. 13f.), was daran liegt, dass Effi eine „zu sehr“ (Z. 15) prächtige Tochter sei. Das soll heißen, dass sie zwar eine tolle Tochter ist, weil sie ihren Eltern viel Aufmerksamkeit schenkt, aber der Rolle als Mutter noch nicht gewachsen zu sein scheint, was Briest „ängstigt“ (ebd.).
Auf Briests Frage, wie es damit stehe, antwortet seine Frau Luise mit der Rückfrage, was er meine (vgl. Z.18), was zeigt, dass sie aneinander vorbei reden und vielleicht auch Probleme in der eigenen Ehe vorliegen.
Briest entgegnet ihr, sie wisse, was er meine und stellt rhetorische Fragen, ob sie glücklich sei oder ob da etwas im Wege sei (vgl. Z.19f.), um sie dazu zu animieren sich darüber Gedanken zu machen oder um deutlich zu machen, dass er wisse, dass Effi ihr ihre Gedanken anvertraue und sie somit etwas wissen müsse. Briests Zweifel werden deutlich, da er „[v]on Anfang an“ (Z.20) geglaubt hat, dass Effi Innstetten „mehr schätze als liebe“ (Z. 21), ihn also aus Streben nach Ansehen und Respekt und nicht aus Liebe geheiratet habe, was „in [s]einen Augen“ (Z.21f.), eine Metapher für die eigene Meinung, schlimm sei, da eine Ehe, die nur aus Respekt geführt wird „gewiss nicht“ (Z. 23) lange halten könne. Da Briest meint wissen zu können, wie Frauen sich in solchen Situationen fühlen und verhalten, könnte man meinen er spreche aus Erfahrung, was auch Luise sofort auffällt.
Sie fragt, ob er sowas schon einmal selber erfahren hätte (vgl. Z. 26), was zeigt, dass sie den Bezug zur eigenen Ehe bemerkt hat. Durch die Metapher „schrauben wir uns nicht weiter“ (Z. 28) zeigt Briest, dass er keinen Streit verursachen will, indem sie jetzt auf die eigene Ehe zu sprechen kommen. Er fragt wieder wie es stehe (vgl. Z. 29), um wieder auf Effi und Innstetten zu lenken.
Frau von Briest scheint das zu nerven, da es Briest nicht reiche ein „Dutzend Mal“ (Z. 31) über dieses Thema gesprochen zu haben, was eine Hyperbel sein könnte. Sein „Alles-wissen-wollen“ (Z. 33), also seine Neugierde, stört sie ebenso wie die Naivität (vgl. Z.33), dass sie „in alle Tiefen sähe“ (Z.34), was metaphorisch für das Verstehen von Effis Gedanken und Gefühlen steht. Indem sie die Naivität mit dem Adjektiv „schrecklich“ (Z. 33) beschreibt, verdeutlicht sie, wie sehr sie diese Eigenschaft ihres Mannes verabscheut. Sie hinterfragt, ob er glaube, dass „alles so plan daliegt“ (Z. 36), eine Metapher dafür, dass die Gefühle von Effi offensichtlich seien, oder dass sie „ein Orakel“ (Z. 36 f.) sei, also etwas vorausahnen könne oder ob sie die „Wahrheit sofort klipp und klar in den Händen halte“ (Z.38f.), was ebenfalls eine Metapher ist und verbildlichen soll, ob er glaube, dass sie mächtig sei, die Antworten auf alle Fragen sofort zu erkennen, „wenn Effi ihr Herz ausgeschüttet hat“ (Z. 39), was metaphorisch für das Ausdrücken von Gefühlen steht. Luise hinterfragt außerdem diesen Ausdruck des Ausschüttens, da das Eigentlich zurück bleibe, weil Effi auch ihr nicht ihre Geheimnisse anvertrauen würde (vgl. Z. 40 ff.), weil sie „eine sehr schlaue kleine Person“ (Z. 43) sei. Eben das sei „umso gefährlicher, weil sie so sehr liebenswürdig ist“ (S. 182, Z. 1f), da sie so unschuldig scheint, aber in der Lage ist unschöne Dinge zu verheimlichen. Außerdem wisse sie, dass Effi „voll Herzensgüte“ (Z. 4) sei, aber sonst sei sie sich nicht sicher (vgl. Z.4f.). Sie glaubt, „sie hat einen Zug“ (Z. 5), eine Eigenschaft, „den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen“ (Z. 5), was soviel bedeutet, dass sie sich denkt, Gott wäre gut und „werde wohl nicht allzu streng mit ihr sein“ (Z. 6f.). Das Adjektiv „lieb“ (Z. 5f.) ist in dem Fall ironisch zu verstehen, da Gott eben nicht immer lieb ist, sondern auch strafend agiert. Dadurch wird deutlich, dass Effi ein unmoralisches Leben führen könnte, in der Hoffnung, dass sie nicht bestraft werde, also ohne sich besonders viele Gedanken über ihre Taten zu machen.
Eine Erzählperspektive gibt es in dem vorliegenden Textauszug nicht wirklich, da es sich um einen Dialog handelt, der lediglich in Zeile neun durch einen neutralen Er-/Sie-Erzähler moderiert wird. Die direkte Rede sorgt für eine zeitdeckende Zeitgestaltung, was dafür sorgt, dass es sich so anfühlt, als würde man dem Gespräch realitätsgetreu lauschen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in dem vorliegenden Gespräch deutlich wird, dass der Vater besorgt ist und von Anfang an Zweifel daran hatte, ob es richtig ist, Effi mit jemandem zu verheiraten, den sie nicht liebt. Diese Zweifel überkommen ihn, weil Effi immer noch sehr kindlich ist und die Nähe zu ihren Eltern sucht, was das Gefühl vermittelt, dass sie noch nicht bereit ist unabhängig zu leben. Außerdem deutet sich an, dass auch in der Ehe von Herrn und Frau Briest nicht unbedingt alles in Ordnung ist, da Briest der Meinung zu sein scheint, dass Luise ihn nicht lieben würde, was auch verständlich ist, da sie sich damals vermutlich nur gegen Innstetten entscheiden hat, weil Briest bereits über Ansehen und Geld verfügte. Briest glaubt, dass Effi seiner Frau alles anvertrauen würde, doch das ist nicht so, weshalb Luise der Meinung ist, Effi würde etwas verheimlichen und dass sie sich nicht immer so gut sei, wie sie scheint. Zuletzt ist zu sagen, dass der Dialog zeitdeckend in direkter Rede wiedergegeben wird.
Vergleich Effi-Marie
Im Folgenden werde ich die Figur Effi, Hauptfigur des Romans „Effi Briest", 1894 von Theodor Fontane in der Epoche des Poetischen Realismus veröffentlicht, mit Marie, Nebenfigur des Dramas „Woyzeck", welches 1879 veröffentlicht und von Georg Büchner in der Epoche des Vormärz geschrieben worden ist, vergleichen.
Obwohl es sich um Schriftstücke aus verschiedenen Epochen und auch Gattungen der Literatur – „Effi Briest“ als Werk der Epik, „Woyzeck“ als Werk der Dramatik- handelt, lassen sich trotz einiger Unterschiede auch Gemeinsamkeiten feststellen. Der größte Unterschied sind wohl die Lebensverhältnisse der beiden Figuren. Während Effi als Tochter der Familie von Briest in einem „Herren[haus]“ (S.5, Z.2) geboren wird, sind Marie und ihr Freund Woyzeck Teil der „arme[n] Leut" (4. Szene).
Eine Gemeinsamkeit der beiden Frauen ist, dass sie beide ein Kind haben, doch ein Unterschied ist, dass Maries Sohn Christian „ein Kind, ohne den Segen der Kirche" (5. Szene), also ein uneheliches Kind ist. Das ist in den Augen der damaligen Gesellschaft unmoralisch, weshalb Marie wenig Ansehen genießt.
Effi hingegen hat sich mit dem früheren Liebhaber ihrer Mutter, Landrat Innstetten, „verlobt" (S. 15, Z. 2) und diesen auch geheiratet, bevor die Tochter Annie geboren wurde.
Obwohl Effi mit einem hoch angesehenen Mann verheiratet ist, ist sie unglücklich in ihrer Partnerschaft, weil Innstetten kein Verständnis für ihre Angst im gemeinsamen Haus zeigt und diese als „Lächerlichkeit“ (S. 67, Z. 14) bezeichnet. Außerdem konnte Innstetten oft keine Zeit mit Effi verbringen, da er beruflich, wie beispielsweise aufgrund einer „Wahlkampagne" (S. 109, Z. 17) oft unterwegs ist. Ein weiterer Aspekt, der von Herrn von Briest erwähnt wird, ist, dass sie ihn „mehr schätze als liebe" (S. 181, Z. 21), ihn also aus Streben nach Karriere und Ansehen und nicht aus Liebe geheiratet hat.
Marie fehlt es ebenfalls an Aufmerksamkeit, da ihr Freund keine Zeit für sie und Sohn Christian hat (vgl. 4. Szene), da er neben seinem Job auch noch entwürdigende Nebenjobs absolviert, welche ihn krank machen, nur damit er seine Familie ernähren kann. Weitere Gründe sind fehlendes Ansehen und Armut sind, weshalb sie sich auf den angesehen Tambourmajor einlässt und, aus Verzweiflung wegen der eben genannten Gründe, eine Affäre eingeht (vgl. 6. Szene).
Auch Effi geht eine Affäre ein, die vor Allem aufgrund der Einsamkeit zustande kommt. Effis Affäre ist Major Crampas, der ihr zur Seite steht als sie sich einsam fühlt und sich fürchtet (vgl. S. 136).
Ein Unterschied dabei ist, dass Maries Affäre angesehener als der eigene Partner ist, während Crampas nicht so hoch angesehen ist wie Innstetten.
Sowohl Effi, als auch Marie wissen, dass die Affäre unmoralisch ist, sodass Marie sogar aus Reue „in der Bibel" (17. Szene) nach Hilfe sucht.
Eine letzte Gemeinsamkeit ist, dass die Aufdeckung der Affäre in beiden Fällen schlimme Folgen nach sich zieht. Woyzeck sticht, nachdem er die Affäre aufgedeckt hat, in einem Wald so oft mit einem Messer auf Marie ein, bis sie „tot" (20. Szene) ist. Effi hingegen wird nicht direkt durch den Ex-Mann sterben, ihre Affäre hingegen schon. Nachdem Innstetten Briefe von Crampas an Effi fand, fordert er ihn zum Duell heraus, welches für Crampas tödlich endet. Er trennt sich von Marie und verbietet ihr vorerst den Kontakt zur gemeinsamen Tochter Annie, welche sich auch beim ersten Wiedersehen sehr distanziert verhält (vgl. S. 232), was Effi krank werden lässt, sodass auch sie als junge Frau, indirekt, an den Folgen der Affäre starb.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede der beiden Figuren gibt. Obwohl die Herkunft und der Stand in der Gesellschaft unterschiedlich sind, sind beide Figuren unglücklich in ihrer Partnerschaft und gehen daher eine Affäre ein, die für beide schlimme Folgen hat. Im Endeffekt sterben beide Frauen an den Folgen der Affäre, jedoch stirbt Marie direkt daran, weil Woyzeck sie umbringt, während Effi an der auf die Affäre folgenden Krankheit stirbt.
Analyse
Die vorliegende Textstelle ist ein Auszug aus dem Roman „Effi Briest“, welcher von Theodor Fontane in der Epoche des poetischen Realismus geschrieben und 1895 veröffentlicht worden ist, und thematisiert die Bedeutung des Ansehens in der Gesellschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Effi Briest ist ein junges Mädchen, welches das Abenteuer liebt und sich auch sehr kindlich verhält, was dafür sorgt, dass sie in der schon mit 17 Jahren geschlossenen Ehe mit dem Ex-Liebhaber ihrer Mutter, Landrat Innstetten, der anschließend Vater einer gemeinsamen Tochter wird, nie richtig glücklich wird. Zwar ist ihr das Ansehen selber sehr wichtig, doch da Innstetten wegen seines Berufes kaum Zeit für Effi findet, wird das Leben in der Ehe Effis Wunsch nach Abenteuer nicht gerecht. Während Innstetten geschäftlich unterwegs ist, trifft Effi sich mit Major Crampas, der ihr Aufmerksamkeit schenkt und mit ihr Ausritte unternimmt. Auf einer Kutschfahrt erreicht die Affäre, welche Effi geheim halten will, ihren Höhepunkt. Wegen eines neuen Jobs im Ministerium für Innstetten, zieht die Familie nach Berlin und Effi ist erleichtert, dass sie so der Affäre aus dem Weg gehen kann. Als Innstetten den Familienurlaub wegen seines Jobs frühzeitig beenden muss, besucht Effi mit Tochter Annie und dem Kindermädchen Roswitha ihr Elternhaus in Hohen-Cremmen, welches sie sehr vermisst, da sie noch sehr an ihren Eltern und ihrer Kindheit hängt. So kommt es zur zu analysierenden Textstelle, in welcher sich Effi in ihrem früheren Kinderzimmer aufhält. Im Anschluss entdeckt Innstetten in ihrem neuen Haus in Berlin Briefe von Crampas an Effi, woraufhin er Crampas in einem Duell erschießt und sich von Effi trennt, welche, von den Eltern und der eigenen Tochter verstoßen, erkrankt, schon als junge Frau verstirbt und letztendlich im Garten der Eltern begraben wird.
In der vorliegenden Textstelle wird zunächst Effis früheres Kinderzimmer im Elternhaus beschrieben , welches „nach dem Garten hinaus“ (Z.1) liegt, in dem sie den größten Teil ihrer Kindheit verbracht hat, indem sie dort beispielsweise geschaukelt hat. Effi sucht auch heute noch das Abenteuer, was durch die Verbindung des Zimmers mit dem Garten verdeutlicht wird. Roswitha und Annie bewohnen ein anderes Zimmer, während Effi alleine in ihrem Zimmer nachdenkt.
Auch wenn sie nun wieder vorübergehend bei ihren Eltern ist, gelingt es ihr nicht so richtig die Affäre auszublenden, was an ihrem Verhalten, dass sie „auf und ab“ (Z.3) geht, deutlich wird. Dieses Verhalten zeigt, dass sie nervös ist, möglicherweise aufgrund eines schlechten Gewissens, oder auch dass sie sich eingeengt fühlt, da sie zwar den „Garten“ (Z.1), welcher eine Metapher für ihre Kindheit ist, durch die geöffneten Fenster (vgl. Z. 3) sehen kann, sich aber nicht in ihm aufhalten kann, also nicht mehr in ihre Kindheit zurück fliehen kann. In Effis Zimmer hängen Bilder mit kriegerischen Motiven (vgl. 8 f.), welche „in schmale Goldleisten“ (Z. 7) eingerahmt sind, was zum einen den Wohlstand der Familie von Briest zeigt, aber auch verdeutlicht, dass die Gesellschaft Kriege sehr ehrte und stolz darauf war. Effi hingegen „kann so was Kriegerisches nicht leiden“ (Z.10 f.), was wieder ihre kindliche Art zeigt, da sie nicht reif genug ist, um Krieg als Teil der Realität zu akzeptieren. Das „Kriegerisch[e]“ (Z. 10) könnte auch auf Crampas bezogen sein, welcher im Militär tätig ist. Sie sagt, dass sie andere Bilder möchte, wenn sie wieder bei ihren Eltern sei (vgl. 9 f.), was eine Vorausdeutung auf die Trennung von Innstetten sein könnte, da Effi ihre letzten Tage im Elternhaus gelebt hat, nachdem er sich von ihr getrennt hat.
Effi schließt „das eine Fenster und setz[t] sich an das andere“ (Z. 11), um den Fokus wieder auf den Garten, also ihre Kindheit, zu legen. Die erlebte Rede des Erzählers, dass ihr „das alles so wohl [tut]“ (Z.12) zeigt, dass Effi eine schöne Kindheit hatte, nach welcher sie sich sehnt. Dass der Erzähler das weiß, ist ein Zeichen dafür, dass es sich um einen auktorialen Erzähler handelt.
Nun wird der Fokus der Raumbeschreibung auf den Garten gelegt, was durch das Mondlicht (vgl. Z. 13), welches den Garten erhellt, verdeutlicht wird. Dort befindet sich auch die „Sonnenuhr“ (Z.13), welche über den ganzen Roman als Metapher für das Leben Effis steht, da diese nach Effis Tod durch ihr Grab ersetzt wird. Dass dort „neben den Schattenstreifen […] weiße Lichtstreifen [liegen]“ (Z. 14 f.) stellt dar, dass es neben den schlechten Dingen auch gute gibt, was die Gedanken Effis verbildlichen könnte. Dass die weißen Streifen so weiß sind, „als läge Leinwand auf der Bleiche“, soll in Form eines Vergleichs darstellen, wie hell diese sind und könnte so darstellen, dass die schönen Zeiten im Leben sehr schön waren und vielleicht sogar überwiegen.
Andererseits könnte der Lichtkontrast aber auch die zwiespältige Gefühlslage Effis zeigen, welche durch die adversative Konjunktion "aber" (Z. 15) betont werden.
Dennoch stehen dort die Rhabarberstauden, welche in ihrer Kindheit schon dort standen, aber nun „herbstlich gelb“ (Z.16) sind, was eine Metapher für die Vergänglichkeit ist und somit auf die vergangene Kindheit oder sogar auf baldigen Tod anspielen könnte. Diese Vergänglichkeit wird zuletzt noch einmal durch die Zeitraffung (vgl. Z. 17 ff.) unterstützt, da die vom Erzähler durch die Innensicht wiedergegebenen Gedanken an die letzten „zwei Jahre“ (Z. 17), in nur vier Zeilen zusammengefasst werden. Der kurzgefasste Rückblick kann außerdem dafür stehen, dass die Ehe, in der Effi unglücklich ist, zu überhastet eingegangen worden ist.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in der vorliegenden Textstelle besonders die Raumbeschreibung des Zimmers und des Gartens eine große Rolle spielen. Der Garten hat für Effi eine besondere Bedeutung, weil er Symbol ihrer sorglosen Kindheit ist und sie sich seitdem kaum verändert hat. Außerdem kann man dieser Textstelle Vorausahnungen auf die Trennung und den Tod Effis entnehmen. Zusätzlich zur Raumgestaltung wird auch die Zeitgestaltung in Form der Zeitraffung zur Verdeutlichung der Vergänglichkeit genutzt.
Untersch. Erzähltexte aus untersch. hist. Kontexten
1. Analyse
Der vorliegende Sachtext „Zwischen Fremdbestimmung und Selbstbefreiung – Zur Deutung einer Emanzipation“ , von W. Pütz verfasst, thematisiert eine Kraft religiösen Ursprungs, welche zur Emanzipation führt.
Zu Beginn des Sachtextes (Z. 3-11) wird die Situation aus „Die Marquise von O…“ von Heinrich von Kleist erläutert, auf welche Frickes Zitate sich im Folgenden beziehen. Er bezieht sich auf die Marquise, die, um den Ruf der Familie zu wahren, aufgrund ihrer unehelichen Schwangerschaft „von ihren Eltern verstoßen wird“ (Z. 4). Diese Szene ist entscheidend für die Novelle, da sich die Marquise weiterentwickelt und stärker wirkt, sodass „sie sich erstmals heftig der Autorität ihres Vaters [widersetzt]“ (Z. 5), welchem sie sich zuvor noch unterworfen hat. Diese Situation „weckt in ihr den ‚Stolz der Unschuld‘ “, was eine Personifikation ist, welche verbildlichen soll, dass in ihr ein Gefühl von Stolz ausgelöst wird, welches zuvor verborgen gewesen ist. Dieser Stolz „hebt sie ‚plötzlich, wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe […] empor‘ “ (Z. 9 ff.), was ebenfalls eine Personifikation ist, welche aussagt, dass diese Kraft sie aus einer schlechten Zeit, metaphorisch dargestellt durch die „Tiefe“ (Z. 10), befreit. Der Vergleich, dass dies „ ‚wie an ihrer eigenen Hand‘ “ (Z. 9) geschieht, zeigt, dass sie selbstständig Kraft schöpft, sich der Situation zu stellen und sich dem Vater zu widersetzen. Dass „ ‚das Schicksal sie herabgestürzt hatte‘ “ (Z. 10) verdeutlicht noch einmal die Unschuld der Marquise und die Ungerechtigkeit, die sie durch den Ausschluss aus der Familie erfährt. In dieser Einordnung in das Thema werden Zitate aus „Die Marquise von O...“ verwendet, um die Situation, die thematisiert wird, deutlich zu machen.
Der nächste Abschnitt (Z. 12-14) dient der Äußerung der These durch Fricke, welcher „diesen menschlichen Akt der Selbsterhebung als religiös motiviertes Geschehen“ (Z. 12f.) deutet.
Der folgende Paragraph (Z. 15-20) thematisiert das Verhältnis zwischen Unschuld und Reinheit und der Wirklichkeit., welche sich gegenüberstehen, wobei die Wirklichkeit zeigt, ob die Reinheit behalten werden kann oder verloren geht (vgl. Z. 18f.). Im Fall der Marquise „zeugt [sie] unwidersprechlich, dass sie verloren ist“ (Z. 19f.), da die Wirklichkeit zu sein scheint, dass die Marquise bewusst ein uneheliches Kind gezeugt hat, sodass diese ihre Unschuld und Reinheit verliert. Die Personifikation, dass die Wirklichkeit „zeugt“ (ebd.), stellt diese als Richter dar, welcher über die Reinheit urteilt.
Im nächsten Sinnabschnitt (Z. 21-30) werden die Folgen für ihre Beziehungen angesprochen. Zunächst bezeichnet Fricke das Mutter-werden als „das höchste Glück“ (Z. 21), was deutlich macht, dass es etwas besonders Schönes ist Mutter zu werden. Indem er das aber auch als „Bestimmung des Weibes“ (Z. 22) bezeichnet, wird auch das damalige Bild der Frau deutlich, deren Hauptaufgabe das Gebären von Kindern war. In diesem Fall bedeute die Schwangerschaft jedoch die „Vernichtung“ (Z. 23), was eine Antithese ist, die noch einmal verdeutlicht, was es für eine Schande gewesen ist, wenn man ein uneheliches Kind zur Welt bringen wird. Da jeder Erklärungsversuch unvorstellbar ist (vgl. Z. 26ff.), kommt es zur „Zerstörung des Verhältnisses der Marquise zu den Ihren“ (Z. 24f.), aber auch zur Zerstörung des Verhältnisses zu sich selbst und zu Gott (vgl. Z. 25f.). Religion scheint also zu der Zeit eine große Rolle gespielt zu haben.
Ein weiterer Abschnitt (Z. 31-47) behandelt die Reaktion der Marquise auf diese Situation und wie sie sich weiterentwickelt. Sie durchlebt eine schwere Zeit, in der alles wie das „Spiel eines teuflischen Dämons“ (Z. 32), eine Metapher dafür, dass sie Opfer einer bösen Macht ist, scheint. Von der „Gewalt der Tatsachen“ (Z. 34), was metaphorisch für die Eindeutigkeit steht, bezwungen, müssen sich die Eltern aus gesellschaftlichen Gründen von ihr abwenden. Die Wirklichkeit wird zur „vernichtenden Anklage“ (Z. 36), weil ihre Tat offensichtlich scheint, doch in dem Moment „bricht eine Kraft [aus ihr] hervor“ (Z. 37f.). Das Hervorbrechen zeigt die Stärke der Kraft, die „sich stärker erweist als die ganze furchtbare Wirklichkeit“ (Z.40). Die Marquise wirkt stärker, was Fricke darauf zurückführt, dass sie merkt, dass die „unzerstörbare Einheit mit sich und mit Gott [in ihr lebt]“ (Z. 42f.). Dieses Gefühl, durch den Glauben an Gott und an die eigene Unschuld „trägt [sie]“ (Z. 44) und zieht sie aus der Tiefe empor (vgl. Z.46f.). Diese Personifikationen dienen der Veranschaulichung davon, wie sehr ihr das Bewusstsein der eigenen Unschuld in dieser Situation hilft. Dass das, wie schon zuvor analysiert, „wie an ihrer eigenen Hand“ (Z. 46) geschieht, zeigt eben die Emanzipation und dass die Marquise selbstbewusster und entschlossener wird, sodass sie sich der Wirklichkeit widersetzt.
Der nächste Sinnabschnitt (Z.49-68) handelt von Kleist und der Entstehung der Kraft. Fricke bezeichnet Kleist als „einen heroischen Menschen“ (Z. 50f.), der „das heroische Zeitalter als die ideale Jugend der Menschheit“ (Z. 51f.) angesehen hat und bezieht sich dabei auf „Boeckmann“ (Z. 49) und dessen Studien. Diese Charakterisierung Kleists soll in „Die Marquise von O…“ deutlich werden, weil die Marquise sich „in völliger Einsamkeit [und] in tödlichem Widerspruch mit [ihrem] Schicksal“ (Z.54f.) aufrecht hält. Sie steht ihrem Schicksal „Auge in Auge“ (Z. 59) gegenüber, eine Metapher der Konfrontation und überwindet es, „ohne sich darüber erheben zu können“ (Z. 59f.). Sie kann dem Schicksal zwar nicht entkommen, zeigt aber dadurch Stärke, dass sie es annimmt, ohne es zu akzeptieren. Diese Kraft muss laut Fricke religiösen Ursprungs sein, weil sie so stark ist, dass sie durch Psychologie nicht erklärt werden kann (vgl. Z. 60ff.). Diese Kraft soll aus der „absolut-konkreten und absolut-substantiellen Einheit des Ich mit dem ewigen Soll seiner Existenz“ (Z.64f.) stammen. Damit ist die Überzeugung, nichts falsch gemacht zu haben, gemeint. Die Kraft wird als „weltüberwinden[d]“ (Z. 66) bezeichnet, was die Stärke noch einmal verdeutlicht.
Die Besonderheit des Gefühls, welches verbunden mit Kleist als „Kleistsch[e] Frömmigkeit“ (Z. 70) bezeichnet wird, wird im letzten Abschnitt (Z. 69-78) deutlich: Es überwindet „die Tragik […] durch den Glauben“ (Z. 74). Man ist also in der Lage durch den Glauben an Gott und sich selbst alle Probleme zu überwinden, was auch der Marquise gelingt. „[W]eil auch sie aus Gottes Hand kommt“ (Z. 77f.), eine Metapher dafür, dass er sie geschaffen hat, unterwirft sie sich im Glauben an Gott der Wirklichkeit, auch wenn sie „mehr des Teufels als Gottes Züge trägt“ (Z. 76f.). Obwohl das, was ihr passiert, sehr negativ für sie ist, glaubt sie an Gott und an ihre eigene Unschuld, was sie stark und stolz werden lässt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Kleist ein heroischer Mensch ist, der in „Die Marquise von O…“ die Emanzipation thematisiert. Die Marquise zeigt dabei die Entwicklung einer Kraft, die durch den Glauben an Gott und sich selbst erlangt werden kann. Durch diese Kraft ist der Mensch in der Lage mit Schicksalsschlägen umzugehen und über sich hinauszuwachsen. Es wird die Bedeutung des Glaubens im Leben zur damaligen Zeit deutlich und auch wie er Menschen verändern kann.
2. Anaylse
Der vorliegende Sachtext „Zur Darstellung der Vater-Tochter-Beziehung“, von Wolfgang Pütz verfasst und zu einem unbekannten Datum veröffentlicht, thematisiert die Vorgehensweise Kleists bei der Darstellung der Vater-Tochter-Beziehung in seiner Novelle „Die Marquise von O…“ aus dem Jahr 1808.
Zu Beginn des Textes erläutert Pütz die Meinung Heinz Politzers, eines Schriftstellers, auf welchen er sich bezieht und welchen er im Folgenden zitiert. Dieser meint, dass bei der Beziehung zwischen der Marquise und ihrem Vater „der Fall einer inzestuösen Beziehung vor[liege]“ (Z. 2f.), welche „unerhör[t]“ (Z. 4) sei, weil es auch damals schon verwerflich gewesen ist, eine so intime Beziehung zu seiner Tochter zu pflegen.
Besonders deutlich wird das in der Szene der Versöhnung zwischen Vater und Tochter, in welcher die „Schamlosigkeit“ (Z.8) deutlich wird, die Kleist wohl beim Schreiben gehabt haben muss. Diese sei „ohne Vorbild“ (Z.6) und auch „in seinem Werk ohne ihresgleichen“ (Z. 7). Somit verdeutlicht Politzer, wie unüblich die Darstellung solcher Szenen gewesen ist und dass auch Kleist selbst nur einmal so etwas verschriftlicht hat. Indem Politzer jene Schamlosigkeit aber als „subli[m]“ (ebd.) bezeichnet, macht er deutlich, dass diese nur schwer wahrzunehmen sei, also durch den Sprachgebrach und die Vorgehensweise Kleists bei der Darstellung dieser Szene gut versteckt worden ist, sodass er sie „[v]or aller Peinlichkeit“ (Z.7f.) bewahrt habe. Dazu trage der „fiebernde Atem“ (Z. 8) bei, was metaphorisch für die erzeugte Spannung, durch die Vorgehensweise Kleists erzeugt, stehen kann und welcher am Erzähler erkennbar gemacht wird, indem Kleist diesen Worte auslassen oder den falschen Kasus verwenden lässt (vgl. Z. 9ff.).
Zudem verwende er „ins Maßlose übersteigert[e] Sprache“ (Z. 13f.), um die Szene zu „instrumentier[en]“ (Z. 15), was eine Metapher dafür ist, dass er, wie in einem Orchester, die verschiedenen Komponenten so aufeinander abstimmt, dass daraus diese Szene entsteht. Dadurch könnte Politzer auch ausdrücken, dass Kleist sein Werk so künstlerisch gestaltet wie ein Komponist. Sein Sprachgebrauch hebe sich über das chronikalischen Deutsch hinweg (vgl. Z. 16), was ihn „zum großen Manieristen“ (ebd.) mache, als den ihn Ludwig Tieck durchschaut habe. Somit sei Kleist eine Person gewesen, die sich durch einen eigenen Schreibstil von anderen absetzen wollte. So habe er eine Umarmung in einem Gedankenstrich verschwiegen (vgl. 19ff.), aber anschließend „Detail an erotisches Detail [gefügt]“ (Z. 23). Das ist eine von mehreren Antithesen die den Schreibstil Kleists in dieser Szene hervorhebt.
Eine weitere Antithese ist, dass das, was normalerweise von Zensur betroffen sei, in dieser Szene mit „nackter Leidenschaftlichkeit [ausbreche]“ (Z.25). Das Adjektiv „nack[t]“ (ebd.) ist hier eine Metapher für die Direktheit Kleists und dafür, dass er die Handlung nicht verschleiert. Das Verb „aus[brechen]“ (ebd.) verdeutlicht noch einmal wie außergewöhnlich Kleists Darstellung für die Zeit, aber auch für ihn selbst gewesen ist und dass sie somit nicht der Regel entspricht.
Doch Kleist spricht nicht nur solch verbotene Themen an, sondern formuliert sie auch noch äußerst detailliert, was Politzer durch die Verben „nach[zeichnen] und auseinander[legen]“ (Z. 27) ausdrückt. Dies sei mit „pastoser Drastik“ (ebd.) geschehen, wobei das Adjektiv „pasto[s]“ (ebd.) metaphorisch noch einmal die Genauigkeit und Ausführlichkeit bei der Beschreibung der Szene unterstreicht. Er behandle das Thema so, als „wäre [es] standesgemäß und gesellschaftsfähig“ (Z. 28). Der Konjunktiv zeigt, dass das eben nicht der Fall gewesen ist.
Bei der Erwähnung des „Über-Ich[s]“ (Z. 29) bezieht sich Politzer auf Freud, der mit diesem Begriff die Sozialisationsinstanz des Menschen beschrieben hat, die für dessen Moral steht. Eben diese Instanz habe sie sich in den Armen des Vaters wohler fühlen lassen als in denen des Grafen. So habe sie bei ihrem Vater „Hingabe, Bewusstsein und Genuss“ (Z. 31) erfahren. In diesem Moment habe Kleist sie „als Frau erkannt und dargestellt“ (Z. 32).
Die Bedeutung der Textstelle für die Novelle macht Politzer deutlich, indem er diese als „axia[l]“ (Z. 33) bezeichnet, da sie „den unheilschwangeren Beginn mit der Lösung an ihrem Ausgang“ (Z. 34f.) verbinde.
Auch dem Vater tue die Versöhnung gut, da er „eine Art von Genugtuung“ (Z. 37) verspüre, da er „den Mann, der seine Tochter zu Fall gebracht hatte, in den Schatten seiner väterlichen Autorität gestellt [hat]“ (Z. 38f.). Die Metapher, dass der Graf sie zu Fall gebracht habe, verbildlicht, dass er ihr Leben und ihr Ansehen durch die Vergewaltigung negativ beeinflusst hat. Eben dadurch, dass die Marquise sich ihrem Vater anstatt dem Grafen zuwendet, erfährt der Vater das Gefühl der Genugtuung, da er den Vorzug erhält und er dadurch, metaphorisch zu verstehen, den Grafen „in den Schatten seiner väterlichen Autorität“ (ebd.) stellt, ihn sich also unterordnet.
Dadurch motiviert zeige der Vater „eine gewisse Generösität“ (Z. 40), was so viel wie Großzügigkeit bedeutet, als seine Tochter den Grafen wegschickt, nachdem er sich als Vater des Kindes erweist. Die Marquise habe sich „wie eine Besessene“ (Z. 43) aufgeführt, was als Vergleich dient und ihre Wut verdeutlichen soll und ihn „zur Hölle geschickt“ (Z. 44f.), was ihren Hass auf den Grafen in diesem Moment ausdrückt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Kleist sich durch diese Textstelle von anderen Autoren der Zeit und auch von sich selbst absetzt, da er ein solch brisantes Ereignis so detailliert beschreibt, wie es nicht üblich gewesen ist, da es normalerweise der Zensur unterlag. Er zeigte, dass er über einen einzigartigen Schreibstil verfügte und auch im Aufbau der Beschreibung und der Wortwahl Mittel nutzte, um sich selbst vor der Peinlichkeit zu bewahren. Zudem wird angesprochen, dass die Marquise sich bei ihrem Vater wesentlich wohler gefühlt habe als beim Grafen, was diese Szene eben verdeutlicht.
Lyrik
Analyse: Die blaue Blume
Das Gedicht „Die blaue Blume“, welches 1818 in der Epoche der Romantik von Joseph von Eichendorff veröffentlicht worden ist, thematisiert das Streben nach dem Unendlichen.
Das vorliegende Gedicht besteht aus drei Strophen mit je vier Versen, wobei jede Strophe auch einen Sinnabschnitt bildet.
Bereits der Titel „Die Blaue Blume“ (V.0) weist daraufhin, dass dieses Gedicht der Romantik entstammt, da die blaue Blume ein typisches Symbol der Romantik ist, welches für Sehnsucht und das Streben nach dem Unendlichen steht, worauf vor allem das Farbadjektiv „bla[u]“ (ebd.) schließen lässt, welches sich mit dem unendlich großen Himmel in Verbindung setzten lässt.
Die erste Strophe behandelt die Sehnsüchte des lyrischen Ichs, welches „die blaue Blume“ (V.1) sucht, die auch hier eine Metapher für das Unendliche ist, nach dem das lyrische Ich strebt. Dass das lyrische Ich sie suche aber nie finde (vgl. V. 2) ist ein Paradoxon, da es in der Gewissheit, seine Sehnsüchte niemals befriedigen zu können, dennoch weiter sucht. Jeder Vers der ersten Strophe beginnt entweder mit einem Personal- oder Possessivpronomen der ersten Person Singular, was darauf hindeutet, dass es sich um individuelle Sehnsüchte handelt, da eben jeder Mensch andere Sehnsüchte hat und nach anderen Dingen strebt. Das Verb „träum[en]“ (V.3) verdeutlicht zum einen, dass es sich um einen Wunsch des lyrischen Ichs handelt und zum anderen, dass es jedoch ein Wunsch ist, dessen Erfüllung unrealistisch ist. Das lyrische Ich hofft dennoch, dass in der Erfüllung des Wunsches sein „gutes Glück [ihm] blüh“ (V. 4). Hier wird mit der Verwendung des Verbes „blüh[en]“ (ebd.) ein Verb aus dem Wortfeld der Natur gewählt, aus dem auch die Metapher der blauen Blume stammt, um zu verdeutlichen, dass erst das Erreichen des Unendlichen das lyrische Ich befriedigen kann. Die Alliteration und auch Tautologie des „gute[n] Glück[s]“ (ebd.) betont besonders die große Bedeutung, die das Erreichen des Unendlichen für das lyrische Ich hat. Dass das Glück von diesem Fund abhängig ist und mit diesem in Verbindung steht, macht das Enjambement in den Versen drei und vier deutlich.
In der zweiten Strophe geht es genauer um die Suche. Das lyrische Ich wandert mit seiner Harfe (vgl. V. 5), welche ein sehr melodiöses Instrument ist, welches auch für Melancholie stehen könnte, die das lyrische Ich auf der Suche begleitet. Die Antiklimax, dass das lyrische Ich durch „Länder, Städt und Au’n“ (V.6) wandere, zeigt, dass es gründlich und überall nachsieht, da es jede Möglichkeit das Glück zu finden nutzt. Dass es nachsieht, ob es die blaue Blume wirklich nirgends findet(vgl. V. 7f.), zeigt, dass es an der Existenz dieser, also an der Möglichkeit das Unendliche zu erreichen zweifelt, aber dennoch weiter sucht. Das Enjambement (ebd.) kann in der Form die unendliche Suche zeigen.
Die dritte Strophe thematisiert dann intensiver die Zweifel des lyrischen Ichs, welches „schon seit lange“ (V. 9) auf der Suche ist, was zusätzlich durch die Anapher „Ich wandre“ (ebd.) zu Beginn der zweiten und dritten Strophe verdeutlicht wird. Die Wiederholung des Adverbs „lang" (V. 10) betont, dass das lyrische Ich seit langer Zeit auf der bisher erfolglosen Suche ist. Die Verwendung des Perfekts, dass es „lang gehofft, vertraut [habe]“ (V. 10), zeigt, dass das lyrische Ich im Verlaufe des Gedichtes die Hoffnung, seine Sehnsüchte zu befriedigen, aufgibt, was an der Verzweiflung liegt, die auch durch die Interjektion „ach“ (V.11) ausgedrückt wird und welche dadurch verursacht wird, dass es „noch nirgends […]/Die blaue Blum geschaut“ (V.11 f.) habe, also noch nicht geschafft hat, die Sehnsüchte zu befriedigen. Vor allem sticht dabei der vorletzte Vers hervor, weil die ersten drei Silben dieses Satzes allesamt betont werden (vgl. V. 11). Somit legt der Text besonderen Wert darauf, dass deutlich wird, dass die Suche ergebnislos ist und dass das lyrische ich zu zweifeln beginnt. Das Enjambement (vgl. V. 11 f.) kann hier noch einmal betonen, wie lang und unendlich die Suche des lyrischen Ichs ist. Als Metrum weist das Gedicht einen dreihebigen Jambus vor, welcher jedoch Unregelmäßigkeiten in dem zweiten, achten und elften Vers aufweist, welche ebenso wie das ungewöhnliche Reimschema, bei dem sich jeweils nur der zweite und vierte Vers jeder Strophe reimt, die Unzufriedenheit und das Gefühl der Unvollkommenheit des lyrischen Ichs veranschaulichen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Suche nach dem Unendlichen, wie beispielsweise das Streben nach unendlichem Wissen, erfolglos ist, da es für den Menschen nicht möglich ist dieses zu erfahren. Um das zu beschreiben wird vor allem die Metapher der blauen Blume, die für dieses Streben steht und ein typisches Symbol der Romantik ist, genutzt. Inhaltlich merkt man, dass die anfängliche Hoffnung des lyrischen Ichs sich von Strophe zu Strophe zu Verzweiflung entwickelt. Auch die Form des Gedichts unterstützt den Inhalt des Gedichts, wie beispielsweise die Enjambements und die Unregelmäßigkeiten in Reimschema und Metrum.
Merkmale der Romantik
Die Literaturepoche der Romantik beschreibt in etwa den Zeitraum von 1795 bis 1835 in der Zeit während und nach den Revolutionskriegen. Beeinflusst von der napoleonischen Herrschaft standen die deutschen Gebiete unter französischer Oberhoheit und wurden nach dem „Code Napoleon“ regiert. Doch mit dem Zusammenbruch des Imperiums Napoleons nach der Niederlage in Russland und den Beschlüssen zur Restauration im Rahmen des Wiener Kongresses (1815), die das absolutistische Regime zurückbrachten, wurden alle Hoffnungen der Deutschen, endlich einen deutschen Nationalstaat mit liberaler Verfassung zu bilden, zerstört.
Zu dem Verblassen der Hoffnung auf eine Umgestaltung der politischen Verhältnisse kommt noch hinzu, dass aufgrund der Industrialisierung der Mensch hauptsächlich in seinem ökonomischen Nutzwert gesehen wurde, wodurch sich auch die Vorstellung der Selbstverwirklichung des Individuums in diesen Umständen als Illusion herausstellte.
Enttäuscht von der aktuellen Situation flüchteten sich die Menschen dieser Zeit in die Vorstellung der idyllischen Natur und des heilen Mittelalters, welches die Menschen mit Einheit, Ordnung und der kulturellen Blütezeit in Verbindung brachten. Vor allem die Sehnsucht ist ein Merkmal dieser Epoche, welche allerdings kein festgesetztes Ziel hat, sondern nach dem Unbekannten und Unendlichen verlangt, wobei sich der Mensch bewusst ist, diese Bedürfnisse nicht stillen zu können.
Besonderen Ausdruck enthält die Sehnsucht in der Literatur der Zeit, welche vor allem durch Poetisierung eine Art Heilmittel für die Seelen der Menschen darstellen sollte. Die Welt wurde in der Romantik romantisiert, was bedeutet, dass einfache Dinge in unbekannte und unendliche Dinge verwandelt wurden. Das erklärt auch die Vorliebe der Romantiker für Märchen und Erzählungen.
Doch auch die Lyrik war von großer Bedeutung in dieser Zeit. Die Lyrik zeichnet sich vor allem durch vier immer wieder behandelte Themen aus. Das erste Thema sind die Reisen, welche die Sehnsucht des lyrischen Ichs nach dem Aufbruch in ein neues von Freiheit bestimmtes Leben darstellt. Das zweite Thema ist die Liebe, die von der Unerreichbarkeit der geliebten Person geprägt ist, während das dritte Thema die Nacht ist, in der die Fantasie freigesetzt wird und die Grenzen verschwimmen. Das letzte wichtige Thema sind die Träume, die unmittelbar mit der Nacht in Verbindung stehen. Diese können zum einen Bilder der Sehnsucht, aber zum anderen auch die Albträume aus den Tiefen des Unbewussten zeigen. Diese Albträume sind außerdem wichtiger Teil der Schauerromane der Schwarzen Romantik. Das Zeitalter der Romantik ist auch bekannt dafür, dass Frauen beginnen wichtige Rollen im literarischen Leben einzunehmen. So fungieren diese als Vermittlerinnen und Produzentinnen und in seltenen Fällen sogar als Autorinnen.
Zum Schluss ist es noch wichtig zu erwähnen, dass sich die Literaturepoche der Romantik nicht mit der Romantik anderer Künste deckt und auch was den Zeitraum angeht in den verschiedenen Ländern anders eingeschätzt wird.
Analyse: Kleine Aster
Das Gedicht „Kleine Aster“, von Gottfried Benn in der Epoche des Expressionismus geschrieben, ist 1912 veröffentlicht worden und thematisiert die Entwürdigung des Menschen.
Der Titel „Kleine Aster“ (V. 0) trägt den Namen einer Blume, was annehmen lässt, dass das Gedicht von Natur handelt, was jedoch in den ersten drei Versen direkt wieder relativiert wird.
Auch wenn das Gedicht nur aus einer Strophe mit 15 Versen besteht, kann man es in drei Sinnabschnitte einteilen. Der erste Sinnabschnitt umfasst die ersten drei Verse und handelt von der Leiche, die im Laufe des Gedichts seziert wird. Bei der Leiche handelt es sich um einen „ersoffene[n] Bierfahrer“ (V. 1). Das Adjektiv „ersoffe[n]“ (ebd.) ist umgangssprachlich und zeugt hier von fehlender Empathie. Es macht aber auch deutlich, dass hier die Situation und der Tod nicht beschönigt werden. Der Fakt, dass die Leiche „auf den Tisch gestemmt“ (ebd.) wurde, zeigt, dass Im Umgang mit der Leiche das Feingefühl oder auch der notwendige Respekt fehlt. Außerdem verdeutlicht die Verwendung des Passivs, dass die Leiche wehrlos den Launen der Untersuchenden ausgesetzt ist. Der tote Mensch wird hier entwürdigt und gedemütigt, auch weil ihm „irgendeiner […] eine dunkelhelllila Aster / zwischen die Zähne geklemmt“ (V. 2f.) hat. Das Indefinitpronomen „irgendeiner“ (ebd.) vermittelt die Anonymität, die zwischen den Menschen in der Zeit des Expressionismus geherrscht hat und könnte somit die fehlende Empathie begründen. Das Farbadjektiv „dunkelhelllila“ (ebd.) ist ein Paradoxon, welches einen Kontrast zwischen hell und dunkel herstellt, der möglicherweise den Kontrast zwischen der lebenden Blume und dem toten Menschen veranschaulichen soll.
Bereits nach den ersten drei Zeilen wird deutlich, dass dieses Gedicht sich dem Expressionismus zuordnen lässt. Allein das Farbadjektiv „dunkelhelllila“ (ebd.) weist darauf in zweierlei Hinsicht hin, da für den Expressionismus sowohl Wortneuschöpfungen als auch Farbsymbolik typisch waren. Typisch war es auch etwas Unschönes mit etwas Ästhetischem in Verbindung zu bringen, was hier durch die Verbindung der Leiche mit der Aster der Fall ist.
Im zweiten Sinnabschnitt (V. 4 bis V. 12) wird der Seziervorgang, den das lyrische Ich vornimmt, beschrieben. Die Brutalität und Hässlichkeit der Realität wird in der detaillierten und humorlosen Beschreibung des Vorgangs deutlich. Das lyrische ich schneidet ohne die Erwähnung irgendwelcher Emotionen „mit einem langen Messer / Zunge und Gaumen“ (V. 6 f.) heraus. Das „lang[e] Messer“ (ebd.) kann zeigen, dass das lyrische Ich unvorsichtig vorgeht, was auch deutlich wird als es die Aster angestoßen hat, sodass sie in das Gehirn geglitten ist (vgl. V. 8 f.). Diese Vorfälle scheinen das lyrische Ich nicht zu bewegen, was wieder das fehlende Mitgefühl und den fehlenden Respekt gegenüber Toten zeigt. Wenig von dem Missgeschick beeindruckt packte das lyrische Ich dem Leichnam die Aster in die Brusthöhle (vgl. V. 10). Das Verb „pack[en]“ (ebd.) zeigt hier wieder den unvorsichtigen und auch respektlosen Umgang des lyrischen Ichs. Es kommt einem vor als würde das lyrische Ich mit dem Leichnam spielen, da es ohne irgendwelche Sorgen an dem Leichnam herumschneidet und ihm auch die Blume im Körper platziert „als man zunähte“ (V.12). Dass hier nur einzelne Körperteile wie „Zunge und Gaumen“ (V. 7) angesprochen werden zeigt, dass der Mensch hier nur noch als Objekt angesehen wird.
Hier aber auch allgemein wirkt das Gedicht weniger wie ein Gedicht, sondern eher wie eine bloße kalte Darstellung der Vorgehensweise des lyrischen Ichs, nicht nur weil es an Emotionen fehlt, sondern auch wegen des Mangels an sprachlichen Mitteln und auch wegen der einfach gehaltenen Form, die kein regelmäßiges Metrum oder Reimschema aufweist. Bereits im ersten Vers des Gedichtes wird durch die Nutzung des Präteritums deutlich, dass es sich eher um eine Erzählung handelt, was zusätzlich dadurch unterstützt wird, dass es sich um einen ganzen Satz handelt, der mit einem Punkt beendet wird (vgl. V. 1).Die Emotionslosigkeit des lyrischen Ichs wird im zweiten Sinnabschnitt durch Enjambements verdeutlicht, die zeigen, dass das lyrische Ich aufgrund der Routine keine Hemmungen im Umgang mit der Leiche hat.
Im letzten Sinnabschnitt (V. 13 bis V. 15) wendet sich das lyrische Ich direkt der Aster zu. Das wird durch das Personalpronomen „dich“ (V. 13) in Verbindung mit dem Imperativ „Trinke“ (ebd.) deutlich. Das lyrische Ich sorgt sich mehr um die Pflanze als um den toten Menschen und will sogar, dass sie sich von ihm ernährt, wodurch dieser wieder einmal entwürdigt und die geringe Bedeutung des Menschen deutlich wird. Der Mensch wird hier als Gegenstand angesehen, der einen Nutzen für die Aster haben, ihr nämlich als „Vase“ (ebd.) dienen soll. Dass die Aster hier eine größere Bedeutung als die Leiche hat wird nochmal verdeutlicht, als das lyrische Ich der Aster wünscht, dass sie sanft ruhe (vgl. V. 14) anstatt dem toten Bierfahrer zu wünschen, dass er in Frieden ruhe. Dabei wird auch die Zuneigung, die das lyrische Ich für die Blume verspürt, erkennbar.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Gedicht einen emotionslosen und rücksichtslosen Umgang mit einem toten Menschen darstellt. Hier hat eine Pflanze eine größere Bedeutung als der Mensch, was zeigt als wie wertlos der Mensch angesehen wird. Die Emotionslosigkeit wird durch umgangssprachliche Ausrücke und fehlende sprachliche Mittel unterstützt. Die Form des Gedichts, die kein regelmäßiges Reimschema oder Metrum aufweist, lässt das Gedicht mehr wie einen Bericht wirken, was, unterstützt durch die Enjambements, die Emotionslosigkeit noch einmal unterstreicht.