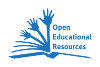Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Analyse Guratzsch: Unterschied zwischen den Versionen
AFries (Diskussion | Beiträge) (→Anne) |
|||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
Im darauffolgenden wird Bezug zu der Tagessitzung des IDS genommen, welche den Sprachverfall thematisierte. Dabei wird jedoch nicht das thematisiert, wovon „in der deutschen Öffentlichkeit die Rede“ (Z. 32 f.) sei. Somit unterstellt Guratzsch, dass seine Meinung, der Sprachverfall sei etwas schlechtes, auch von der Mehrheit der deutschen Bürger vertreten wird. Dies veranschaulicht, dass er von dieser Meinung durch und durch überzeugt ist, da er diese verallgemeinert. Stattdessen jedoch sei „für den Sprachwissenschaftler […] das Faszinosum gerade der Wandel“ (Z. 33 f.). Somit ist zu sagen, dass er von diesem Wandel regelrecht angezogen sei und dieser ihn fasziniert oder gar fesselt. Aus diesem Grund gibt es für ihn kein „“Richtig“ oder „Falsch“, […] „Gut“ oder „Böse“, […] „Schön“ oder „Unschön““ (Z. 34 f.). Aus dieser Akkumulation der drei Antithesen geht somit auch die Untätigkeit der Institute hervor. Da sie es weder als negativ, noch als positiv empfinden, sind die in der Rolle des Beobachters und dokumentieren den Wandel lediglich. Um einen Kontrast zu der Meinung der Sprachwissenschaftler zu schaffen, wird das Anliegen eines „Normalbürger[s]“ (Z. 35) geschildert, was ebenfalls das des Autors entspricht. So „geht es um Fülle, Farbigkeit und Feinheit im Ausdruck“ (Z. 36). Die dabei genutzte Alliteration verdeutlicht, dass all dies durch den Sprachwandel und den daraus resultierenden Verfall verloren geht und somit ein „Verlust“ (Z. 37) darstellt. | Im darauffolgenden wird Bezug zu der Tagessitzung des IDS genommen, welche den Sprachverfall thematisierte. Dabei wird jedoch nicht das thematisiert, wovon „in der deutschen Öffentlichkeit die Rede“ (Z. 32 f.) sei. Somit unterstellt Guratzsch, dass seine Meinung, der Sprachverfall sei etwas schlechtes, auch von der Mehrheit der deutschen Bürger vertreten wird. Dies veranschaulicht, dass er von dieser Meinung durch und durch überzeugt ist, da er diese verallgemeinert. Stattdessen jedoch sei „für den Sprachwissenschaftler […] das Faszinosum gerade der Wandel“ (Z. 33 f.). Somit ist zu sagen, dass er von diesem Wandel regelrecht angezogen sei und dieser ihn fasziniert oder gar fesselt. Aus diesem Grund gibt es für ihn kein „“Richtig“ oder „Falsch“, […] „Gut“ oder „Böse“, […] „Schön“ oder „Unschön““ (Z. 34 f.). Aus dieser Akkumulation der drei Antithesen geht somit auch die Untätigkeit der Institute hervor. Da sie es weder als negativ, noch als positiv empfinden, sind die in der Rolle des Beobachters und dokumentieren den Wandel lediglich. Um einen Kontrast zu der Meinung der Sprachwissenschaftler zu schaffen, wird das Anliegen eines „Normalbürger[s]“ (Z. 35) geschildert, was ebenfalls das des Autors entspricht. So „geht es um Fülle, Farbigkeit und Feinheit im Ausdruck“ (Z. 36). Die dabei genutzte Alliteration verdeutlicht, dass all dies durch den Sprachwandel und den daraus resultierenden Verfall verloren geht und somit ein „Verlust“ (Z. 37) darstellt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Maike == | ||
| + | |||
| + | Der vorliegende Sachtext „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ wurde von Dankwart Guratzesch geschrieben und 2013 auf „www.welt.de“ veröffentlicht. Er beschäftigt sich mit dem Sprachwandel und den Folgen, die dieser mit sich zieht. | ||
| + | |||
| + | Der gesamte Text lässt sich in drei Sinnabschnitte unterteilen. Im ersten Sinnabschnitt ( Z. 1 – 21) stellt Guratzesch zu Beginn einige rhetorische Fragen. Allgemein die Frage „Gibt es einen „Verfall“ der deutschen Sprache?“ (Z. 1) zeigt das Thema des Sachtextes auf. Im darauffolgenden wird ein Bezug zu Bastian Sicks Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ genommen (vgl. Z. 2). Als der Autor sich dann die Frage stellt wo die „Gesetzeshüter“ (Z. 4f.) seien, welche dem Wandel der Sprache einen Stopp erteilen jedoch sei dies nicht geschehen, weder „im Institut für deutsche Sprache“ (Z. 6), noch „in der Gesellschaft für deutsche Sprache“ (Z. 7) oder „in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung“ (Z. 7f.). Laut Autoren sei „der deutsche Wortschatz […] heute reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 16f.), das heißt eben, dass der Sprachwandel nicht das schlechteste sei. Zudem wird hier die moderne, also die heutige Welt mit den Lebzeiten Goethes verglichen, eingeleitet wird der Vergleich durch die Konjunktion „als“ (Z. 17). Angeblich würde die Grammatik „immer einfacher“ (Z. 17) und aus diesen Gründen sollen man nicht weiter nach Anzeichen für einen Sprachverfall suchen, sondern diese Suche abschließen (vgl. Z. 20f.). | ||
| + | |||
| + | Im zweiten Sinnabschnitt (Z. 23 – 44) benutzt der Autor Zitate von Sprachwissenschaftlern um seine Leser zu überzeugen. Beispielsweise verwendet Guratzesch die Aussage „ Es liegt im Wesen der Sprache, dass sie sich verändert, dass ihre Entwicklung in keinem Augenblick stille steht“ (Z. 26 f.), die ursprünglich von dem Sprachwissenschaftler Otto Behaghel stammt. Der Autor stellt diese Aussage als „Evangelium“ (Z. 29) dar, welchem sich die Kollegen des Sprachwissenschaftlers bekannten, mit der Begründung, dass Stillstand Tod heiße (vgl. Z. 29 f.). Hinzufügend meint der Autor, dass der Sprachwissenschaftler von dem Wandel der Sprache fasziniert sei (vgl. Z. 33), dass aber im Gegensatz dazu, der „Normalbürger“ ( Z. 35) den Wert eher auf „Fülle, Farbigkeit[...] [und] Feinheit im Ausdruck“ (Z. 36) lege, diesem ginge es also mehr um den Inhalt der Sprache und des Vokabulars. Hier wird der Gegensatz der beiden Seiten durch die Konjunktion „aber“ (Z. 36) eingeleitet und unterstreicht eben die gegensätzlichen Meinungen. Ergänzend muss erwähnt werden, dass das Leiden am Sprachwandel für einen „Normalbürger“ (Z. 35), „ein Leiden am Verlust“ (Z. 37) ist. Im nächsten Satz stellt der Autor erneut eine rhetorische Frage, die da wäre „Werden Jugendliche in fünfzig Jahren überhaupt noch Goethe […] im Original lesen können?“ (Z. 38f.). Ergänzend fügt er dann noch „Oder sind ihnen bis dahin viele Vokabeln des Deutschen abhanden gekommen?“ (Z. 39 f.) hinzu. Diese beiden Fragen unterstreichen die Möglichen Folgen des Sprachwandels, nämlich der Verlust der alten, hochdeutschen Sprache. Diese beiden Fragen seien in Mannheim im Institut für deutsche Sprache nicht gestellt worden (vgl. Z. 40f.), obwohl eben diese, die „Kernfrage des Deutschunterrichts an den Schulen“ (Z. 41 f.) sei. Da die Sprachwissenschaftler dies und außerdem noch die Tatsache, dass die Lehrer der heutigen Schulen und sie selbst „von denselben Linguisten ausgebildet“ (Z. 42 f.) wurden, nicht direkt klar war, scheint mir diese Aussage als eine Art Vorwurf gegenüber der Sprachwissenschaftler (vgl. Z. 43). Jedoch schafft der Autor einen Gegensatz dazu, indem er sagt, dass ihnen eben dies nicht klar war, habe „sehr gut nachvollziehbare Gründe“ (Z. 44). | ||
| + | |||
| + | Es folgt ein Abschnitt der für die Analyse allerdings außer Acht gelassen wird (Z. 46 – 75). | ||
| + | |||
| + | Der letzte Sinnabschnitt (Z. 76 – 93) ist hauptsächlich den Folgen des Sprachwandels bzw. des Sprachverlustes gewidmet, er dient als eine Art Schluss. Laut des Autors Guratzesch ist das Ergebnis vor Allem für die „Sprachrevolutionäre von 1968 fatal“ (Z. 79f.), da diese für die Anpassung der Sprache gekämpft haben (vgl. Z. 80). Folge des Sprachwandels, sei „der Verlust an Vokabular der deutschen Hochsprache“ (Z. 85), welcher gleichzeitig auch ein „Sprach- (und Kultur-)verfall“ (Z. 87) sei. Zuletzt führt Dankwart Guratzesch eine Art Fazit an, welches besagt, dass die Kultur der Sprache als Ausweis der kulturellen Identität dient (vgl. Z. 92 f.). | ||
| + | |||
| + | Abschließend ist zu sagen, dass der Autor in dem Sachtext seine Meinung klar vertritt und mit Hilfe von Zitaten verschiedener Sprachwissenschaftler zu belegen versucht, um die Leser von seinem Standpunkt zu überzeugen. | ||
Version vom 14. März 2019, 21:24 Uhr
Analyse des Sachtextes von Dankwart Guratzsch: Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht
Inhaltsverzeichnis |
Carina
Der hier vorliegende Sachtext “Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht” wurde von Dankwart Guratzsch verfasst und 2013 auf der Internetseite “www.welt.de” veröffentlicht. Thematisch befasst sich der Text mit der Veränderung der deutschen Sprache und den daraus resultierenden Konsequenzen.
Schon bereits die Überschrift “Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht” leitet die Thematik des Textes ein. Der Autor ist der Auffassung, dass die deutsche Sprache mit der Zeit zunichte gehe. Um diese Problemstellung zu fokussieren, formuliert Guratzsch in seiner Einleitung in den Bericht, die sich durch den Artikel ziehende Leitfrage “Gibt es einen “Verfall” der deutschen Sprache? “ (Z. 1), welche den roten Faden des Textes darstellt. Um weiter auf seine Fragestellung einzugehen, definiert der Autor weitere Konsequenzen, die aus dem Sprachverfall resultieren (vgl. Z. 1ff.). Exemplarisch formuliert er die Frage “ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber? “ (Z. 3f.). Durch das Adjektiv “schauderhaft” (ebd.) lässt sich eine erstmalige Wertung des Autors erkennen, wodurch deutlich wird, dass er den Sprachverfall der deutschen Sprache als Problem betrachtet. Aufgrund dieser Problematik empfindet Guratzsch es als notwendig, dass man gegen dieses Phänomen vorgeht, was unter anderem durch die rhetorische Frage “Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen? “ (Z. 4f.) untermauert wird. Die Tatsache, dass er diese Frage auf drei unterschiedlichen Sprachinstitute bezieht, welche nicht gegen den Verfall vorgehen, untermauert, dass der Autor ihnen vorwirft, dass diese den Sprachverfall nicht aufhalten wollen (vgl. Z. 6ff.). Eben diese Ignoranz wird durch die dreifache Repetitio des Partikels “nicht” (ebd.) untermauert sowie durch den metaphorischen Vergleich “ist ein Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen” (Z. 10). Dieser unterstreicht nochmals den Vorwurf von Guratzsch, dass niemand gegen den Sprachverfall vorgeht und ihn nicht versucht aufzuhalten, da “hier (..) nur angesessen und Buch geführt (wird) “ (Z. 11). Besonders durch das Adverb “nur” (ebd.) wird eine gewisse Bequemlichkeit der Institute hervorgehoben, wodurch die Kritik des Autors an diesen nochmals untermauert wird. Weiterhin ist er der kritischen Auffassung, dass “jedes Rascheln im Gesträuch (..) den Lauernden wie Musik in den Ohren (klingt) “ (Z. 11f.). Die “Lauernden” (ebd.) stellen hierbei die einzelnen Institutionen dar, welche die einzelnen Veränderungen der Sprache als affirmativ gar bereichernd ansehen, wodurch deutlich wird, dass Guratzsch meint, dass diese die Konsequenzen des Verfalls nicht erkennen. Um mögliche Veränderungen in den Fokus zu rücken, bezieht er sich auf den “Bericht zur Lage der deutschen Sprache” (Z. 14f.). In diesem würden die Autoren begeisternd davon ausgehen, dass „das Dickicht des Gegenwartsdeutschs […] nur so von Leben [strotze]“ (Z.15f.). Des Weiteren sind diese Autoren der Meinung, dass die heutige Sprache komplexer als die zu Goethes Zeiten sei (vgl. Z.16ff.). Dies würden die Autoren laut Guratzsch daran begründen, dass „die Grammatik immer einfacher [werde] […] und selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“ (ebd.). Durch das Adjektiv „hässlich“ (ebd.) wird nochmals die Auffassung Guratzsch deutlich, da er zunehmend ironisch über den genannten Bericht spricht und gegensätzlicher Meinung, zu der der Autoren ist. Eben diese Ironie setzt sich auch in dem Fazit „Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z.20f.) fort, da es laut ihm von hoher Signifikanz ist, dass der Verlust der deutschen Sprache aufgehalten wird, wodurch ebenfalls sein Vorwurf gegenüber den Institutionen für deutsche Sprache, dass sie den Verfall ignorieren würden und ihn nicht aufhalten wollen, nochmals verstärkt wird.
In seinem zweiten Abschnitt „Sprachwandel bedingt auch Verlust“ geht Guratzsch konkret auf die Konsequenzen für den einzelnen Normalbürger ein. Er berichtet unter anderem darüber, dass das Institut für Deutsche Sprache (IDS) auch noch seine Jahrestagung in Mannheim dem Thema widmete“ (Z.24f.), wodurch in gewisser Weise ein Ende des Sprachverfalls hervorgerufen wurde, was durch die metaphorische Aussage „wurde das Halali geblasen“ (ebd.) untermauert wird. Des Weiteren zitiert Guratzsch den Sprachwissenschaftler Otto Behagel, welcher die stetige Veränderung der Sprache als signifikant erachtet, „denn Stillstand bedeute Tod“ (Z. 29f.). Eben diese Meinung würden laut Guratzsch auch das Institut für Deutsche Sprache vertreten, jedoch macht der Autor darauf aufmerksam, „dass auch auf diesem Forum von etwas ganz anderem als in der deutschen Öffentlichkeit die Rede war“ (Z.31f.). Die Begebenheit, dass „nur wer ganz genau hin hörte“ (ebd.) dies verstehen bzw. wahrnehmen konnte zeigt, wie tückisch diese Institute vorgehen. Des Weiteren vergleicht Dankwart Guratzsch die Situation des Sprachverfalls für einen Sprachwissenschaftler mit der eines Normalbürgers. Für den Sprachwissenschaftler sei eben diese Veränderung der Sprache das Fesselnde und Bereichernde, da er sich in seinem Beruf mit der Sprache selbst, ihren Strukturen, Formen und Funktionen befasst, feste Regeln für ihn jedoch nicht von Bedeutung sind. Für den Normalbürger bedeute dies jedoch, dass er eben diese Regeln der Sprache verliere was durch die Alliteration „Fülle, Farbigkeit, Feinheit im Ausdruck“ (Z.36) deutlich wird. Die Gegebenheit, dass der Autor hier hauptsächlich affirmative Nomen für die Beschreibung verwendet, verdeutlicht seine hohe Überzeugung der deutschen Sprache und die daraus resultierende Forderung, dass eben diese erhalten bleiben müsse, denn für den Normalbürger sei „sein Leiden am Sprachwandel […] ein Leiden am Verlust“ (Z. 36f.), wodurch untermauert wird, dass sich der Sprachverfall nachteilig auf das Leben der einzelnen Einwohner auswirken würde. Als mögliche Konsequenzen formuliert er die Fragen „Werden Jugendliche in fünfzig Jahren überhaupt noch Goethe […] im Original lesen können? Oder sind ihnen bis dahin viele Vokabeln des Deutschen abhanden gekommen?“ (Z.38f.). Guratzsch merkt jedoch an, dass eben diese Kernfragen keine Bedeutung bei der Jahrestagung erlangt haben, wodurch ebenfalls untermauert wird, dass die Sprachinstitutionen nicht auf mögliche Konsequenzen für die Normalbürger achten und hauptsächlich auf ihren eigenen Profit fokussiert sind.
Alina
Der Sachtext „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“, verfasst von Dankwart Guratzsch und veröffentlicht auf der Website www.welt.de der Tageszeitung Welt und 2013 veröffentlicht thematisiert den Verlust von deutscher Sprache.
Zu Beginn des Sachtextes leitet der Autor den Sachtext mit sechs Fragen ein, um den Leser auf das Problem aufmerksam zu machen. Gibt es einen „Verfall“ der deutschen Sprache? Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Macht das schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus? Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber? Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen? (Z. 1-5). Mit seiner ersten Frage nimmt Guratzsch direkten Bezug auf das Thema des Textes und stellt somit die Frage an den Leser, ob die deutsche Sprache wirklich an Wert verliert und wenn ja, auf welche Art und Weise? Diese stellt der Autor mit den folgenden zwei parataktischen Fragen „Stirbt der Konjunktiv?“ (ebd.) Der Konjunktiv ist einer der drei wichtigsten Modi eines Verbs, zusammen mit dem Indikativ und Imperativ und wird als Möglichkeitsform bezeichnet. Stimmt es, dass dieser Modus ausstirbt?, fragt sich Guratzsch und versucht mit dieser Frage, den Leser ebenfalls zum Nachdenken anzuregen. Zudem stellt Guratzsch die Frage, ob „der Dativ dem Genitiv sein Tod?“ (ebd.) sei und fasst damit ein weiteres Problem in der deutschen Sprache auf. Im Bezug auf diese sprachlichen Probleme folgt die weitere Frage, in der der Autor die deutsche Sprache als „schludrige[s] Denglisch“ (ebd.) bezeichnet. Mit dem Neologismus „Denglisch“ (ebd.) wird die deutsche Sprache negativ kritisiert, da eine Zusammensetzung zwischen den Sprachen Englisch und Deutsch verwendet wird. Dies weißt darauf hin, dass unsere deutsche Sprache von der englischen Sprache geprägt ist und somit eine Mischung aus englischen und deutschen Wörtern entsteht. Des weiteren nimmt der Autor Bezug auf die deutsche Sprache, indem er sagt, dass aus dem „schludrigen Deutsch“ (ebd.) „dem reinen deutschen Idiom den Garaus“ (Z. 3) gemacht wird. Damit wird die Sprache ebenfalls negativ kritisiert, indem die Verwendung der Substantivs „Garaus“ (ebd.) darauf hinweist, dass die ‘denglische‘ Sprache der deutschen Sprache überhand und die Kontrolle übernimmt, sodass die reine deutsche Sprache vernachlässigt wird. Zudem bezeichnet der Autor die deutsche Sprache als „schauderhaft“ (Z. 3) und „Toten[grab]“ (Z. 4), was ebenfalls eine negative und angegriffene Stimmung auf den Leser erzeugt, sodass die Möglichkeit, sich Gedanken über den Sprachverfall der deutschen Sprache zu verschaffen, nicht zu verhindern ist. Zuletzt stellt Guratzsch die Frage, wo diejenigen sind, die sich darum kümmern, die ‘alte‘ deutsche Sprache wieder zurück zu holen, indem sie sich mit denjenigen befassen, die die deutsche Sprache verändert haben (vgl. Z. 4f.). Diese Menschen bezeichnet der Autor als „Sprachverderber“ (Z. 5). Dieser Neologismus spielgelt seine Meinung konkret wider. Um auf diese Fragen eine Antwort zu erhalten, benennt er drei Institute „für Deutsche Sprache“ (Z. 6), die sich jedoch nicht mit dem Sprachverfall beschäftigen. Diese sind zum einen „Mannheim“ (Z. 6); „Wiesbaden“ (Z. 7) und „Darmstadt“ (Z. 8), welche eine Akademie für Sprache und Dichtung ist. Diese drei Institute werden als „dreigetelte[s] Olymp der deutschen Sprachwissenschaft“ (Z. 9) bezeichnet. Allein diese Bezeichnung verweist auf sehr gute und bekannte Institute hin. Die Aussage „ein Hochsitz ohne Götter“ (Z. 10) untermauert den sehenswerten Status der Institute, wohingegen der Verweis auf „ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“ (ebd.) aussagt, dass die Institute trotz des hohen Ranges dem hiergenannten „Olymp“ in Athen nicht gleichgestellt werden können und somit nur im ersten Augenblick von Relevanz sind. Denn um sich gegen den Sprachverfall wehren zu können, benötige man laut Guratzsch „Schwerter und Kanonen“ (ebd.), die sie jedoch nicht besitzen. Somit fehlt den Sprachwissenschaftlern das nötige Etwas, um den Menschen deutlich zu machen, wie sich unsere Sprache verschlechtert hat. Im „Rhein-Neckar-dreieck“ (Z. 9f.) wird jedoch „nur angesessen und Buch geführt“ (Z. 11). Dies bedeutet so viel wie, dass sie sich nicht auf das Wesentliche und Wichtige konzentrieren, sondern immer das gleiche machen und keinen Veränderungen auf den Grund gehen. Guratzsch verdeutlicht somit nochmal den Status der Institute. Daraufhin stellt Guratzsch fest, dass „jedes Rascheln im Gesträusch […] den Lauernden wie Musik in den Ohren [klingt]“ (Z. 11f.). Der Autor verwendet Synonyme aus dem Wortfeld der Jagd und verdeutlicht mit „jede[m] Rascheln“ (ebd.), jede kleinste Veränderung, die die Institute verbessern und „den Lauernden wie Musik in den Ohren [klingt]“, bedeutet soviel wie, dass sich die Menschen, die auf Verbesserung der neuen Sprache hoffen, mit jeder kleinsten Verbesserung zufrieden sind, welche metaphorisch als „Musik in den Ohren“ (ebd.) dargestellt wird.
Des weiteren stellt der Autor sich die Frage „was bei solcher Pirsch herauskommt, das hat der mit großer Spannung erwartete, vor drei Wochen publizierte „Bericht zur Lage der deutschen Sprache“ erwiesen“ (Z. 13f.). Wieder verwendet der Autor ein Wort aus dem Wortfeld der Jagd, indem er „Pirsch“ (ebd.) als eine Jagdart, für den Prozess der Verbesserung der deutschen Sprache verwendet. Mit der Nutzung der Wörter des Wortfeldes Jagd, versucht der Autor die Leser auf die Problematik hinzuweisen, denn aus seiner Sicht, ist der Sprachverlust ein großes Problem. Mit seinem Text versucht er gegen den Sachverhalt anzukämpfen.
Die Ergebnisse die des Berichtes, welches hier als „Dickicht des Gegenwartdeutschs“ (Z. 15) benannt werden, ergaben, dass diese „nur so von Leben [strotzten]“ (Z. 16). Als „Dickicht des Gegenwartdeutschs“ (ebd.) ist die Vermehrung der verflachten deutschen Sprache gemeint, die heute immer mehr verwendet wird und somit als Neologismus „Gegenwartsdeutsch“ (ebd.), zu bezeichnen ist. Allein die Verwendung von Neologismen, deutet auf die Veränderung der deutschen Sprache hin, da jeder weiß, was mit diesen Ausdrücken gemeint ist. Das Verb „strotzen“ (ebd.) setzt nur nochmal den Fokus auf den immer weiter schreitenden Prozess der Verflachung unserer Sprache und das dieser Prozess kein Ende nehmen wird. Somit wird laut Guratzsch behauptet „Der deutsche Wortschatz sei heute reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 16f.). Damit stellt er Goethe, als einer der berühmtesten deutschen Literaten in den Schatten und bezeichnet die heutige Sprache als „reich“ (Z. 17) und somit als wertvoller und kostbarer. Jedoch trügt die Verwendung des Konjunktivs, die in der Behauptung mit „sei“ (ebd.) zu erkennen ist. Somit ist die Behauptung nicht klar zu bestätigen, sondern ist nur eine mögliche Überlegung wahzunehmen. Zudem behauptet Guratzsch „die Grammatik werde immer einfacher, die Anglizismen ließen sich verschmerzen und selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“ (Z. 17ff.). Damit erläutert der Autor die relevantesten Probleme, die sich in der deutschen Sprache erkennen lassen, jedoch seien diese Aussagen nicht eindeutig erkennbar, was an der wiederholten Verwendung des Konjunktivs „werde“ (Z. 17), zu erkennen ist. Der Autor ist der Meinung, dass „Anglizismen sich verschmerzen“ (ebd.) ließen, was darauf hin deutet, dass die englische Sprache immer mehr an Bedeutung in der deutschen Sprache gewinnt und somit keine Chance mehr besteht, die englische Sprache aus unserem Wortschatz zu entfernen. Zudem betitelt er die kleinen Wörter wie „ehm, nh etc.“ als „hässliche Strecksatzgefüge“ (Z. 19f.), da diese unsere Sprache zum verflachen bringen uns somit an Wert verliert, jedoch von den Menschen schon akzeptiert werden „sogar als sinnvoll erwiesen“ (ebd.) werden. „Mit anderen Worten“ (Z. 20) behauptet Guratzsch „Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z. 20f.). Damit verdeutlicht er ausschließlich, dass das Suchen, die Kraft sich gegen den Verfall der deutschen Sprache zu wehren, nicht mehr sinnvoll ist, da die Verwendung von englischer Sprache, Anglizismen, Strecksatzgefügen etc. schon so alltäglich im Gebrauch sind, sodass es nur sehr schwer ist diese wieder aus der Sprache zu entfernen.
Anne
Der vorliegende Sachtext Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht", geschrieben von David Guratzsch und veröffentlicht 2013 auf www.welt.de, thematisiert den Sprachverfall sowie die Untätigkeit der Sprachinstitute.
Bereits die Überschrift "Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht" stellt das Thema des Textes dar und bringt die These des Autors zum Vorschein, dass der Sprachverfall nicht nur eine Illusion oder ein Gefühl ist, sondern wirklich in unserer Gesellschaft passiert.
Der erste Sinnabschnitt (Z.1-5) leitet den Text ein mit einer Akkumulation an Fragen, die sich mit den Vorwürfen an die deutsche Sprache beschäftigen. Bei der ersten wird gefragt ob es überhaupt einen "'Verfall' der deutschen Sprache"(Z.1) gibt. In der zweiten Frage wird nach dem "Konjunktiv"(Z.1-2) gefragt und anhand einer Personifikation ob er aus"[s]tirbt"(Z.1). So schafft es Guratzsch dem "Konjunktiv"(ebd.) eine größere Wichtigkeit zuzusprechen, sodass auch der Erhalt wichtiger wird. Mit der nächsten Frage spricht bezieht sich der Autor auf das Buch Bastian Sicks, welches sich ebenfalls mit Sprachverfall beschäftigt (vgl. Z.2). Auch dient diese Frage als Beleg für einen typischen, sich einbürgernden Fehler: Die fehlende Beachtung der Fälle. Die nächste Frage besteht aus der Antithese des "schludrigen Denglisch [und] dem reinen deutschen Idiom"(Z.2-3). Die Vermischung aus Englisch und Deutsch übernehme die Überhand im Gegensatz zu dem reinen Deutsch. Folgend wird mit der Hyperbel "schauderhafte"(Z.3) die Rechtschreibung beschrieben und mit der Metapher "Totengräber" ausgesagt, dass die deutsche Rechtschreibung ausstirbt, also keine hohe Relevanz mehr besitzt. In der letzten Frage wird nach "Warnern und Gesetzeshüter[n], die den Sprachverderbern das Mundwerk legen"(Z.4-5) verlangt. Mit der Metapher "Gesetzeshüter"(ebd.) sind die Sprachwissenschaftler gemeint, die, nach Guratzsch, dafür sorgen, dass die deutsche Sprache erhalten bleibt und die Sprachverderber aufhören fehlerhaft Deutsch zu sprechen, was mit "Mundwerk legen"(ebd.) gemeint ist. Dies ist also indirekt eine Aufforderung, die Richtigkeit der deutsche Sprache zu bewahren.
Im zweiten Sinnabschnitt (Z.6-12) werden die verschiedenen Institute für deutsche Sprache und deren Ignoranz des Sprachverfalls thematisiert. Er bezieht sich auf die letzte Frage des ersten Sinnabschnitts und sagt aus, dass diese "nicht"(Z.6) als "Gesetzeshüter"(ebd.) fungieren, ihrer Verantwortung also nicht nachkämen. Die dreifache Repetitio des Adverbs "nicht"(Z.6,7) verstärkt dabei nochmal die Negation und somit die Untätigkeit der Sprachinstitute. Im nächsten Satz wird die Metapher "dreigeteilter Olymp"(Z.9) verwendet um auszudrücken, dass die drei Sprachinstitute den Hauptsitz "der deutschen Sprachwissenschaft"(Z.9) darstellen. Dass, dort, metaphorisch gemeint, keine "Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen"(Z.10) vorhanden sind, macht deutlich, dass die Sprachinstitute sich nicht gegen den Sprachverfall verteidigen. Auch wird durch den Substantiv "Hochsitz"(Z.10) das Wortfeld der Jagd eingeleitet, welches im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts zu finden ist. Damit sollt unterstrichen werden, dass es eigentlich die Aufgabe der Sprachinstitute wäre dem Sprachverfall hinterherzujagen, sie es jedoch nicht tun. Es würde "nur angesessen und Buch geführt"(Z.11). Das Adverb "nur"(ebd.) manifestiert dabei, dass dies nicht genug für Dankwart Guratzsch ist und die Institute gegen den Sprachverfall vorgehen sollten. Der nächste Satz greift erneut das Wortfeld der Jagd auf, indem die Formulierung "Rascheln im Gesträuch"(Z.11-12) verwendet wird. Dieses klinge "den Lauernden wie Musik in den Ohren"(Z.12). Dies ist metaphorisch zu verstehen und bedeutet, dass die Veränderungen in der Sprache nicht nur neutral gesehen werden von den Sprachinstituten, sondern sogar erwünscht und schön sind.
Der dritte Sinnabschnitt (Z.13-21) spricht den "'Bericht zur Lage der deutschen Sprache'"(Z.14-15) an. Erneut wird das Substantiv "Pirsch"(Z.13), aus dem Wortfeld Jagd, verwendet, was nochmal die Jagd auf Veränderungen in der deutschen Sprache betont. Auch das Substantiv "Dickicht"(Z.15) lässt sich diesem Wortfeld zuordnen und steht metaphorisch für die vielen Varietäten, die die für eine besonders dichte Bandbreite in der deutschen Sprache sorgt, was auch die Formulierung "strotzt nur so von Leben"(Z.16) zum Ausdruck bringt. Im nächsten Satz wird durch eine Akkumulation aufgelistet, was die Verfasser des Berichts vertreten. Dass dies nicht gleich die Meinung des Autors ist wird durch die Verwendung des Konjunktivs, im gesamten Satz, deutlich. Die Aufzählung dieser positiven Aspekte des Sprachwandels sind von dem Autor ironisch gemeint, da damit nicht seine eigentliche Meinung vertreten wird. Der letzte Satz fungiert al Resümee und bezieht sich wieder auf "[d]ie Jagd"(Z.20). Es gäbe keinen sinnvollen Grund die Sprachveränderungen zu dokumentieren und zu verfolgen wenn nicht gegen sie vorgegangen würde oder Maßnahmen getroffen werden würden, sodass "[d]ie Jagd auf Symptome von Sprachverfall [...] abgeblasen werden kann"(Z.20-21).
Im zweiten Abschnitt seines Textes "Sprachwandel bedingt auch Verlust"(Z.23), thematisiert der Autor, wie der Titel schon sagt, die Verluste die der Sprachwandel birgt. Im vierten Sinnabschnitt (Z.24-30) wird die "Jahrestagung in Mannheim"(Z.25) angesprochen, wo genau dieser Sprachverfall das Hauptthema war. Dort wäre das "Halali"(Z.25) geblasen worden, was metaphorisch dafür steht, dass die Jagd auf den Sprachverfall zu Ende ist, die Sprachwissenschaftler also weiterhin nicht gegen den Sprachverfall vorgehen. Darauf folgt ein Zitat von "Otto Behaghel"(Z.28), welches aussagt, dass sich Sprache stetig "verändert"(Z.26). Dem würden sich "seine Kollegen auch in Mannheim"(Z.29) anschließen. Guratzsch verwendet dabei die Metapher "Evangelium"(Z.29) womit er verdeutlicht, dass sich die Sprachwissenschaftler weiterhin keine Gedanken um den Sprachverfall machen, sondern ihn einfach hinnehmen würden. Ein Argument deren Seite sei "Stillstand bedeute Tod"(Z.30), sodass sich sagen lässt, dass Veränderungen eine Sprache leben lässt.
Der fünfte Sinnabschnitt (Z.31-37) beschäftigt sich mit der Meinung der "deutschen Öffentlichkeit"(Z.32) im Gegensatz zu der, der Sprachwissenschaftler. Die Meinung der "deutschen Öffentlichkeit"(ebd.) sei jedoch nicht direkt angesprochen worden, da nur der sie erfassen konnte, der "ganz genau hinhörte"(Z.31). Außerdem wird deutlich, dass sich die Ansichten der Sprachwissenschaftler und die der Gesellschaft stark unterscheiden, da "von etwas ganz anderem [...] die Rede war"(Z.32-33). "Für den Sprachwissenschaftler [sei] ja das Faszinosum [...] gerade der Wandel"(Z.33-34), was durch eine folgende Akkumulation an Antithesen unterstützt wird. Der "Sprachwissenschaftler"(ebd.) würde Veränderungen der Sprache nicht in Kategorien einordnen, sondern sie rational als Faktum betrachten. Antithetisch zu diesem Satz, formuliert der Autor die Anliegen des "Normalbürger[s]"(Z.35) in einer Akkumulation, alliterativ "als Fülle, Farbigkeit, Feinheit im Ausdruck"(Z. 36). Dies verschafft nochmal ein besonderes Augenmerk auf diese Anliegen, die ebenfalls für den Autor eine große Rolle spielen. Mit dem nächsten Satz bezieht sich Guratzsch auf die Überschrift des Abschnitts und hebt den "Verlust"(Z.37) der Schönheit und Richtigkeit der Sprache hervor, dem der "Normalbürger"(ebd.) hinterher trauern muss.
Der nächste Sinnabschnitt (Z.38-44) beschäftigt sich mit der Zukunft der Sprache. Dabei werden zuerst zwei Fragen gestellt, die sich mit den möglichen Verlusten, die im vorherigen Satz angesprochen werden, auseinandersetzen. Zuerst wird gefragt ob "Jugendliche [...] in fünfzig Jahren überhaupt noch Goethe [...] im Original lesen [werden] können "(Z.38-39). Goethe ist im Deutsch Unterricht der Oberstufe Standard, sodass der Verlust für die Bildung enorm wäre. In der zweiten Frage ist von dem Verlust von "Vokabeln"(Z.39) die Rede der für das Unverständnis von Goethe verantwortlich wäre. Im Folgenden wird wieder auf "Mannheim"(Z.40) Bezug genommen. Dort würden diese Frage nicht thematisiert. Die Wortverbindung "nicht einmal"(Z.41) betont die Verneinung und somit das Empören des Autors über die Untätigkeit der Sprachwissenschaftler. An "Schulen"(Z.42) sei dies jedoch "eine Kernfrage"(Z.41). Dies macht deutlich, dass die Zukunft der deutschen Sprache sogar im Volk eine wichtige Rolle spielt und die "Linguisten"(Z.42) dies einfach abtun, obwohl gerade sie die "Lehrer"(Z.42) ausbilden und somit eigentlich eine größere Verantwortung haben. Die Metapher "nicht auf dem Schirm" (Z.43) haben, macht deutlich, dass es den Sprachwissenschaftlern gar nicht bewusst ist was der Sprachverlust für Konsequenzen hat, da sie nicht sie nahe an dem Wandel teilhaben wie "Lehrer"(ebd.).
Der erste Sinnabschnitt (Z.78-84) des letzten Abschnitts "Vokabeln der deutschen Hochsprache schwinden"(Z.77) thematisiert das Scheitern der "Sprachrevolutionäre"(Z.79). Im ersten Satz wird deutlich, dass das Scheitern besonders für sie "fatal"(Z.80) ist, sie also die Verantwortung für den Verfall der deutschen Sprache tragen. Mit der "Einebnung der Sprache, gegen den 'elaborierten Code'"(Z.80-81) ist der Versuch gemeint, die Sprache in der Gesellschaft so anzupassen, dass es keine großen Unterschiede zwischen verschieden gesellschaftlichen Schichten, sodass eine Klassengesellschaft vermieden wird. Dieser "Kampf [...] ist [...] gescheitert"(Z.80-81). Dadurch, dass aufgrund essen das Sprachniveau mittlerweile so vereinfacht wurde, ist es "einer ganzen Generation [...] verbaut"(Z.81-82) an dem "Bildungskanon"(Z.82) teilzunehmen. Somit wurde das Ziel nicht nur verfehlt sondern in die genau gegensätzliche Richtung getragen (vgl. Z.83-84), woraus eine großer Unterschied zwischen verschieden gesellschaftlichen Schichten entsteht, da die Kommunikation erschwert wurde.
Im nächsten Sinnabschnitt (Z.85-93) wird über die Konsequenzen, die der Sprachverfall mit sich bringt, geredet. "Der Verlust an Vokabular"(Z.85) wird hier als "das alarmierendste Symptom für Sprach-(und Kultur-)verfall ist"(Z.86-87) betitelt. Durch die Verwendung des Superlativs des Adjektivs "alarmierend" wird manifestiert, dass der Verfall sehr offensichtlich ist. So ist der Autor wieder Kritik an die Sprachwissenschaftler mit einfließen, da diese untätig gegenüber dem Sprachverfall sind. Im Folgenden wird noch einmal genauer erläutert, dass die die Lücke zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten vergrößert wird anhand einer Antithese (vgl. Z.88). Diese Antithese wird durch die adversative Konjunktion "sondern"(Z.88) eingeleitet und verstärkt den Kontrast, und somit das Scheitern, zwischen dem Ziel der "Sprachrevolutionäre"(ebd.) und dem was dabei heraus gekommen ist. Daraufhin wird eine zweites wichtiges Problem, das der Sprachverfall mit sich bringt angesprochen: Schwierigkeiten bei "der Integration von Migranten"(Z.89). Mit dem Vergleich "wie eine Barrikade"(Z.90), veranschaulicht Guratzsch, dass der Sprachverfall eine große Behinderung darstellt und sogar Menschen aus anderen Ländern vor Probleme stellt. Der Grund dafür wird folgend veranschaulicht indem gesagt wird, dass die "Irrlehren"(Z.91), der Sprachwissenschaftler, welche "Sprachkultur [...] als Ausweis kultureller Identität"(Z.91) als nicht nötig betrachten, sich nicht durchgesetzt haben. Somit bringt er zum Schluss seine These, dass sie noch "als Ausweis kultureller Identität"(ebd.) gilt, an. Den Migranten ist es also nicht möglich vernünftig integriert zu werden, da auch sie nicht die Möglichkeit haben, die deutsche Sprache fehlerfrei zu erlernen, sodass auch sie in der unteren Schicht der Gesellschaft verweilen, ohne Aufstiegschancen. Dies wiederrum führt zu enormen Vorurteilen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Autor seine Meinung und sein Anliegen, die Sprachwissenschaftler müssten mehr gegen den Sprachverfall tun, durch eine stringente Struktur, Metaphorik und Akkumulationen, vertritt.
Luisa
Der vorliegende Sachtext ,,Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht” wurde von Dankwart Guratzsch geschrieben und im Jahre 2013 von der deutschen Tageszeitung Welt auf dessen Webseite www.welt.de veröffentlicht. Der Sachtext setzt sich einerseits mit dem Sprachverfall auseinander aber auch mit den daraus resultierenden Reaktionen.
Schon in der Überschrift wird deutlich was im vorliegenden Sachtext thematisiert wird. Die These, ob ein Sprachverfall vorliegt, wird sofort durch die Überschrift bestätigt. Der Autor ist somit der Meinung, dass ein Sprachverfall die deutsche Sprache prägt. Der erste Sinnabschnitt (Z.1 -5) beinhaltet viele Fragen mit denen der Autor die Problematik aufgreift. Die erste Frage untermauert die These der Überschrift, denn in dieser fragt der Autor, ob ,,es einen ,,Verfall” der deutschen Sprache [gäbe]?” (Z.1). Auf diese Frage folgen viele weitere wie ,,Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?[...] Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber?” (Z.2ff.). Die Frage, ob ,,der Dativ dem Genitiv sein Tod [sei]?” (ebd.) bezieht sich auf das Buch ,,Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod” von Bastian Sick, indem die These des Titel behaltet wird. Dass der Autor diese Fragestellung einbaut, zeigt dass er verdeutlichen will, dass sich viele anderen Autoren auch mit dem Sprachverfall beschäftigen und die Konsequenzen aus diesem Verfall der Sprache verdeutlichen wollen, da niemand versucht den Sprachverfall aufzuhalten, das wird in der nächste Frage deutlich ,,Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen?” (Z.4f.).
Christine
Der vorliegende Sachtext „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“, verfasst von Dankwart Guratzsch und veröffentlicht im Jahr 2013 auf www.welt.de, thematisiert den Verfall der deutschen Sprache.
Der erste Sinnabschnitt (Z. 1- 21) stellt eine Einführung in die Thematik des Textes dar. Somit wird dem Leser direkt am Anfang ein Einblick gegeben, wodurch der Verfall der deutschen Sprache begünstigt wird. Einleitend wird zunächst die Frage gestellt, ob es „einen 'Verfall' der deutschen Sprache“ (Z. 1) gebe. Darauffolgend werden weitere Fragen gestellt, die vor Augen führen, welche Gebiete der deutschen Sprache, darunter der Konjunktiv, die Kasus, Anglizismen und die Rechtschreibung, von diesem Verfall am meisten betroffen sind (vgl. Z. 1ff.). Auf die letzte Frage, „wo […] die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen“ (Z. 4f.) seien, antwortet er dass sie „jedenfalls nicht im Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, nicht in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch nicht in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt“ (Z. 6ff.) zu finden seien. Die Metapher „Gesetzeshüter“ (ebd.) bezieht sich darauf, dass eine Aufgabe der verschiedenen Institutionen darin bestehe, die deutsche Sprache zu bewahren und dafür zu sorgen, dass sie rechtmäßig eingehalten wird, so wie Gesetzeshüter dafür sorgen, dass das Gesetz eingehalten wird. Indem der Autor behauptet, dass sie nicht dort zu finden seien, übt er Kritik daran aus, dass diese sprachlichen Institutionen nichts gegen den Verfall der deutschen Sprache unternehmen. Die drei Institutionen wird metaphorisch als „dreigeteilte[r] Olymp der deutschen Sprachwissenschaft“ (Z. 9) bezeichnet. Der „Olymp“ (ebd.) ist der höchste Berg in Griechenland und in der griechischen Mythologie der Wohnort der Götter. Somit werden sie als oberste Instanz „der deutschen Sprachwissenschaft“ (ebd.) beschrieben, denen auch die Verantwortung für den Erhalt der deutschen Sprache zugeschrieben wird. Des Weiteren wird metaphorisch beschrieben, dass diese Institutionen „ein Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“ (Z. 10) seien. Die „Mauern“ (ebd.) symbolisieren Isolation, die „Schwerter und Kanonen“ (ebd.) Verteidigung bzw. Angriff. Der Autor kritisiert metaphorisch, dass die Institutionen sich nicht gegen den Verfall der deutschen Sprache wehren, also nichts dagegen unternehmen, und sich auch mehr oder weniger von dem Verfall abwenden. Es werde „nur angesessen und Buch geführt“ (Z. 11), man warte also nur darauf, dass es Anzeichen einer Veränderung in der Sprache gibt und die man anschließend dokumentiert; unternommen werde aber aktiv nichts. Um darzustellen, zu welchen Ergebnissen man bei der Dokumentation der Veränderungen komme, nennt er den „'Bericht zur Lage der deutschen Sprache'“ (Z. 14f.) und fasst ironisch den Inhalt zusammen. So „[strotze] das Dickicht des Gegenwartsdeutschs […] nur so von Leben“ (Z. 15f.), „der deutsche Wortschatz sei heute reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 16f.) usw. In Bezug zu den anfangs gestellten Fragen ist zu sagen, dass der Autor eine Veränderung bzw. einen Verfall der deutschen Sprache sieht. Abschließend sagt er, dass „die Jagd auf Symptome von Sprachverfall […] abgeblasen werden [kann]“ (Z. 20f.), es also bekannt ist, welche Aspekte des Sprachverfalls vorhanden sind. Dadurch macht der Autor nochmals seine Meinung deutlich, dass nicht gegen den Verfall der deutschen Sprache unternommen wird, obwohl laut dem Bericht Bereiche, wo der Verfall deutlich wird, bekannt sind.
Diana
Bei dem vorliegenden Text von Dankwart Guratzsch mit dem Titel ,,Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ handelt es sich um einen Sachtext, welches im Jahr 2013 auf der Webseite www,welt.de veröffentlicht wurde. Thematisiert wird der Verfall der deutschen Sprache und den daraus resultierenden Konsequenzen.
Bereits der Titel des Textes ,,Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ verdeutlicht das Thema des Sachtextes und stellt zu dem die These des Autors dar, wobei dieser behauptete, dass der Sprachverfall des Deutschen Realität sei und nicht nur ein bloßes Gefühl oder eine Vermutung sei. Des Weiteren leitet der Autor das Thema mit der rhetorischen Frage ,,Gibt es eine 'Verfall' der deutschen Sprache?“ (Z.1), wobei diese Frage die Leitfrage der folgenden Argumentation darstellt und den Titel in Form einer Frage nochmals aufgreift, wobei der Titel jedoch bereits die Antwort auf diese Frage darstellt. Diese Frage wird in den weiteren rhetorischen Fragen ,,Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Macht das schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus?“ (Z. 1 ff.) konkretisiert, indem die einzelnen Problemfelder genannt werden, die den Sprachverfall kennzeichnen. Das Verb ,,sterben“ (ebd.) im Zusammenhang mit dem Verlust der Verwendung des Konjunktivs verdeutlicht, dass der Konjunktiv immer weniger gebraucht werde und daher in Zukunft keiner den Konjunktiv mehr benutze. Zudem ist bei der rhetorischen Frage ,,Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?“ (ebd.) auffällig, dass der Autor, um Problem des Verlust der Verwendung des Genitivs zu verdeutlichen, selbst in dieser Frage statt des Genitivs den Dativ verwendet und somit das Problem vor Augen führt. Durch das Adjektiv ,,schludrig“ (ebd.) bezogen auf die Verwendung von ,,Denglisch“ (ebd.) im Kontrast zu dem Adjektiv ,,rein“ (ebd.) bezogen auf die Verwendung eines korrekten Deutsch wird deutlich, dass der Autor von den Verwendung des ,,Denglisch“ (ebd.) abgeneigt ist und ein korrektes Deutsch bevorzugt, jedoch befürchtet, dass das ,,reine[.] deutsche[.] Idiom“ (ebd.) von der Mischung aus Deutsch und Englisch abgelöst werde. In der nächsten rhetorischen Frage ,,Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber?“ (Z. 3 f.) wird deutlich, dass die derzeitige Rechtschreibung nicht mehr den Regeln entspreche und Wörter nicht mehr richtig geschrieben werden. Die Metapher ,,Totengräber“ (ebd.) untermauert dabei die negative Einstellung des Autors gegenüber der Veränderung der Rechtschreibung, die immer fehlerhafter werde, wobei das Adjektiv ,,schauderhaft“ (ebd.) ebenfalls eine Wertung des Autors zu der zunehmenden fehlerhaften Rechtschreibung darstellt. Schließlich wird in der folgenden rhetorischen Frage ,,Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen?“ (Z. 4 f.) Menschen, die korrektes Deutsch sprechen, vorgeworfen, dass diese dem Sprachverfall nichts entgegenwirken würden und Menschen mit Sprachfehlern auch nicht korrigieren würden. Das Nomen ,,Gesetzeshüter“ (ebd.) untermauert dabei die Wichtigkeit der Fährigkeit, korrektes Deutsch sprechen zu können, sodass es sogar notwendig sei, Menschen mit Sprachfehlern zu korrigieren. Diese rhetorische Frage beantwortet des Autor im Folgendem durch die Aussage ,,Jedenfalls nicht im Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, nicht in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch nicht in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt“ (Z. 6 ff.), wobei er dadurch die Instituten für Deutsche Sprache dafür kritisiert, dass diese nichts gegen den Sprachverfall unternehmen würden, obwohl es eigentlich die Aufgabe der Instituten für Deutsche Sprache sei dem Sprachverfall entgegenzuwirken. Die nächste Aussage ,,Der dreigeteilte Olymp der deutschen Sprachwissenschaft […] ist ein Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“ (Z. 9 f.) verdeutlicht metaphorisch ebenfalls, dass die Institute dem Sprachverfall nicht entgegenwirken würden. Die Metapher ,,Olymp der deutschen Sprachwissenschaft“ (ebd.) spielt dabei auf die Mythologie des griechischen Götterbergs an, wodurch deutlich wird, dass der Autor der Meinung ist, dass die Institute eigentlich die Macht besitzen dem Sprachverfall entgegenzuwirken jedoch andererseits der Olymp ,,ohne Götter, Mauer, Schwerter und Kanonen“ (ebd.) sei, womit metaphorisch also gemeint ist, dass diesen jedoch die Mittel fehlen um dem Sprachverfall zu bekämpfen bzw. diese den Sprachverfall auch nicht verhindern wollen würden. Dies ist so zu erklären, dass dort ,,nur gesessen und Buch geführt“ (Z. 11) werden würde, wodurch vor Augen geführt wird, dass die Sprachwissenschaftler nur den Sprachverfall dokumentieren, aber nichts dagegen unternehmen würden, wobei durch Adverb ,,nur“ (ebd.) zum Ausdruck gebracht wird, dass nach der Meinung des Autors, die Sprachwissenschaftler etwas gegen den Sprachverfall unternehmen müssten statt diesen bloß zu dokumentieren. Diese Ansicht wird durch die Metapher ,,Und jedes Rascheln im Gesträuch klingt den Lauernden wie Musik in den Ohren“ (Z. 11 f.) untermauert, da die ,,Lauernden“ (ebd.) die Sprachwissenschaftler metaphorisch darstellen, welche nur darauf warten Veränderungen der Sprache zu dokumentieren und dies dabei ,,wie Musik in den Ohren“ (ebd.) für diese sei. Des Weiteren kritisiert der Autor, dass die Autoren eines Berichts zur aktuellen Situation der deutschen Sprache (vgl. Z. 14 f.) berichten würden, dass das ,,Dickicht des Gegenwartsdeutschs […] nur so von Leben“ (Z. 15 f.) strotze und nennt weiterhin Aspekte, die in dem Bericht genannt werden. Dabei erwähnt der Autor ironisch, dass dort stünde, dass der ,,deutsche Wortschatz […] heute reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 16 f.) sei und die Grammatik ,,immer einfacher“ (Z. 17 f.) werde. Die Ironie wird besonders auch in der Aussage ,,selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“ (Z. 19. f.) deutlich, da besonders das Adjektiv ,,hässlich“ (ebd.) hervorbringt, dass der Autor eine völlig andere Meinung vertritt als die Autoren des Berichts, die die Veränderungen der deutschen Sprache positiv werten, da diese ,,einfacher“ (ebd.) werde. Auch die Aussage ,,Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z. 20 f.) verdeutlicht die Ironie des Autors, der die gegenteilige Meinung als die der Autoren des Berichts vertritt, da nach Guratzsch es notwendig sei dem Sprachverfall entgegenzuwirken, jedoch die Autoren des Berichts die Sprachveränderung sogar positiv sehen. Dies kritisiert Guratzsch durch die Ironie in seiner Aussage.
Nina H.
Bei dem vorliegenden Textauszug handelt es sich um den Sachtext mit dem Titel „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“, welcher von Dankwart Guratzsch verfasst und im Jahr 2013 auf der Internetseite „www.welt.de“ veröffentlicht wurde. Thematisiert werden die Folgen des Wandels der deutschen Sprache.
Bereits die Überschrift des Sachtextes „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ leitet in die Thematik ein und hebt die Meinung des Autors zum Thema Sprachwandel hervor. Insbesondere die Tatsache, dass der Autor von einem Verfall der Sprache spricht deutet die Konsequenzen des Sprachwandels an, da die Sprache durch jenen langfristig zugrunde gehe. Dabei spricht er nicht davon, dass der Sprachverfall lediglich ein Trugschluss sei, sondern das „Gefühl“ (ebd.) tatsächlich existiere, was die Auswirkungen nochmals betont.
Der Textauszug setzt mit der rhetorischen Frage des Autors „Gibt es einen `Verfall` der deutschen Sprache“ (Z.1) ein. Diese Frage konkretisiert er weiterhin, indem er fragt „Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?“ (Z.1 f.). Insbesondere das Verb „sterben“ (ebd.) und das Substantiv „Tod“ (ebd.) akzentuieren das Ausmaß des Sprachverfalls. Zudem ist besonders die Frage „Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?“ (ebd.) auffällig. Primär ist anzumerken, dass diese Frage an ein Buch Bastian Sicks mit dem Titel „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ angelehnt ist. Jenes beschäftigt sich in belustigender Weise mit den Regeln der deutschen Sprache, insbesondere der Grammatik. Auf ironische Art und Weise ist hier bereits der Titel des grammatikalisch inkorrekt, was den Sprachverfall hervorhebt. Die Tatsache, dass Guratzsch diesen Titel aufgreift untermauert seine These und hebt hervor, dass der Sprachverfall tatsächlich ein zentrales Problem darstellt. Anschließend folgt die Frage, ob das „schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus“ (Z.2 f.) mache. Das sogenannte „Denglisch“ (ebd.) kennzeichnet die Vermischung der deutschen mit der englischen Sprache aufgrund der vermehrten Verwendung von Anglizismen. Diese Anglizismen fließen in die deutsche Sprache ein und verändern diese, was letztlich zum Sprachwandel und nach Guratzsch zum Sprachverfall führt. Das sogenannte Denglisch bezeichnet der Autor als „schludrig[.]“ (ebd.), was darauf hindeutet, dass er diese Sprache als unrein empfindet, wodurch er jene abwertet. Im Gegensatz dazu spricht er von dem „reinen deutschen Idiom“ (ebd.), womit möglicherweise das Hochdeutsche gemeint ist. Jene für ihn tadellose Sprache werde von dem Denglisch in „den Garaus“ (ebd.) geführt, also vertrieben, was die Konsequenzen des Sprachwandels hervorhebt und deutlich zeigt, dass hier von einem Verfall der reinen deutschen Sprache die Rede ist, da jene Stück für Stück von den Vermischungen mit anderen Sprachen oder Dialekten verdrängt werde. Daraufhin geht er auf die „schauderhaft neue Rechtschreibung“ (Z.3 f.) ein, was sich auf die vermehrt auftretende fehlerhafte Rechtschreibung beziehen lässt. Die Tatsache, dass er jene als „schauderhaft“ (ebd.) und als „Totengräber“ (Z.4) bewertet, untermauert nochmals, dass er den Sprachverfall als Problem ansieht und es als notwendig erachtet, jenem entgegenzuwirken. Dazu seien „Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen“ (Z.4 f.) notwendig. An dieser Stelle macht er in gewisser Weise die Gesetzeshüter beziehungsweise in letzter Konsequenz den Staat dafür verantwortlich, dass der Sprachverfall weiterhin fortschreitet, da jene einschreiten. Dies entspricht jedoch nicht ihrem Zuständigkeitsbereich, da jene sich primär um Verbrechen kümmern, was andeutet, dass er auch die Faktoren, wie die Verwendung von Anglizismen, die zum Sprachverfall führen, als Verbrechen ansieht. Um dies hervorzuheben, überträgt er die Redewendung, jemandem das Handwerk zu legen auf das „Mundwerk“ (ebd.) und somit auf den Sprachverfall, da er jenen als wichtiges Anliegen erachtet. Den Sprachverfall verortet der Autor jedoch „nicht im Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, nicht in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch nicht in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt“ (Z.6 ff.). Dort findet zwar kein Sprachverfall statt, jedoch gehen diese Institute nicht gegen jenen vor, weshalb er sie anklagt. Des Weiteren vergleicht er diese Institute mit einem „dreigeteilte[n] Olymp der deutschen Sprachwissenschaft“ (Z.9), was auf den ersten Blick den Anschein erweckt, als lobe er jene Institute. Die darauffolgende Aussage, dass es sich dabei jedoch um einen „Hochsitz ohne Götter“ (Z.10) handele, stellt das Gegenteil dar. Mit dieser Aussage deutet er an, dass die Sprachwissenschaftler keinesfalls als „Götter“ (ebd.) zu bezeichnen sind, da jene nichts gegen den Sprachverfall unternehmen. Die Tatsache, dass er dennoch den Vergleich des „Olymp[s]“ (ebd.) und des „Hochsitz[es]“ (ebd.) anführt, lässt erkennen, dass er das von jenen verwendete reine Deutsch, welches keinen Sprachwandel aufzeigt, lobt. Andererseits könnte es auch darauf hindeuten, dass jene Sprachwissenschaftler sehr von sich selbst und ihrem Wissen über die deutsche Sprache überzeugt sind und sich Anderen aufgrund dessen übergeordnet fühlen. Deshalb ignorieren sie den Sprachverfall und gehen nicht mit „Mauern, Schwerter[n] und Kanonen“ (Z.10) gegen ihn vor. Diese Metapher betont nochmals, dass die Wissenschaftler an den Instituten nichts gegen den Sprachverfall unternehmen, was der Autor kritisiert. Diese Kritik zeigt sich auch, wenn er erläutert, an den Instituten werde „nur angesessen und Buch geführt“ (Z.11), da dies auf die Lustlosigkeit der Sprachwissenschaftler hervorhebt, was insbesondere das Adverb „nur“ (ebd.) untermauert.
Daraufhin vergleicht er das Verhalten der Sprachwissenschaftler mit der „Pirsch“ (Z.13). Dabei handelt es sich um eine Art der Jagt, bei welcher Wild durch möglichst lautloses Durchstreifen eines Jagdreviers aufgespürt wird. Dies bringt nochmals das Desinteresse jener am Sprachverfall sowie die Tatsache, dass sie nichts gegen diesen unternehmen zum Ausdruck. So klinge „jedes Rascheln im Gesträuch […] den Lauernden wie Musik in den Ohren“ (Z.11 f.), was hervorhebt, dass die Sprachwissenschaftler die vermehrt auftretenden Fehler in der deutschen Sprache und insbesondere der Grammatik wahrnehmen, sich von jenen jedoch in gewisser Weise belustigt fühlen und sich an ihnen erfreuen, statt gegen sie vorzugehen. Anschließend geht er auf den „`Bericht zur Lage der deutschen Sprache`“ (Z.14 f.) ein und führt dabei den Vergleich der Institute mit der Pirsch weiterhin fort. So strotze das „Dickicht des Gegenwartsdeutschs […] nur so von Leben“ (Z.15 f.). Des Weiteren würden die Autoren dieses Berichtes behaupten, der „deutsche Wortschatz sei heute reicher als zu Goethes Zeiten, die Grammatik werde immer einfacher, die Anglizismen ließen sich verschmelzen“ (Z.16 ff.). Dies entspricht keinesfalls der Auffassung Guratzschs, da beispielsweise die Anglizismen seiner Meinung nach zum Sprachverfall beitragen, was vermuten lässt, dass er diesen Bericht sowie die darin geäußerten Thesen ironisch aufführt. Außerdem werde in dem Bericht aufgeführt, „selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“ (Z.18 f.). An dieser Stelle macht besonders das Adjektiv „hässlich“ (ebd.) deutlich, dass Guratzsch den Aussagen des Berichtes nicht zustimmt und sie lediglich auf ironische Art und Weise in seinen Sachtext mit einfließen lässt. Diese Wertung bezogen auf jene „Streckverbgefüge“ (ebd.) führt nochmals vor Augen, dass er jene Veränderung der deutschen Sprache als Verfall ansieht und diese aufgrund dessen nicht als „sinnvoll“ (ebd.) bezeichnen würde. Letztlich fasst er seine zuvor genannten Aussagen zusammen, indem er behauptet, die „Jagd auf Symptome von Sprachverfall“ (Z.20 f.) könne beendet werden. Dies hebt erneut hervor, dass er den Sprachverfall als eine zentrale Problematik ansieht, welche aufgrund des mangelnden Interesses jedoch nicht behoben werden kann.
Sarah
Der Sachtext „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“, welcher von Dankwart Guratzsch verfasst und im Jahre 2013 auf der Website der Zeitung „Welt“ veröffentlicht wurde, thematisiert den Wandel in der deutschen Sprache inklusive einhergehender Verluste.
Der erste große thematisch einleitende Abschnitt lässt sich dabei in drei Sinnabschnitte unterteilen. Den ersten unter diesen beginnt Guratzsch mit einer Auflistung von Fragen. Dabei beginnt er mit der Frage „Gibt es einen `Verfall´ der deutschen Sprache?“(Z. 1), in welcher er die Existenz eines Sprachverlustes überhaupt erst hinterfragt. Dass diese Frage für ihn jedoch eindeutig mit „ja“ beantwortbar sei, zeigt sich in Beziehung zum Titel, welcher in der Verneinung „nicht trügen“ bereits zeigt, welche Meinung der Autor vertritt. Auf diese, im Kontext eher allgemeiner gefasste Frage, stellt Guratzsch fünf konkretere Fragen, die sich alle mit der Veränderung oder dem Verlust von Sprache beschäftigen. So hinterfragt er metaphorisch „Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Macht das schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus?“(Z. 1ff. ), also besonders die sprachlichen Veränderungen, wie den Einfluss des Englischen und das Vereinfachen grammatikalischer Strukturen, die in der heutigen Welt vermehrt auftreten. Dazu macht er sich besonders Personifikationen zu Nutze, wie sie auch in der Redewendung „Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?“(ebd. ) verwendet werden, um gewissermaßen auch zu hinterfragen, wie aktiv oder passiv der Sprachwandel geschieht. Also ob dieser aus sich heraus geschieht oder durch die Menschen veranlasst wird. Zudem bringt er auch bereits in diesen ersten Fragen seine eindeutige Meinung ein, indem er das sogenannte „Denglisch“(ebd. ) wertend als „schludrig“(ebd. ) bezeichnet. An diese Fragen anschließend führt er so auch die letzte Frage an, die sich mit der Existenz des Sprachverfalls beschäftigt und somit weiterführend die anfängliche Fragestellung ausdifferenziert. „Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber“(Z. 4) zeigt dabei wiederholend mit Metaphorik und dem wertenden Adjektiv „schauderhaft“(ebd. ) die meinung des Autors. Im Anschluss hinterfragt Guratzsch dann zuletzt die Ursache des Sprachverfalls, womit er indirekt die Frage nach der Existenz bejahend beantwortet. So stellt er in „Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen?“(Z. 4 F. ) die These an, dass es eben an diesen Menschen fehle, die den Sprachverlust verhindern. Somit zeigt er zugleich, dass niemand die Kontrolle darüber habe, was geschehe, wenn auch niemand etwas tue. Deutlich wird hier also bereits indirekt eine Art Appell an jene „Warner und Gesetzeshüter“(ebd. ), etwas zu tun, um den Wandel zu kontrollieren.
Im zweiten Sinnabschnitt knüpft Guratzsch daraufhin an eben diese Fragestellung an, indem er beispielhaft drei große Institute nennt, die „[j]edenfalls nicht“(Z. 6) die Rolle der Gesetzeshüter übernehmen. So übt der Autor in dieser Aussage akkumulierend Kritik am „Institut für deutsche Sprache in Mannheim, […] der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch […] der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt“(Z. 5ff. ) und appelliert indirekt konkret an diese, etwas zu ändern. Seine Wahrnehmung dessen, dass die Institute nichts gegen den Sprachverfall täten, bringt er im Anschluss noch einmal wesentlich bildlicher zum Ausdruck, indem er Gebrauch vom Wortfeld der Jagd macht. So haben die Institute, die er hyperbolisch mit der Metapher „Der dreigeteilte Olymp der deutschen Sprachwissenschaft im Rhein-Neckar-dreieck“(Z. 7 f. ), also als sprachliche Spitzenklasse bezeichnet, keinerlei Mittel zur Schaffung einer Veränderung. Diese seien also metaphorisch „ein Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“(Z. 9). Eben diese Akkumulation bringt dabei zum Ausdruck, dass der Autor meint, dass es an Potential die Welt zu beeinflussen wie eben ein Gott, Distanz zur Situation – einer Art Mauer - und notwendigen Methoden und Materialien fehle, wofür die „Schwerter und Kanonen“(ebd. ) symbolisch stehen. Die daran anschließende Aussage „Hier wird nur angesessen und Buch geführt“(Z. 11) zeigt aber insbesondere, dass es den Instituten nicht nur an Möglichkeiten, sondern auch an Willen zur Veränderung fehle. Somit unterstellt der Autor den Instituten hier, fehlendes Interesse am Erhalt der deutschen Sprache. Zuspitzend meint er so auch „Und jedes Rascheln im Gesträuch klingt den lauernden wie Musik in den Ohren“(Z. 11 f. ). Mit dieser Metapher zeigt er erneut, dass die Institute wenig bewirken und dass somit jede kleinste Aktion in Richtung Veränderung oder Stoppen des Wandels für diejenigen, die sich den Wandel erhoffen, ein großer Erfolg und somit bereits eine positive Wendung sei. Dies zeigt zum einen, was besonders der eher hyperbolische Vergleich mit der „Musik“(ebd. ) deutlich macht, wie wichtig dem Autor sein Anliegen ist, drückt aber umso verstärkter aus, wie wenig die Institute gegen den Sprachverlust täten und somit unterstellt Guratzsch ihnen hier erneut fehlendes Interesse sowie eine gewisse Faulheit.
Im letzten Sinnabschnitt des ersten großen thematischen Absatzes nennt er für eben diese These das Beispiel des „`Bericht zur Lage der deutschen Sprache´“(Z. 14f. ). Eben dieser sei das Ergebnis einer „solcher Pirsch“(Z. 13), womit Guratzsch sich erneut auf die Jagd ohne Waffen bezieht, indem das Pronomen „solcher“(ebd. ) ausdrückt, dass er sich auf das vorherige bezieht. Um erneut eine Brücke zum Anliegen seiner selbst, der Veränderung, zu schlagen und somit den Text kohärent zu verknüpfen, geht er darauf ein, dass eben dieser Bericht „mit großer Spannung erwartet“(Z. 13f. ) wurde. Anschließend geht er dann näher auf die aus diesem Bericht stammenden Ergebnisse ein. So strotze „Das Dickicht des Gegenwartsdeutschs […] nur so von Leben“(Z. 15f. ). Hierbei bringt der Autor im Ausdruck „Dickicht“(ebd. ) erneut seine Abneigung von der Veränderung zum Ausdruck, indem er diesen Ausdruck kontrastierend der positiven Kritik der Institute gegenüberstellt. Diese sähen darin so die Vielfalt das Lebens und die Auslebung dessen durch die Menschen, keinesfalls aber einen Sprachverlust. Weiterhin sei „der deutsche Wortschatz […] heute reicher als zu Goethes Zeiten“(Z. 16f. ), so die Verfasser des Berichts. Aber nicht nur den Vergleich mit Goethe, sondern auch Aussagen wie „die Grammatik werde immer einfacher, die Anglizismen ließen sich verschmelzen“(Z. 17f. ) beschreibt der Autor negativ kritisierend eher als euphemistisch und drückt somit seine Meinung, der Realitätsferne des Berichts, zum Ausdruck. Seine Meinung zeigt sich anschließend noch einmal verstärkt im Abschluss der Akkumulation in „selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“(Z. 18ff. ). Darin spricht er im Adjektiv „hässlich“(ebd. ) äußerst abwertend von der Veränderung und zieht zuletzt den Bericht mit seinen Ergebnissen und so zuletzt auch die Institute ins lächerliche. So würden diese den Sprachverlust nicht verhindern wollen, was er abschließend auch noch einmal mit den Worten „Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“(Z. 20f.), mit welchen er aus der Sicht der Institute spricht, verdeutlicht. So empfänden diese die Veränderung als nicht dramatisch, sähen sogar das positive darin und wollen daher auch nicht den Ursprung des Sprachwandels ergründen. Die Ausdrucksweise des Autors jedoch zeigt, dass er sich deutlich von dieser Wahrnehmung der Institute distanziert, diese kritisiert und somit den Sprachverfall als relevantes Problem akzentuiert.
Lorena
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ handelt es sich um einen Sachtext, verfasst von Dankwart Guratzsch und veröffentlicht auf der Internetseite www.welt.de, befasst sich mit dem Wandel der Deutschen Sprache und den daraus resultierenden Auswirkungen.
Der zu analysierende Text setzt ein mit der Frage „Gibt es einen „Verfall“ der deutschen Sprache?“ (Z. 1). Mit dieser zentralen Fragestellung leitet der Autor den ersten Abschnitt seines Artikels ein. Er nutzt weiterhin den gängigen Ausdruck „‘Verfall‘“ im Bezug zum Sprachverlust. Der Umstand, dass dieser Ausdruck in Anführungszeichen steht veranschaulicht, dass es sich dabei um kein anerkanntes Fachwort handelt, sondern diese Formulierung meist umgangssprachlich verwendet wird. Der Autor begibt sich somit auf die gleiche sprachliche Ebene, auf der sich seine Leser befinden. Weiterhin stellt der Autor die Fragen „Stirbt der Konjunktiv?“ (Z. 1 f.) und „Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?“ (Z. 2). Diese Fragen sind durchaus bekannt und wurden schon von anderen Autoren, die sich ebenfalls mit dieser Thematik befassten, formuliert. Mit dem Aussterben des Konjunktivs befasste sich Bastian Sick im Jahr 2004 in seinem Artikel „Der traurige Konjunktiv“, veröffentlicht bei Spiegel Online. Der Ausdruck „Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?“ (ebd.) ist nicht nur auf Grund der beabsichtigten falschen Verwendung des Genitivs in der Fragestellung markant, sondern erlangte auch durch das gleichnamige Buch von Bastian Sick an besonderes Aufsehen. Mit dem Verweis auf den bekannten Autor Bastian Sick, der für das renommierte Nachrichtenmagazin „Spiegel“ schreibt, wird die Bedeutung der Thematik hervorgehoben und die Leser an die Beiträge erinnert, die bereits vor einigen Jahren für Aufsehen gesorgt haben. Nachfolgend merkt der Autor an „Macht das schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus?“ (Z. 2 f.). Anzumerken sind in dieser Textpassage die Phrasen „das schludrige Denglisch“ (ebd.) und „dem reinen deutschen Idiom“ (ebd.) die sowohl im Satzgefüge einen Kontrast bilden und auch darüber hinaus eine Antithese bilden. Insgesamt wird in dieser Antithese das „Denglisch“ (Z. 2), eine Vermischung der Sprachen Deutsch und Englisch, insbesondere durch das Adjektiv „schludrig[…]“ (Z. 2) als geringwertig im Gegensatz zum „reinen deutschen Idiom“ (Z. 3) dargestellt. Das Substantiv „Idiom“ entstammt aus dem Fachvokabular der Sprachwissenschaft und bildet somit einen weiteren Kontrast zum umgangssprachlichen Ausdruck „Denglisch“ (ebd.). Neben der Problemstellung nennt der Autor in der Frage „Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber“ (Z. 3 f.) eine mögliche Ursache für den Sprachverlust an. Die Einleitung schließt er mit dem indirekten Vorwurf „Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen?“ (Z. 4 f.).
An diesen Vorwurf knüpft er im weiteren Verlauf mit der Anmerkung „Jedenfalls nicht im Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, nicht in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch nicht in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt“ (Z. 6 ff.) an. Die von ihm aufgezählten Institutionen werden von ihm als „Der dreiteilige Olymp der deutschen Sprachwissenschaft im Rhein-Neckardreieck“ (Z. 8 ff.) bezeichnet. Alle drei Institutionen sind unabhängig vom deutschen Staat und konzentrieren sich in ihrer Hauptaufgabe auf die Erforschung bzw. Erhaltung und Pflege der deutschen Sprache. Der Umstand, dass der Autor diese mit dem Olymp gleichsetzt untermauert deren hohen Stellenwert in der deutschen Sprachwissenschaft, da der Berg Olymp die mythologische Heimat der griechischen Götter ist. Anknüpfend an dieses Sinnbild fährt der Autor fort mit der Bemerkung der Olymp der deutschen Sprachwissenschaft sei ein „Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“ (Z. 10). Die Substantive dieser Aufzählung gehören dem Wortfeld des Krieges bzw. des Kampfes an, der nach Auffassung des Autors von diesen drei Instituten gegen den Sprachwandel geführt werden sollte. Allerdings weist die Konjunktion „ohne“ (ebd.) in Bezug auf die aufgezählten Substantive darauf hin, dass die Institutionen, von denen man es eigentlich erwarten würde, nicht gegen den Sprachwandel vorgehen. Im Gegenzug dessen erklärt der Autor „Hier wird nur angesessen und Buch geführt“ (Z. 11). Durch die adverbiale Bestimmung des Ortes in Form des Ausdrucks „Hier“ veranschaulicht der Autor die begrenzte Sichtweise der drei Institutionen in Bezug auf den Sprachverlust. Dies wird zusätzlich durch das Adverb „nur“ (Z. 11) untermauert, welches in Bezug zu den geringschätzig bewerteten Tätigkeiten die schwachen Grenzen aufzeigt, die die Institutionen dem Sprachverlust entgegensetzten. Im weiteren Verlauf führt der Autor an „Und jedes Rascheln im Gesträuch klingt den Lauernden wie Musik in den Ohren“ (Z. 11 f.). Hier wird ebenfalls das Wortfeld der Jagd verwendet, welches sich bereits im Subjektiv „Hochsitz“ (Z. 10) in der vorherigen Zeile wiederfinden lässt. Das „Rascheln im Gesträuch“ (Z. 11) steht metaphorisch für den Versuch den Sprachverlust zu verhindern. Der Umstand, dass dieses „den Lauernden“ (Z. 12), Personen wie dem Autor, die versuchen gegen das Problem vorzugehen oder zumindest darauf aufmerksam zu machen, „wie Musik in den Ohren [klingt]" (Z. 12) veranschaulicht die Hoffnung die sich eben genannte Personen über die Bekämpfung des Sprachverfalls machen. Zudem merkt Guratzsch an „Was bei solcher Pirsch herauskommt, das hat der mit großer Spannung erwartete, vor drei Wochen publizierte ‚Bericht zur Lage der deutschen Sprache‘ erwiesen“ (Z. 13 ff.). Jener Bericht, der eigentlich als Buch unter dem Titel „Reichtum und Armut der deutschen Sprache“ im Jahr 2013 herausgegeben wurde, ist das Erste von zwei Schriftstück dieser Art, veröffentlicht von der „Union der Deutschen Akademien der Wissenschaft“. Darin werden unter anderem Themen wie die Entwicklung der deutschen Sprache seit 1900, der Wortschatz, Anglizismen, Flexion und den Nominalstil thematisiert. Insgesamt sollte dieser Bericht die Meinungsbildung der Bevölkerung zur Lage der Sprache gefördert werden und auch eine Grundlage für die Planung weiterer Entwicklungen, beispielsweise im Bildungsbereich, geschaffen werden. In den folgenden Zeilen befasst sich der Autor mit dem Resultat dieses Berichtes. Er fasst die Erkenntnisse aus dem Schriftstück wie folgt zusammen: „Das Dickicht des Gegenwartsdeutschs, so befanden die Autoren, strotzt nur so von Leben“ (Z. 15 f.). Auffällig ist hierbei der Einschub „so befanden die Autoren“ (ebd.) womit sich Guratzsch, der ohnehin nicht an dem Werk beteiligt war, stärker von diesem distanziert und somit seine Position zu dem Sachverhalt des Buches deutlich macht. Erkennbar ist dies auch im Ausdruck „Dickicht des Gegenwartsdeutschs“ (ebd.). Die Metapher stellt die gegenwärtige deutsche Sprache wie ein dichtes, komplex zusammengewachsenes Gesträuch dar, was den Leser eigentlich dazu verleiten würde ein kritisierendes Schriftstück zu erwarten doch durch die Anmerkung „strotzt nur so vor Leben“ (Z. 16) wird der Kontrast zwischen Erwartung und Realität hervorgehoben. Um dies zu untermauern zählt Guratzsch die Hauptaspekte „Der deutsche Wortschatz sei heute reicher als zu Goethes Zeiten, die Grammatik werde immer einfacher, die Anglizismen ließen sich verschmelzen und selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“ (Z. 16 ff.) auf. Durch die Verwendung des Konjunktivs steckt er erneut die Distanz zwischen seiner Position und der Ansicht der Autoren des Berichtes ab. Darüber hinaus stellt man bei der einzelnen Betrachtung der aneinandergereihten Aspekte fest, dass der Autor diese Aspekte sarkastisch darlegt. Zunächst benennt er aus sich der Verfasser des Berichtes der Wortschatz wäre „reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 17), was zum einen eine logische Konsequenz aus der Sprachentwicklung über mehrere Jahrhunderte ist und zum anderen ein Verweis auf die noch heute bedeutungsvollen Werke ist, die mit einem vergleichswiese geringeren Sprachrepertoire verfasst wurden. Es handelt sich somit um keine lobenswerte Erkenntnis, sondern eher um Kritik darüber, dass heute nicht mehr solch literarisch gehaltvolle Werke verfasst werden, was sich aus der Position des Autors auf den Sprachverlust zurückführen lässt. Ähnlich zu verstehen ist auch der Aspekt „die Grammatik werde immer einfacher“ (Z. 17), wobei das Adjektiv „einfach[…]“ (ebd.) in diesem Kontext nicht zwangsweise lobenswert, sondern eher kritisierend verstanden werden kann, da beispielsweise die Literatur als die Höchste Kunst der Sprache angesehen wird und nicht durch primitive Satzstrukturen gekennzeichnet wird. Weiterhin wird auch erwähnt „die Anglizismen ließen sich verschmerzen“ (Z. 18). Ein Anglizismus ist die Übertragung englischer Spracheigenschaften in eine andere Sprache, darunter fallen nicht nur einzelne Begriffe, sondern auch ganze Sprachgefüge, die sich in der anderen Sprache durchsetzen und diese im schlimmsten Fall einnehmen. Einerseits sind Anglizismen eine Bereicherung für die Sprache und eine Erleichterung für das Zusammenleben in der globalisierten Welt, andererseits zerstören sie Bestandteile der heimischen Sprache und tragen somit ebenfalls einen Teil zum Sprachverlust hinzu. Als letztes nennt der Autor die „hässlichen Streckverbgefüge“ (Z. 19), die in der gehobenen Sprache eher weniger verwendet werden, da sie allgemein als stilistisch minderwertig gelten. Die Autoren des Berichtes sehen sie aus Sicht Guratzschs allerdings „manchmal sogar als sinnvoll“ (Z. 19 f.) an, womit Guratzschs Kritik an der Auffassung der Verfasser des Berichtes ein weiteres Mal zur Geltung gebracht wird. Den ersten Abschnitt beendet der Autor mit seiner kurzen Zusammenfassung in Bezug auf die Hauptaussage des Berichtes. Er erwähnt „Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z. 20 f.). Wiederholt ist hier das Wortfeld der Jagd aufzufinden, dass weitestgehend den Kampf gegen den Sprachverfall darstellte. Auch das Subjektiv „Symptome“ (ebd.) in Bezug auf den Sprachverfalls verbildlicht diesen als Krankheit, die es zu bekämpften geht. Insgesamt ist diese Textpassage somit als Ironie zu verstehen, der sich der Autor bedient um auf die Bedeutsamkeit des Erhalt der deutschen Sprache aufmerksam zu machen.
Der zweite Abschnitt des Textes wird durch die Zwischenüberschrift „Sprachwandel bedingt auch Verlust“ (Z. 23) eingeleitet, die zugleich eine These Guratzschs darstellt. Auch im zweiten Abschnitt wird das Wortfeld der Jagd weitergenutzt. Erkennbar ist dies insbesondere in der ersten Aussage des Abschnitts „Als jetzt das Institut für Deutsche Sprache (IDS) auch noch seine Jahrestagung in Mannheim dem Thema widmete, wurde das Halali geblasen“ (Z. 24 ff.). Der Ausdruck „das Halali geblasen“ (ebd.) stammt aus der Jagd. Das Halali ist ein Jagdruf oder ein Hornsignal, welches das Ende der Jagd verkündet. Somit erklärt Guratsch, dass mit der Jahrestagung des IDS das Thema für die Sprachwissenschaftler endgültig geklärt wurde. Passend dazu führt der Autor als nächstes ein Zitat des Sprachwissenschaftlers Otto Behaghel, der sich mit der Thematik des Sprachwandels befasst hat. Behaghel erklärt bereits im Jahr 1900 „‘Es liegt im Wesen der Sprache, dass sie sich verändert, dass ihre Entwicklung in keinem Augenblick still stehe‘“ (Z. 26 f.). In diesem Kontext bemerkt Guratzsch „zu diesem Evangelium bekannten sich seine Kollegen auch in Mannheim“ (Z. 28 f.). Der Umstand, dass er von „seine[n] Kollegen“ (ebd.) veranschaulicht erneut die Distanz, die Guratzsch zu den Sprachwissenschaftlern aufbaut. Anzumerken ist ebenfalls, dass er aus der Perspektive der Sprachwissenschaftler die Ansicht Behaghels mit dem Evangelium gleichsetzt. Das Evangelium ist das höchste Glaubenszeugnis des Christentums, was in Bezug zu Behagehels Zitat verdeutlicht, dass es sich dabei um den Zentralen Aspekt der Sprachwissenschaften halten sollte. Im Bezug dazu erläutert Guratzsch ebenso „Stillstand bedeutet Tod“ (Z. 30), was eine logische Schlussfolgerung aus der These Behaghels ist. Als nächstes erklärt der Autor „Nur wer ganz genau hin hörte, konnte wahrnehmen, dass auch auf diesem Forum von etwas ganz anderem als in der deutschen Öffentlichkeit die Rede war“ (Z. 31 ff.). Mit dieser Aussage macht er den Leser auf den Unterschied deutlich. Während sich die Öffentlichkeit mit dem Sprachverfall befasst, bei dem Teile der Sprache unumkehrbar verloren gehen, thematisiert die Jahrestagung des IDS die Notwendigkeit des Sprachwandels. Um dies zu untermauern führt er die These „Für den Sprachwissenschaftler ist ja das Faszinosum gerade der Wandel“ (Z. 33 f.).
Nina K.
Der vorliegende Artikel „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“, veröffentlicht im Jahr 2013 auf www.welt.de und geschrieben von Dankwart Guratzsch, thematisiert den Wandel der deutschen Sprache in der heutigen Zeit.
Die Thematik des Textes wird bereits in Ansätzen im Titel „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ angedeutet. So wird bereits zu Anfang die These aufgestellt, dass die deutsche Sprache sich ins Negative entwickele, also verfällt. Mit dem „Gefühl“ (Titel) des Sprachverfalls wird angedeutet, dass die meisten Menschen die Entwicklung des Sprachverfalls bereits bemerkt haben, sodass der Titel nicht nur aus einer These besteht, sondern zugleich auch ansprechend wirkt, da seine Leser, von dieser Thematik betroffen sind.
Der Titel steht kontrastiv zu dem ersten Satz des ersten Abschnittes (Z.1-5) „Gibt es einen ‚Verfall‘ der deutschen Sprache?“ (Z.1), der das vorher behauptete nochmals aufgreift und infrage stellt. Zudem wird das Thema differenzierter vorgestellt, da der Sprachverfall nun auf die deutsche Sprache begrenzt wird. Es folgen weitere Fragen, wie beispielsweise „Ist der Dativ dem Genetiv sein Tod?“ (Z.2), welche eine Andeutung zu einem berühmten Buch zur deutschen Grammatik ist, und die die Funktion erfüllt, die im Titel angeführte These näher zu erläutern sowie sie zu stützen. Dazu werden zahlreiche Beispiele für Bestandteile der deutschen Sprache genannt, darunter beispielsweise „der Dativ“ (ebd.), „[der] Genetiv“ (ebd.), „[die] Rechtschreibung“ (Z.4) und „der Konjunktiv“ (Z.1f.). Auffällig dabei ist die Wortwahl, wie beispielweise das Verb „st[erben]“ (Z.1), das Nomen „Tod“ (Z.2), das Adjektiv „schauderhaft“ (Z.3) und das Nomen „Totengräber“ (Z.4) die den Verfall der Sprache überspitzt darstellen sollen. Die Frage „Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen?“ (Z.4f.) verdeutlicht, dass der Autor nach Personen sucht, die den Sprachverfall verhindern. Deutlicher wird dies in der eben angeführten Metapher (vgl. Z.4f.), die den Sprachverfall als ein Verbrechen darstellt, das von den „Warner[n] und Gesetzeshüter[n]“ (ebd.) verhindern werden soll. Das Nomen „Mundwerk“ (ebd.) zeigt gleichzeitig auch, dass der Sprachverfall hauptsächlich durch die direkte Kommunikation, als das Sprechen, ausgelöst wurde.
An die Frage nach dem Schuldigen wird im ersten Satz des darauffolgenden Abschnittes (Z.6-12) angeknüpft. Im Satz „Jedenfalls nicht im Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, nicht in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch nicht in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt“ (Z.6ff.) werden Institute mit Experten für diese Thematik vorgestellt, was verdeutlicht, dass der Autor zeigen möchte, dass Institutionen existieren die eben diesen Sprachverfall verhindern könnten, die dies jedoch nicht tun. Die Metapher „Der dreigeteilte Olymp der deutschen Sprachwissenschaft im Rhein-Neckar-dreieck ist ein Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“ (Z.8ff.) verdeutlicht hierbei nochmals, dass die Sprachwissenschaftler nichts gegen den Verfall der deutschen Sprache tun wollen, was vor allen durch die Metapher der nicht vorhandenen Verteidigungsmittel (vgl. Z.8f.) deutlicher werden soll. Zusätzlich werden der drei Institutionen in Mannheim, Wiesbaden und Darmstadt aus Hessen, hier genannt das „Rhein-Neckar-Dreieck“ (ebd.), durch den Vergleich mit dem „Olymp“ (ebd.), ein Gipfel der griechischen Mythologie und der Sitz der Götter, eine gewisse Macht in der deutschen Sprache zugeschrieben, da beispielsweise eines der Institutionen den Duden herausbringt. Es wird somit hervorgehoben, dass diese drei Unternehmen einen großen Einfluss auf die deutsche Sprache haben, den sie nutzen könnten, um dem Sprachverfall entgegen zu wirken oder sogar aufzuhalten. Dies wird nochmals hervorgehoben durch das Nomen „Hochsitz“ (ebd.), das abermals die Macht verdeutlichen soll. Der Satz „[h]ier wird nur angesessen und Buch geführt“ (Z.11), sowie insbesondere das Adverb „nur“ (ebd.) verdeutlichen, dass diese Institutionen nicht in die deutsche Sprachentwicklung eingreifen, selbst wenn sie zerfalle und dass sie diesen nur beobachten und dokumentieren. Mit dem Satz „Und jedes Rascheln im Gesträuch klingt den Lauernden wie Musik in den Ohren“ (Z.11f.) wird sogar behauptet, dass die Sprachwissenschaftler aus dem „Rhein-Neckar-Dreieck“ (ebd.) sogar Gefallen an der Entwicklung fänden.
Im dritten Abschnitt (Z.13-21) wird der „mit großer Spannung erwartete, vor drei Wochen publizierte ‚Bericht zur Lage der deutschen Sprache‘“ (Z.13ff.) angeführt. Der Satz „Das Dickicht des Gegenwartsdeutsch, so befanden die Autoren, strotzt nur so vor Leben“ (Z.15f.) offenbart eine offizielle Stellungnahme zur aktuellen Sprachentwicklung in der behauptet wird, dass die Sprache nicht verfalle, also unlebendig sei wie zu Anfang des Textes beschrieben durch Worte wie „Tod“ (ebd.) und „sterben“ (ebd.), sondern das das Gegenteil der Fall sei, nämlich das vor Leben nur so strotze. Inwiefern dies so sei, wird in den darauffolgenden Sätzen näher erläutert. So wird widergegeben, dass „der deutsche Wortschatz […] heute reicher [sei] als zu Goethes Zeiten“ (Z.16f.), dass „die Grammatik […] immer einfacher [werde], die Anglizismen […] sich verschmelzen [ließen] und [dass] selbst die hässlichen Streckverbgefüge […] sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen [könnten]“ (Z.18ff.). Das Adjektiv „hässlich“ (ebd.) lässt vermuten, dass der Autor gegen den Sprachverfall der deutschen Sprache ist, da er ein Merkmal der Entwicklung, nämlich die „Streckverbgefüge“ (ebd.) durch das Adjektiv negativ bewertet. Abschließend wird die durchgehende Metapher der Jagd auf den Sprachverfall durch die Feststellung „Mit anderen Worten: Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z.20f.), womit impliziert wird, dass die Intention des langersehnten Berichtes lautet, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Der in den ersten drei Absätzen auffällige hypotaktische Satzbau (vgl. Z.6ff.) unterstreicht die Fülle der Informationen und die Komplexität des Themas. Auch die ebenfalls auffälligen Metaphern zum Sprachverfall als Verbrechen hinterlassen eine ironische Wirkung.
Lara
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“, verfasst von Dankwart Guratzsch und veröffentlicht im Jahre 2013 auf der Internetseite www.welt.de, handelt es sich um einen Sachtext zum Thema Sprachwandel. Thematisiert wird dabei der Umschwung der deutschen Sprache und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Der zu analysierende Text lässt sich allgemein in vier Sinnabschnitte einteilen. Der erste Sinnabschnitt (Z. 1-21) dient als eine Einführung in die von Dankwart Guratzschs behandelte Thematik. Der zweite Sinnabschnitt (Z. 22-45) bezieht sich konkret auf den Sprachwandel beziehungsweise den Sprachverlust der deutschen Sprache. Der darauffolgende Abschnitt (Z. 46-75) beschäftigt sich mit den Veränderungen in der Wortwahl. Der vierte und somit letzte Abschnitt (Z. 76-93) behandelt die Vokabeln der deutschen Sprache, die mit der Zeit immer mehr dahin schwinden.
Bereits die Überschrift „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ leitet in die Hauptthematik des Textes ein und macht deutlich, dass der Sprachverfall der deutschen Sprache Realität sei und somit nicht täusche. Die hiermit erwähnte These des Autors wird in der zu Beginn genannten rhetorischen Frage „Gibt es einen `Verfall` der deutschen Sprache? (Z. 1) noch einmal aufgegriffen. Die hierbei formulierte Leitfrage gibt die Richtung des Themas vor und leitet auf die Beantwortung dieser Frage hin. Dass diese Leitfrage von dem Autor eindeutig befürwortet wird, lässt sich durch die Verneinung „trügt nicht“ (Überschrift) erkennen, wodurch zugleich die Meinung, die der Autor ver tritt, verdeutlicht wird. Um diese Leitfrage zu konkretisieren nennt Guratzsch weitere rhetorische Fragen, die die verschiedenen Konsequenzen, die aus dem Sprachverfall resultieren, erläutern. Dabei stellt sich der Autor die Fragen „Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Macht das schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus? Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber?“ (Z. 1ff.). Mit diesen Fragen behandelt Guratzsch besonders die sprachlichen Veränderungen, die heutzutage vermehrt auftreten, da zum Beispiel die Konjunktivformen heute immer seltener verwendet werden und der Dativ den Genetiv immer häufiger Umgangssprachlich ersetzt. Zudem ist auch der Einfluss der Englischen Sprache eine zentrale Konsequenz, da die Deutsche Sprache heutzutage durch zu viele und größtenteils überflüssigen oder vermeidbaren englischen Ausdrücken ersetzt wird. Auch hier lässt sich eindeutig die Meinung des Autors erkennen, da er das sogenannte „Denglisch“ (ebd.) wertend als „schludig“ (ebd.) bezeichnet. Auch in der nächsten Frage wird durch das Adjektiv „schauderhaft“ (ebd.) die Meinung des Autors hervorgehoben und verdeutlicht, dass die „neue Rechtschreibung“ (ebd.) schlechten Einfluss auf die deutsche Sprache ausübt. Auf die letzte Frage „wo […] die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen“ (Z. 4f.) seien, antwortet er dass diese „jedenfalls nicht im Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, nicht in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch nicht in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt“ (Z. 6ff.) zu finden seien. Durch die dreifache Repetitio des Wortes „nicht“ (ebd.) wird das Gesagte des Autors verstärkt und eindringlicher erläutert, dass Guratzsch der Meinung ist, dass unterschiedliche Sprachinstitutionen den Sprachverfall nicht aufhalten wollen, da sie noch nicht einmal versuchen was gegen diesen Verfall zu unternehmen. Dieser Vorwurf wird im Folgenden durch den metaphorischen Vergleich sie seien „ein Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“ (Z. 10) fortgesetzt, wodurch erneut verdeutlich wird, dass diese Sprachwissenschaftler den Sprachverfall ignorieren und nicht mit den eben genannten mittelalterlichen Mitteln dagegen vorgehen. Diese Metapher betont noch einmal, dass die Wissenschaftler den Sprachverfall nicht aufhalten möchten, sondern stattdessen „nur angesessen und Buch [führen]“ (Z. 11), was der Autor kritisiert, da dies die Abneigung der Wissenschaftler noch einmal hervorhebt.
Janette
Der vorliegende Sachtext „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ von Dankwart Guratzsch wurde 2013 auf der Internetseite der Tageszeitung „Welt“ veröffentlicht und thematisiert den fortlaufenden Wandel der deutschen Sprache.
Gleich zu Beginn wird bereits im Titel die Thematik des Textes kund gegeben, nämlich der „Sprachverfall“. Um einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen, nutzt der Autor folgende rhetorische Frage: „Gibt es einen „Verfall“ der deutschen Sprache?“ (Z. 1). Da direkt zum Beginn schon von „Verfall“ (ebd.) gesprochen wird, ist zu sagen, dass dieses Thema sich durch den gesamten Text zieht. Um weitergehen die auf die Problematik hinzuweisen, werden weitere rhetorische Fragen aufgeworfen (vgl. Z. 1 ff.) und weisen somit Konsequenzen auf, welche aus dem Sprachwandel resultieren. So sind der Nicht-Gebrauch des „Konjunktiv[s]“ (Z. 1), sowie das „Denglisch“ (Z. 2) und die „neue Rechtschreibung“ (Z. 3 f.) schuld dafür, dass die deutsche Sprache verfällt. Außerdem lässt das Adjektiv „schauderhafte“ ( Z. 3) erstmalig die Haltung seitens des Autors über den Verfall erkennen. Zudem wird gefragt, „wo […] die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen“ (Z. 4 f.) seien. Durch den Neologismus „Sprachverderbern“ (ebd.) wird zusätzlich deutlich, dass Guratzsch den Sprachwandel missbilligt und somit nach Verantwortlichen sucht, welche den Verfall verhindern sollen. Somit sind laut Guratzsch diese „nicht im Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, nicht in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch nicht in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt“ (Z. 6) zu finden. Das Repetition von „nicht“ (ebd.) in Form eines Trikolons akzentuiert dabei, dass diese drei Anlaufstellen den Verfall nicht verhindern, sondern gar billigen. Der Autor ist jedoch der Auffassung, dass sie für die Verhinderung des Verfalls zuständig sein, da er sie als „Olymp der deutschen Sprachwissenschaft“ (Z. 9) beschreibt. Dabei ist anzumerken, dass er sie zunächst mit den Göttern vergleicht, da sie nach den Legenden zu Folge im Olymp, also in Athen, wohnten. Hier allerdings haben die Institute ihren Sitz in Hessen, was aus „Darmstadt“ (ebd.), „Mannheim“ (ebd.) und „Wiesbaden“ (ebd.) hervorgeht. Die Gleichsetzung mit den Göttern wird allerdings wieder aufgehoben durch die sinnbildliche Sprache von „ohne Götter, Mauern, Schwertern und Kanonen“ (Z. 10). Die Präposition „ohne“ (ebd.) untermauert dabei, die Scheiterung der Institute den Sprachwandel zu verhindern. Dabei ist außerdem zusagen, dass sie bildlich gesehen keine „Mauer“ (ebd.) zum Schutz des Verfalls hatten, sondern diesen willkommen geheißen haben. Ebenso sind „Schwerter und Kanonen“ (ebd.) auch Wörter aus dem Wortfeld des Krieges, was den Verfall akzentuiert. Da sie diese ebenfalls nicht besitzen kommt der Autor zu der Schlussfolgerung: „Hier wird nur angesessen und Buch geführt“ (Z. 11). Die adverbiale Bestimmung des Ortes von „Hier“ (ebd.) bezieht sich dabei auf die drei Institute, was so viel bedeutet, dass es in anderen Regionen sehr wohl Menschen, gibt, die den Sprachverfall nicht billigen, wie beispielsweise der Autor, und diesen gar verhindern möchten. Somit kommen die Institute nach Guratzsch ihrer Aufgabe nicht nach, was durch das Adverb „nur“ (ebd.) untermauert wird. Weitergehend ist zu sagen, dass die Institute sogar auf der Suche nach neuer Rechtschreibung und weiteren Verfall sind, was aus der Metapher „wie Musik in den Ohren“ (Z. 12) hervorgeht. Dabei ist auch das Wortfeld auffallend, auf welches sich die Metapher bezieht, da „Rascheln im Gebüsch“ (Z. 11 f.) sicherlich sich auf die Jagd bezieht. Somit kann gesagt werden, dass weiterhin keine Verhinderung seitens der Zuständigen erwartet werden kann, sondern dass weitere Wendungen der Sprache für sie einen Erfolg erzielen. Durch das Substantiv „Pirsch“ (Z. 13), welches zudem erneut aus dem Wortfeld der Jagd kommt, wird weitergehend auf die Untätigkeit der drei Sprachinstanzen eingegangen. Somit wird durch ihre Untätigkeit auf weitere Wandungen gehofft. Zudem ist jedoch auch zu sagen, dass Guratzsch sich auf das zuvor Gesagte bezieht, was durch das Pronomen „solcher“ (Z. 13) verdeutlicht wird. Hierbei wird sich nämlich auf den Kampf ohne Waffen bezogen. Was diese Pirsch allerdings hervorgerufen hat, wird in dem „vor drei Wochen publizierte „Bericht zur Lage der deutschen Sprache““ (Z. 14 f.) thematisiert. So sei der jetzige Zustand der deutschen Sprache metaphorisch gesehen ein „Dickicht des Gegenwartsdeutsch“ (Z. 15). Dabei ist erneut auffallend, dass das Wortfeld der Jagd genutzt wird. Außerdem ist zu sagen, dass somit das Deutsche immer vielseitiger wird, und auch immer neue Dinge dazukommen. Weitergehend greift Guratzsch auf den Inhalt des Berichts zurück und gibt somit die Meinungen der Autoren preis, was durch die Verwendung des Konjunktivs zum Ausdruck gebracht wird. So sind die Autoren der Meinung „der deutsche Wortschatz sei heute reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 16 f.). Dem zu Folge wäre der Wortschatz des 18. Jahrhunderts überholt und es gäbe heutzutage mehrere Worte, dem nach Synonyme, für einen Begriff. Außerdem werde „die Grammatik […] immer einfacher, die Anglizismen ließen sich verschmerzen und selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sinnvoll erweisen“ (Z. 17 ff.). All dies wird von den Autoren des Berichts als Argumente angesehen, sich nicht gegen den Verfall der deutschen Sprache zu wehren, sondern eher in die Rolle des Beobachters zu schlüpfen. Allerdings wird hierbei durch das Verb „verschmerzen“ (ebd.) und das Adjektiv „hässlich“ (ebd.) weitergehend die Position des Autors deutlich. Letztendlich kommt Guratzsch zu dem Fazit: „Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z. 20 f.). Daraus geht hervor, dass sie zuvor genannten Argumente erst für den Sprachverfall verantwortlich sind, jedoch dies von den Instituten durchaus als positiv empfunden wird.
Weitergehend wird der Text in einen nächsten Abschnitt unterteilt, der die Überschrift „Sprachwandel bedingt auch Verlust“ trägt. Dabei ist zu sagen, dass der Sprachwandel nicht nur positive Eigenschaften hat, sondern auch zusätzlich ein „Verlust“ (ebd.) einhergeht. Somit ist es für Guratzsch wichtig, diesen zu thematisieren. Dabei schafft er einen Übergang zu diesem Abschnitt, indem er sich auf zu vor Gesagtes bezieht. So „wurde das Halali geblasen“ (Z. 25) und ist somit in Verbindung mit dem Aufgeben weiterer Suche der Symptome für den Sprachverfall zu setzen, da diese bereits bekannt sind, jedoch nicht verhindert werden. Zudem stellt der „große Sprachwissenschaftler Otto Behaghel“ (Z. 28) die These „Es liegt im Wesen der Sprache, dass sie sich verändert, dass ihre Entwicklung in keinem Augenblick stille steht.“ (Z. 26 f.) auf. Das Adjektiv „groß“ (ebd.) gibt darüber Auskunft, dass der Autor Behaghels Aussage für richtig empfindet. Somit dient diese These als Bekräftigung der Aussagen seitens Guratzsch. Außerdem setzt er die Aussage mit einem „Evangelium“ (Z. 29) gleich, so dass gesagt werden kann, dass dies eine als Richtlinie gilt, an welche maßgeblich geglaubt wird. Um näher auf dies einzugehen und zu erläutern nutzt er die Erklärung: „Denn Stillstand bedeutet Tod“ (Z. 29 f.). Somit wird offenbart, dass Sprache sich weiter entwickeln muss, da sie sonst aussterben würde.
Im darauffolgenden wird Bezug zu der Tagessitzung des IDS genommen, welche den Sprachverfall thematisierte. Dabei wird jedoch nicht das thematisiert, wovon „in der deutschen Öffentlichkeit die Rede“ (Z. 32 f.) sei. Somit unterstellt Guratzsch, dass seine Meinung, der Sprachverfall sei etwas schlechtes, auch von der Mehrheit der deutschen Bürger vertreten wird. Dies veranschaulicht, dass er von dieser Meinung durch und durch überzeugt ist, da er diese verallgemeinert. Stattdessen jedoch sei „für den Sprachwissenschaftler […] das Faszinosum gerade der Wandel“ (Z. 33 f.). Somit ist zu sagen, dass er von diesem Wandel regelrecht angezogen sei und dieser ihn fasziniert oder gar fesselt. Aus diesem Grund gibt es für ihn kein „“Richtig“ oder „Falsch“, […] „Gut“ oder „Böse“, […] „Schön“ oder „Unschön““ (Z. 34 f.). Aus dieser Akkumulation der drei Antithesen geht somit auch die Untätigkeit der Institute hervor. Da sie es weder als negativ, noch als positiv empfinden, sind die in der Rolle des Beobachters und dokumentieren den Wandel lediglich. Um einen Kontrast zu der Meinung der Sprachwissenschaftler zu schaffen, wird das Anliegen eines „Normalbürger[s]“ (Z. 35) geschildert, was ebenfalls das des Autors entspricht. So „geht es um Fülle, Farbigkeit und Feinheit im Ausdruck“ (Z. 36). Die dabei genutzte Alliteration verdeutlicht, dass all dies durch den Sprachwandel und den daraus resultierenden Verfall verloren geht und somit ein „Verlust“ (Z. 37) darstellt.
Maike
Der vorliegende Sachtext „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“ wurde von Dankwart Guratzesch geschrieben und 2013 auf „www.welt.de“ veröffentlicht. Er beschäftigt sich mit dem Sprachwandel und den Folgen, die dieser mit sich zieht.
Der gesamte Text lässt sich in drei Sinnabschnitte unterteilen. Im ersten Sinnabschnitt ( Z. 1 – 21) stellt Guratzesch zu Beginn einige rhetorische Fragen. Allgemein die Frage „Gibt es einen „Verfall“ der deutschen Sprache?“ (Z. 1) zeigt das Thema des Sachtextes auf. Im darauffolgenden wird ein Bezug zu Bastian Sicks Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ genommen (vgl. Z. 2). Als der Autor sich dann die Frage stellt wo die „Gesetzeshüter“ (Z. 4f.) seien, welche dem Wandel der Sprache einen Stopp erteilen jedoch sei dies nicht geschehen, weder „im Institut für deutsche Sprache“ (Z. 6), noch „in der Gesellschaft für deutsche Sprache“ (Z. 7) oder „in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung“ (Z. 7f.). Laut Autoren sei „der deutsche Wortschatz […] heute reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 16f.), das heißt eben, dass der Sprachwandel nicht das schlechteste sei. Zudem wird hier die moderne, also die heutige Welt mit den Lebzeiten Goethes verglichen, eingeleitet wird der Vergleich durch die Konjunktion „als“ (Z. 17). Angeblich würde die Grammatik „immer einfacher“ (Z. 17) und aus diesen Gründen sollen man nicht weiter nach Anzeichen für einen Sprachverfall suchen, sondern diese Suche abschließen (vgl. Z. 20f.).
Im zweiten Sinnabschnitt (Z. 23 – 44) benutzt der Autor Zitate von Sprachwissenschaftlern um seine Leser zu überzeugen. Beispielsweise verwendet Guratzesch die Aussage „ Es liegt im Wesen der Sprache, dass sie sich verändert, dass ihre Entwicklung in keinem Augenblick stille steht“ (Z. 26 f.), die ursprünglich von dem Sprachwissenschaftler Otto Behaghel stammt. Der Autor stellt diese Aussage als „Evangelium“ (Z. 29) dar, welchem sich die Kollegen des Sprachwissenschaftlers bekannten, mit der Begründung, dass Stillstand Tod heiße (vgl. Z. 29 f.). Hinzufügend meint der Autor, dass der Sprachwissenschaftler von dem Wandel der Sprache fasziniert sei (vgl. Z. 33), dass aber im Gegensatz dazu, der „Normalbürger“ ( Z. 35) den Wert eher auf „Fülle, Farbigkeit[...] [und] Feinheit im Ausdruck“ (Z. 36) lege, diesem ginge es also mehr um den Inhalt der Sprache und des Vokabulars. Hier wird der Gegensatz der beiden Seiten durch die Konjunktion „aber“ (Z. 36) eingeleitet und unterstreicht eben die gegensätzlichen Meinungen. Ergänzend muss erwähnt werden, dass das Leiden am Sprachwandel für einen „Normalbürger“ (Z. 35), „ein Leiden am Verlust“ (Z. 37) ist. Im nächsten Satz stellt der Autor erneut eine rhetorische Frage, die da wäre „Werden Jugendliche in fünfzig Jahren überhaupt noch Goethe […] im Original lesen können?“ (Z. 38f.). Ergänzend fügt er dann noch „Oder sind ihnen bis dahin viele Vokabeln des Deutschen abhanden gekommen?“ (Z. 39 f.) hinzu. Diese beiden Fragen unterstreichen die Möglichen Folgen des Sprachwandels, nämlich der Verlust der alten, hochdeutschen Sprache. Diese beiden Fragen seien in Mannheim im Institut für deutsche Sprache nicht gestellt worden (vgl. Z. 40f.), obwohl eben diese, die „Kernfrage des Deutschunterrichts an den Schulen“ (Z. 41 f.) sei. Da die Sprachwissenschaftler dies und außerdem noch die Tatsache, dass die Lehrer der heutigen Schulen und sie selbst „von denselben Linguisten ausgebildet“ (Z. 42 f.) wurden, nicht direkt klar war, scheint mir diese Aussage als eine Art Vorwurf gegenüber der Sprachwissenschaftler (vgl. Z. 43). Jedoch schafft der Autor einen Gegensatz dazu, indem er sagt, dass ihnen eben dies nicht klar war, habe „sehr gut nachvollziehbare Gründe“ (Z. 44).
Es folgt ein Abschnitt der für die Analyse allerdings außer Acht gelassen wird (Z. 46 – 75).
Der letzte Sinnabschnitt (Z. 76 – 93) ist hauptsächlich den Folgen des Sprachwandels bzw. des Sprachverlustes gewidmet, er dient als eine Art Schluss. Laut des Autors Guratzesch ist das Ergebnis vor Allem für die „Sprachrevolutionäre von 1968 fatal“ (Z. 79f.), da diese für die Anpassung der Sprache gekämpft haben (vgl. Z. 80). Folge des Sprachwandels, sei „der Verlust an Vokabular der deutschen Hochsprache“ (Z. 85), welcher gleichzeitig auch ein „Sprach- (und Kultur-)verfall“ (Z. 87) sei. Zuletzt führt Dankwart Guratzesch eine Art Fazit an, welches besagt, dass die Kultur der Sprache als Ausweis der kulturellen Identität dient (vgl. Z. 92 f.).
Abschließend ist zu sagen, dass der Autor in dem Sachtext seine Meinung klar vertritt und mit Hilfe von Zitaten verschiedener Sprachwissenschaftler zu belegen versucht, um die Leser von seinem Standpunkt zu überzeugen.