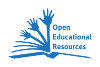Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Benutzer:NKirfel
Inhaltsverzeichnis |
Faust
Faustmonolog
Johann Wolfgang Goethes Tragödie „Faust“, über mehrere Epochen hinweg geschrieben und erschienen im Jahr 1808, thematisiert den Durst eines Menschen nach Wissen über das Übersinnliche und den Sinn des Lebens.
Der Teufel Mephistopheles und Gott schließen eine Wette ab, bei der Mephistopheles Heinrich Faust zum Bösen bekehren muss. Dieser sagt am Anfang der vorliegenden Szene, genannt den Faustmonolog, dass er Medizin, Juristerei, Philosophie und Theologie studiert hat, akademische Titel besitzt und Professor ist. Zudem stellt er fest, dass er trotz seines angereicherten Wissens unzufrieden ist, weil er mehr wissen will, nämlich was die Welt im Innersten zusammenhält. Diese Frustration ist das Fundament der darauffolgenden Handlung. Mephistopheles erscheint und ist bereit ihm zu helfen. Daraufhin verliebt sich Faust in das junge Mädchen Magarete, genannt Gretchen und erobert sie mit Hilfe von Mephisto für sich. Für eine Nacht zu zweit gibt Gretchen ihrer Mutter einen Schlaftrank, der jedoch tödlich für sie endet. Nach einem Duell tötet Faust Gretchens Bruder und flieht zusammen mit Mephisto, der Faust Gretchens Schwangerschaft verheimlicht. Faust hat eine Eingebung, dass Gretchen in Gefahr ist und kehrt zurück um sie zu retten. Gretchen sitzt wegen Mordes an ihrem eigenen Kind im Kerker und will aus Schuldgefühlen nicht mit ihm fliehen. Schlussendlich geht Gretchen mit Gott und Faust bleibt, sodass Gott die anfängliche Wette gewonnen hat.
Es ist Nacht und Faust befindet sich am Anfang des Faustmonologs in einem Zimmer. Die Szene wird mit der Interjektion „ach!“ (V. 354) eingeleitet, die im Zusammenhang mit den darauffolgenden Versen als Ausdruck der Unzufriedenheit interpretiert werden kann. Zudem steht sie im Gegensatz mit den Versen „Habe nun ach! Philosophie, / Juristerei und Medizin, /Und leider auch Theologie [studiert]!“ (V. 354f.) die verraten, dass er mehr als nur viel studiert hat. Denn im 16. Jahrhundert, während der Entstehungszeit von „Faust“ war es üblich, dass Fakultäten vier Studiengänge angeboten haben: Philosophie, Juristerei, Medizin und Theologie. Menschen wir Faust, die alles gelernt haben waren die höchst möglichen Gebildeten. Der Vers „Und leider auch Theologie!“ (ebd) verrät, dass er bei der Wissenschaft Theologie gehofft hat, dass er mehr über das Übersinnliche, über das, „[…] was die Welt/Im Innersten zusammenhält“ (V.382f.) erfährt. Dass sein Wunsch seinem Ziel durch die Wissenschaft des Glaubens und der Religion ein paar Antworten auf seine Fragen zu kriegen, nicht in Erfüllung geht, macht das Adverb „leider“(ebd) deutlich. Die Größe seiner Begierde wird im Vers „Durchaus studiert mit heißem Bemühn“ (V.357) deutlich, da die Synästhesie „heißes Bemühn“ (ebd) zeigt, dass Faust sich nicht nur geistlich, sondern auch körperlich, also mit allem was er hat, mit dem neuen Wissen beschäftigt hat. Das verdeutlicht, das sich Fausts Leben nur um die Begierde nach neuem Wissen dreht. Im Kontrast zu diesem Aspekt, steht der nächste Vers „Da steh ich nun, ich armer Tor!“ (V.358), da er trotz seines bereits erlangtem Wissen unzufrieden ist und sich als „Tor“ (ebd) bezeichnet. Dieser Gegensatz hebt seine Frustration hervor und deutet an, was ihm sein bisheriges Wissen bedeutet. Die Anapher „Heiße Magister, heiße Doktor gar“ (V.360) wirkt als Verstärkung seines bereits erlangten Wissens und seiner Intelligenz und „Und ziehe schon an die zehen Jahr, /Herauf, herab und quer und krumm, / Meine Schüler an der Nase herum“ (V.361f.) zeigt, dass er sein Wissen weitergeben möchte.
Der darauffolgende Vers „Und sehe, dass wir nichts wissen können!“ (V.364) ist eine Feststellung die den Wendepunkt seines Monologs darstellt. Das Pronomen „wir“ (ebd) steht hierbei für die ganze Menschheit und das Verb „können“ (ebd) für die nicht vorhandene Fähigkeit alles im Universum zu wissen. Die Gewissheit, dass der Mensch nicht alles wissen kann, entsetzt Faust, was man am Ausrufezeichen am Ende des Verses erkennen kann. Außerdem bezeichnet er das Wissen, beispielsweise aus dem Bereich der Medizin als „nichts“ (ebd), sodass in seinen Augen das wahrhaft Wichtige das, „[…] was die Welt/Im Innersten zusammenhält“ (V.382f.). Dass ihm das unbekannt ist und immer bleiben wird, „Das will [ihm] schier das Herz verbrennen“ (V.365). Faust sieht in sich selbst einen sehr schlauen, wenn nicht sogar den schlausten Menschen der Erde. Das verdeutlichen die folgenden Verse: „Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, /Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen“ (V.366f), wobei er die Mehrheit der Menschen als Narren bezeichnet, weil er nichts von ihnen hält. Zudem stellt er sich nicht nur über die Leute aus der Wissenschaft, sondern auch über die aus der Religion, zum Beispiel Pastore. Doch „Dafür ist [ihm] auch alle Freud entrissen“ (V.370) bedeutet, dass er sich daran nicht erfreuen kann, da er erst glücklich ist, wenn er alles weiß. Außerdem wird eine Andeutung für den weiteren Verlauf der Tragödie gemacht, im Vers „Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel-“ (V.369), untermauert mit dem Gedankenstrich, der ein Hinweis darauf ist, dass „der Teufel“ (ebd) Mephistopheles vom Anfang des Dramas noch eine Rolle spielen wird. Diese Andeutung baut eine gewisse Spannung auf und verrät, dass die Textstelle noch wichtig für die weitere Handlung sein wird. Im Folgenden sagt Faust „Bilde mir nicht ein was Rechtes zu wissen, / Bilde mir nicht ein ich könnte was lehren“ (V.371f.). Er hat somit festgestellt, dass es keinen Weg mehr gibt sein Ziel zu erreichen und dass er sich nichts mehr vormachen kann. Dies wird verstärkt in Form einer Anapher, wobei er „Bilde mir nicht ein […]“ (ebd) wiederholt, als würde er versuchen sich selbst einreden aufzugeben. Zudem stellt er auch fest, dass er dieses Wissen niemals weitergeben wird, um „Die Menschen zu bessern und zu bekehren“ (V.373). Dass der Mensch nicht die Fähigkeit hat, alles Erdenkliche im Universum zu wissen sieht Faust als fehlerhafte Eigenschaft an, die behoben oder verbessert werden muss. Davon hatte er sich neben seiner Befriedigung „[…] Gut und Geld“ (V.374) und „[…] Ehr und Herrlichkeit der Welt“ (V. 375) versprochen, wobei ihm alles Wissen des Universums weitaus wichtiger ist. Da er aber noch nicht einmal Gut, Geld, Ehre und Herrlichkeit der Welt hat (vgl. ebd) erfasst er einen Entschluss: „Es möchte kein Hund so länger leben!“ (V.376). Die durch das Ausrufezeichen verdeutlichte Entschlossenheit zeigt, dass er so nicht mehr leben will. Hinter seinem Vergleich mit einem Hund, steckt unter anderem seine Empörung über die nicht vorhandene Anerkennung, aber vor allem auch die niedrige Position eines Tieres, mit dem er sich identifizieren kann und dessen kaum vorhandene Chance Wissen erlangen zu können. Im letzten Teil des Textauszugs sagt Faust, dass er sich der Magie ergeben hat (vgl. V.377), was er als eine Art Notlösung ansieht. Wenn man sich ansieht, was er in der Vergangenheit studiert hat, zum Beispiel „[…] Juristerei […]“ (V.355) erkennt man, dass er ein Anhänger und Vertreter der Wissenschaft ist und dass er so verzweifelt ist, dass er sie aufgibt und alle seine Hoffnung auf die Notlösung Magie setzt. Unterstützt wird dies durch den weiteren Ausdruck der Verzweiflung „[…] sau[rer] Schweiß“ aus den Versen „Dass ich nicht mehr, mit sauerm Schweiß, / Zu sagen brauch was ich nicht weiß“ (V.380f.). Zudem wird hier wieder deutlich, dass er der Meinung ist, dass er nichts weiß und dass das Alles viel wichtiger ist. „Dass ich erkenne was die Welt/ Im Innersten zusammenhält“ (V.382f.) ist eine klare Formulierung seines Ziels, die als Andeutung für den Sinn des Lebens interpretiert werden kann. Genauer erläutert er das jedoch in „Schau alle Wirkenskraft und Samen“ (V.384). Damit meint er was die Welt und alle ihre Lebewesen antreibt das zu tun, was sie tun. Zusammen mit dem letzten sind beide Verse wie eine Aufforderung, erkennbar an dem Verb „schauen“ (vgl. V.384), die sich Faust vorstellt. Er träumt davon, wie er sein Ziel erreicht hat, nämlich an sein Wissen zu erlangen und davon dass seine lebenslange Suche und das damit verbundene Leid ein Ende hat. Die allgemeine Frustration und Verzweiflung die sich durch den ganzen Textausschnitt zieht, spiegelt sich auch in einigen anderen Aspekten wider. Der in altdeutsch verfasste Textauszug wechselt ohne Regelmäßigkeit zwischen verschiedenen Versformen, Rhythmen und Metren in Kombination mit einigen Knittelversen, was für den verwirrten Faust steht.
Schlussendlich ist zu sagen, dass Fausts Begierde nach allem Wissen des Universums sehr groß ist. Außerdem wird das, durch sein Entsetzen bei der Feststellung der Unmöglichkeit seines Ziels deutlich. Da er das aber nicht akzeptieren kann gibt er die Wissenschaft auf und gibt sich der Magie hin.
Gretchens Stube
Die 1808 veröffentliche Tragödie „Faust“, geschrieben in mehreren Epochen, wie der Klassik, von Johann Wolfgang Goethe, thematisiert den Wunsch alles über den Sinn des Lebens und das Universum wissen zu wollen.
Der Teufel Mephistopheles und Gott schließen eine Wette ab, bei der Mephistopheles wettet er könne den Professor Heinrich Faust zum Bösen bekennen. Dieser ist ein Mensch mit Durst nach Wissen, der kurz darauf Mephistopheles Hilfe annimmt um dem Wissen über das Leben näher zu kommen. Faust begegnet Gretchen in die er sich verliebt. In der vorliegenden Szene „Gretchens Stube“ gibt Gretchen zu, dass sie sich auch in Faust verliebt hat und sich sorgt, weil sie erst vierzehn Jahre alt ist und Faust trotz eines Tranks der ihn jünger machte viel älter ist als sie. Trotzdem möchte sie mit ihm zusammen sein. Dieser Textauszug ist der Schlüssel für die folgende Handlung des Dramas, da Gretchen sich ihrer Liebe zu ihm und ihrer Konsequenzen bewusst wird und sich im Folgenden auf ihn einlässt. Für eine Nacht zu zweit gibt Gretchen ihrer Mutter einen Schlaftrank, der jedoch tödlich für sie endet. Außerdem wird nach einem Duell Gretchens Bruder von Faust getötet, woraufhin Faust und Mephistopheles fliehen müssen. Auf dem Blocksberg hat Faust jedoch die Eingebung, dass Gretchen in Gefahr ist und kehrt zu ihr zurück. Er findet sie in einem Kerker vor, in dem sie auf ihre Todesstrafe wartet, weil sie ihr gemeinsames Kind umgebracht hat. Aus Schuldgefühlen weigert sie sich mit Faust zu fliehen und wird von Gott erlöst, sodass Gott die anfängliche Wette gewonnen hat und Faust gerettet ist. Die Szene „Gretchens Stube“ (V. 3375-V.3413) besteht aus zehn Strophen und einem Refrain mit jeweils vier Versen. Sie beginnt mit dem immer wiederkehrendem Refrain, und dem ersten Vers: „Meine Ruh ist hin“ (V.3374). Das Nomen „Ruh“ (ebd) ist hierbei ein Synonym für die Unschuld des vierzehnjährigen Kindes Gretchen. Der Grund dafür, dass ihre ruhige, unschuldige Kindheit nun vorbei ist, verrät das Symbol „Herz“ (V.3375) aus dem zweiten Vers: „Mein Herz ist schwer;“ (V.3375), der wiederrum eine Metapher ist. Das Herz steht charakteristisch für die Liebe und als Ort für die Gefühle eines Menschen. Gretchens Herz ist „schwer“ (ebd), weil es Liebe in sich trägt und die Liebe normalerweise das größte und somit auch schwerste Gefühl ist, das ein Mensch empfinden kann. Durch die Liebe hat sie also ihre Unschuld, die auch für ihre Kindheit steht, verloren und „[…] finde[t] sie nimmer/ Und nimmermehr“ (V.3376 f.). Diese Epipher verstärkt die Endgültigkeit dieses Gedankens. In dieser Strophe stellt Gretchen fest, dass ihre Kindheit vorbei ist und dass sie erwachsen wird. Ihre negative Einstellung zum Erwachsenwerden wird durch mehrere Anzeichen des Refrains deutlich, zum Beispiel durch das negativ konnotierte Adjektiv „schwer“ (V.3375), womit sie die Liebe als eine Art Last sieht. Zudem trauert sie ihrer „Ruh“ (V.3374), also ihrer Unschuld nach und stellt fest, dass sie sie „nimmermehr“ (V.3377) wiederkriegt, also dass sie es nicht rückgängig machen kann. Daneben haben die Verse einen unterbrochenen Kreuzreim, der für das Ende ihrer regelmäßigen und einfachen Kindheit steht und das verwirrende und schwierige Erwachsensein ankündigt. Dass sie das belastet wird zusätzlich verstärkt, durch drei Wiederholungen des Refrains im gesamten Textauszug. Im Kontrast dazu steht die zweite Strophe (V.3377-V.3381), in der Gretchen durch die Verse „Wo ich ihn nicht hab/ Ist mir das Grab“ (V.3377 f.) andeutet, dass sie die Abwesenheit von Faust mit dem Tod verbindet. Verstärkt wird das durch: „Die ganze Welt/ Ist mir vergällt“ (V.3380 f.). Somit wird klar, dass Faust Gretchens Welt, also alles wofür es sich zu leben lohnt, ist und dass sie ohne ihn nicht leben kann. Auch in dieser Strophe werden negativ konnotierte Wörter wie das Nomen „Grab“ (V.3380) und das Verb „vergällt“ (V.3381) benutzt, um zu verdeutlichen, wie sie gezwungenermaßen ohne ihn fühlen würde. Untermalt wird diese These durch den Paarreim, der für die Unentschlossenheit Gretchens steht, was sie denken soll. Zusätzlich wird das klar durch die Enjambements „Wo ich ihn nicht/Ist mir das Grab“ (ebd) und „Die ganze Welt/Ist mir vergällt“ (ebd), die die innerliche Unsicherheit und Zerrissenheit von ihr verdeutlichen. Deutlich hervorgehoben wird dies in der dritten Strophe (V.3382-V.3385). Gretchen sagt: „Mein armer Kopf/Ist mir verrückt“ (V.3382 f.), dadurch wird untermauert, dass sie verwirrt über die zwei Seiten ist. Außerdem lässt sich durch die vorherige Erwähnung des Herzens (vgl. V.3375) erahnen, dass ihr Kopf und ihr Herz einen inneren Konflikt austragen. Ihr Verstand steht gegenüber ihren Gefühlen, und er spielt „verrückt“ (V.3383), weil ihr Kopf denkt, dass es klüger ist ihn zu vergessen. Argumente dafür sind, dass viele Schwierigkeiten auftreten könnten, wegen des Altersunterschieds, oder wegen ihrer Familie. Außerdem beklagt sie sich, dass ihr „[…] armer Sinn/ Ist [ihr] zerstückt“ (V.3385). Die Nomen „Kopf“ (ebd) und „Sinn“ (ebd) sind Wörter des Oberbegriffes Körper und deuten an, dass sie dieser Konflikt nicht nur psychisch, sondern auch physisch, also mit allem was sie hat beschäftigt. Im Folgenden kommt eine Wiederholung des Refrains, dass Gretchen an die Schattenseiten der Liebe erinnert. Der Wendepunkt kommt ab der fünften Strophe (V.3390-V.3393). Obwohl Gretchen in den anderen Strophen nur über die negativen Punkte und Folgen ihrer Liebe zu Faust geredet hat, fängt sie nun an die positiven Seiten zu sehen. Ihre Sehnsucht zu ihm wird in den Versen „Nach ihm nur schau ich/ Zum Fenster hinaus“ (V. 3390 f.) deutlich. Gretchen liebt nur Faust, was man an dem Adverb „nur“ (V.3390, V.3392) erkennen kann. Das „Fenster“ (ebd) und das „Haus“ aus den Versen „Nach ihm nur geh ich/ Aus dem Haus“ (V.3392 f.) stehen metaphorisch für ihre Kindheit und Unschuld. Für Faust würde Gretchen nicht nur darüber nachdenken ihre Kindheit hinter sich zulassen, sie würde sogar den Schritt wagen und das Haus ihrer Kindheit, die Zeit des Lebens die sorglos und unbeschwert ist, für ihn aufzugeben. Daraus kann man entnehmen, dass Gretchen zwar die dunklen und schwierigen Seiten ihrer Liebe zu Faust kennt, es ihr jedoch für die guten und schönen Seiten und vor allem für ihn wert ist. Verdeutlicht wird dies durch die Anapher „Nach ihm nur schau ich“ (V.3390) und „Nach ihm nur geh ich“ (V.3392) die bestätigt, dass Faust für Gretchen im Zentrum ihres Lebens steht. Zusätzlich lässt sich der Vers mit dem Fenster und dem Haus (vgl. V.3390, V.3392) folgendermaßen interpretieren: Gretchens Liebe zu Faust ermöglicht ihr eine neue Art auf die Welt zu gucken, metaphorisch genannt: „zum Fenster hinausschauen“, und bringt sie dazu in die große weite Welt zu gehen. In Strophe sechs (V.3394-V.3397) schwärmt Gretchen von Fausts „Gang“ (V.3394), „Gestalt“ (V.3395), „Lächeln“ (V.3396) und „Augen“ (V.3397). Sie beschreibt sein äußerliches Erscheinungsbild in den ersten drei Versen als sehr positiv mit Adjektiven wie „edel“ (V.3395), was ihre Zuneigung zu ihm verdeutlicht. Außerdem wird ihre Schwärmerei durch die Anapher „Sein“ (V.3394 f.) am Satzanfang hervorgehoben, sodass Faust im Fokus steht, genau wie in Gretchens Leben. Der letzte Vers „Seiner Augen Gewalt“ (V.3397) bildet einen Kontrast zu den vorherigen Versen, da das negativ konnotierte Nomen „Gewalt“ (ebd) komplett aus dem Rahmen gerissen und unerwartet kommt und nicht zum Rest der Schwärmerei passt. Mit Gewalt ist hierbei nicht die körperliche Gewalt gemeint, sondern die seelische, beziehungsweise mentale. Ausschlaggebend hierbei ist das „Auge[…]“ (ebd), dass oft auch als Spiegel der Seele bezeichnet wird. Das bedeutet also, dass Faust Gretchen zwar nicht physisch, aber psychisch im Griff hat. Die nächste Strophe (V.3398-V.3401) besteht nur aus Ellipsen, beispielsweise wie „Und seiner Rede/ Zauberfluss“ (V.3398 f.). Hierbei wird Gretchens Liebe für Faust sehr hervorgehoben, da sie nicht in Worte fassen kann wie toll sie ihn findet und den Rest des Satz in der Luft hängen lässt. Außerdem findet sie ihn sogar überirdisch toll, was durch das Nomen „Zauberfluss“ (V.3399) deutlich wird. Sie findet ihn so toll dass sie es erstmal nicht in Worte fassen kann und es sich selbst nur mit Magie erklären kann. Zudem ist das eine ironische Andeutung auf den Verlauf des Dramas, da Faust tatsächlich mithilfe eines Zaubertranks um viele Jahre jünger wurde und weil er Hilfe vom Teufel Mephistopheles bekommt, der ebenfalls nicht von der Erde ist. Dieses unbeschreiblich Überirdische benutzt Gretchen jedoch um ihre Liebe zu Faust auszudrücken, durch beispielsweise die Interjektion „Und ach sein Kuss!“ (V.3401).
Nach diesen drei Strophen in denen Gretchen ausschließlich nur über Faust geschwärmt hat, und die positiven Seiten der Liebe erkannt hat, kommt ein letztes Mal die Wiederholung des Refrains, der abermals als Erinnerung an die negative Seite der Liebe zu Faust dient und als Erinnerung an ihre verlorene Unschuld dient, weil diese in der zweitletzten Strophe (V.3406-V.3409) thematisiert wird. „Mein Busen drängt/ Sich nach ihm hin“ (V.3406 f.) zeigt, dass Gretchen sich körperlich zu Faust hingezogen fühlt. Das Nomen „Busen“ (V.3406) untermalt auch, dass Gretchen ihre Unschuld und Kindheit nun endgültig verloren hat und Erwachsen wird. Zudem ist das Nomen ein Ausdruck der Weiblichkeit. Dass sie ihm nahe sein will, verdeutlichen die Verse „Ach dürft ich fassen/ Und halten ihn!“ (V.3408 f.). Ihr Wille danach ihn zu berühren ist sehr groß, sodass sie ziemlich verzweifelt ist, dass sie das nicht darf. Die Interjektion „ach“ (ebd) und das Ausrufezeichen am Ende des Verses sind also insofern ein Ausdruck der Verzweiflung. Die letzte Strophe (V.3410.-V.3413) ist die Fortführung ihrer Verzweiflung und somit auch ihrer Zuneigung zu Faust. Sie wünscht sich, dass ihrer Liebe keine Grenzen gesetzt sind und dass sie jederzeit bei ihm sein kann. Wie groß ihr Wille danach ist, drücken die Verse „An seine Küssen/ Vergehen sollt!“ (V.3412 f.) aus, denn es ist ihr egal was passiert, solange sie ihn bei sich hat. Diese entschlossene Endgültigkeit wird durch das Ausrufezeichen am Ende deutlich, was nur ein weiteres Zeichen für die Liebe zu Faust ist.
Allgemein ist zu sagen, dass Gretchen in der Szene „Gretchens Stube“ einen inneren Konflikt führt. Dieser Konflikt findet zwischen ihrem Herzen und ihrem Verstand statt. Einerseits ist sie sich bewusst, dass mit der Liebe ihre Kindheit, und somit die ruhige Zeit ihres Lebens vorbei ist und trauert dieser Zeit auch hinterher. Zudem weiß sie auch was für eine Macht die Liebe über sie hat. Aber andererseits hat Faust ihr einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht und sie liebt ihn sehr und fühlt sich körperlich zu ihm hingezogen, sodass ihr die negativen Seiten egal sind und Faust es wert ist. Am Ende siegt Gretchens Herz.
Woyzeck
Inhaltsangabe Woyzeck
Die Tragödie „Woyzeck“, geschrieben und veröffentlicht im Jahr 1879 von Georg Büchner, thematisiert die Macht der Gesellschaft und des Geldes.
Das Drama handelt von Friedrich Johann Franz Woyzeck der 30 Jahre alt ist und mit seiner Freundin Marie ein uneheliches Kind hat. Da Woyzeck sehr arm ist muss er unter anderem den Hauptmann rasieren um Geld zu verdienen. Aus demselben Grund macht Woyzeck bei einem Experiment des Doktors mit. Er ernährt sich ausschließlich von Erbsen, was jedoch Folgen wie Fieber und Halluzinationen mit sich bringen. Eines Tages trifft Marie den Tambourmajor und hat später eine Affäre mit ihm. Da Woyzeck neue Ohrringe bei ihr findet und der Hauptmann die Untreue Maries andeutet, hat er eine Vorahnung, folgt ihr und entdeckt Marie vertraut tanzend mit dem Tambourmajor. Er findet keine Ruhe und es kommt zu einem Kampf zwischen dem Tambourmajor und ihm den Woyzeck jedoch verliert. Er kauft sich ein Messer und ersticht Marie bei einem Spaziergang und lässt das Beweisstück verschwinden. Schlussendlich wendet sich sei Kind von ihm ab.
Parallelen zwischen Woyzeck und dem Hessischen Landboten
Die Tragödie „Woyzeck“ aus dem Jahr 1879 und das Flugblatt „Der Hessische Landbote“ von 1834, sind beide geschrieben von Georg Büchner in der Epoche des Vormärzes. Da sie beide denselben Autor haben, weisen beide Werke einige Parallelen auf.
Während dieser Zeit waren soziale Missstände und die daraus resultierenden Gesellschaftsschichten ein großes Thema, das Büchner in „Der Hessische Landbote“ stark kritisiert. Diese Gesellschaftskritik ist der Grundbaustein von „Woyzeck“. Der Protagonist und das Paradebeispiel eines Lebenden in den ärmeren Schichten ist Franz Woyzeck, an dem man die Folgen dieser schweren Lebensumstände erkennen kann. Er arbeitet für den Hauptmann und erledigt Aufgaben wie das Rasieren für ihn (vgl. 5.Szene). Diese Art von Behandlung wird auch im hessischen Landboten sehr stark kritisiert. Darüber hinaus wird Woyzecks Freundin Marie, vom Tambourmajor für seine Zwecke verführt (vgl. 6.Szene). Ein weiteres Beispiel für herablassende Behandlungen von den oberen Schichten ist der Arzt, der Woyzeck dafür bezahlt Teil eins gefährlichen Forschungsexperiments zu sein. Diese Wertlosigkeit der Armen wird daneben in Szene 26 deutlich, in der ein Polizist den Mord an Marie als „schön“ bezeichnet. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Art des Wehrens die im Flugblatt unterstützt wird. Mit dem Satz „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ setzt Georg Büchner eine eindeutige Botschaft für das Herzogtum Hessen des 20. Jahrhunderts. Er fordert Gerechtigkeit die mit Gewalt erreicht wird. Dass Gewalt eine Lösung ist, ist manchmal auch in der Tragödie wieder zu erkennen. Beispielsweise in Szene 15, in der Woyzeck sich mit dem Tambourmajor prügelt. Eine Folge dieser Gewalt ist auch, dass Woyzeck schlussendlich Marie ersticht.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass „Woyzeck“ und „Der Hessische Landbote“ einige elementar wichtige Parallelen haben, vor allem mit Blick auf die gesellschaftlichen Zustände des 20.Jahrhunderts.
Hessischer Landbote
Georg Büchners illegales Pamphlet „Der Hessische Landbote“, überarbeitet von Friedrich Ludwig Weidig und veröffentlicht im Jahr 1834 in der Epoche Vormärz, in der Gleichberechtigung für alle Menschen gefordert wurde, thematisiert die sozialen Ungerechtigkeiten dieser Zeit.
Der vorliegende Textauszug (Z.70-128) beginnt mit dem ersten Sinnabschnitt (Z.70-77) und dem Satz „Seht nun, was man in dem Großherzogtum aus dem Staat gemacht hat;“ (Z.70f.). Das Verb „sehen“ (ebd) in der zweiten Person Plural, dient dazu den Leser direkt anzusprechen und ihm zu zeigen, dass er ein Teil der sozialen Missstände im Großherzogtum Hessen ist. Außerdem ist es gleichzeitig eine Aufforderung zu sehen, was der Staat gemacht hat. Die Anapher „seht“ (Z.71) ist ein Ausdruck der Dringlichkeit und verstärkt den Leser genauer hin zu gucken. „[…] [S]eht, was es heißt: die Ordnung im Staate erhalten!“ (Z.71f.) ist ein weiterer Aufruf, untermalt durch die Interjektion, der den Sinn der vielen Zahlungen an den Staat anzweifeln soll. Im vorherigen Textauszug wird eine Liste der Gulden die die Bürger an die Regierung abgeben müssen aufgezeigt, mit der Erklärung die Regierung brauche das Geld um die Ordnung des Staates zu garantieren. Diese Notwendigkeit der Gulden wird in diesem Satz angezweifelt und durch eine Erklärung im darauffolgendem Satz mit unwiderlegbaren Fakten untermalt: „700 000 Menschen bezahlen dafür 6 Millionen […]“. Dieser Vergleich soll die Absurdität und Ungerechtigkeit der Abgaben verdeutlichen. Daraufhin wird mit „[…] sie werden zu Ackergäulen und Pflugstieren gemacht, damit sie in Ordnung leben“ (Z.73ff.) die Widersprüchlichkeit dieses Systems widergespiegelt, denn die Idee des Staates ist, dass die Bauern und Bürger des Landes bezahlen damit sie im Gegenzug in Ordnung leben können. Da die einfachen Bürger, für das Geld, dass sie abgeben hart arbeiten müssen, fehlt die im Gegenzug versprochene Ordnung in ihrem Leben. Durch den Vergleich mit „Pflugstieren“(ebd) und „Ackergäulen“(ebd) soll die Situation der Bauern verdeutlicht werden, in der sie sich so minderwertig behandelt fühlen, wie Arbeitstiere. Im darauffolgendem Satz heißt es „In Ordnung leben heißt hungern und geschunden werden“ (Z.75ff.), der wie eine neue Definition des Wortes „Ordnung“ (ebd) formuliert ist. Dadurch werden noch einmal zusammenfassend die Prinzipien des Staates in Frage gestellt.
Der zweite Sinnabschnitt (Z.78-90) behandelt die genauen Personen die an den schlechten Lebensständen des Volkes beteiligt sind. Der Abschnitt beginnt mit den vorher belegten Widersprüchen und der daraus resultierenden Schuldfrage „Wer sind denn die, welche diese Ordnung gemacht haben und die wachen, diese Ordnung zu erhalten?“ (Z.78ff.). Die Antwort lautet: „Das ist die Großherzogliche Regierung“ (Z.80f.). Mit dieser ziemlich direkten Antwort nennt Georg Büchner den Namen des Schuldigen und zeigt praktisch mit dem Finger auf sie. Dadurch lenkt er die Aufmerksamkeit auf die Regierung und stachelt das Volk, beziehungsweise die Leute die diese Schmähschrift gelesen haben gegen die Regierung an. Er geht noch weiter und zählt die Menschen auf, die hinter dem Großherzogtum stecken: „Die Regierung wird gebildet von dem Großherzog und seinen obersten Beamten. Die anderen Beamten sind Männer, die von der Regierung berufen werden, um jene Ordnung in Kraft zu erhalten“ (Z.81ff.). Hierbei wird der Aspekt mit der Ordnung aufgegriffen, um abermals an die Ungerechtigkeit zu erinnern. Mit dem Satz „Ihre Anzahl ist Legion: […]“ (Z.85) soll die Vielzahl dieser Menschen verdeutlicht werden, die bei der Regierung arbeiten. Der Vergleich mit dem römischen Heer, soll abermals die Größe und vor allem die Macht aufgreifen, das das römische Reich in der Vergangenheit eine Supermacht war. Im Folgenden wird dies durch eine lange Aufzählung verschiedener Räte, wie zum Beispiel „Staatsräte“ (Z.86), „Kreisräte“ (Z.87) oder „Forsträte“ (Z.8) untermalt. Dieses Gegenargument, dass die Vielzahl und Größe der Regierung, sowie die Macht betont, wird zusammenfassend mit dem Satzteil „[…] mit allem ihrem Heer von Sekretären usw.“ (Z.89f.) entkräftet, denn Georg Büchner vergleicht deren Arbeit mit der ihren und stellt fest „Das Volk ist ihre Herde […]“(Z.89f.). Da dieses Pamphlet das Volk zu einem Aufstand gegen das Großherzogtum Hessen überzeugen soll, entkräftet er das Gegenargument der Macht mit der Erklärung, dass die Regierung auf das Volk angewiesen sei.
Im dritten Sinnabschnitt (Z.90-99) wird abermals gezeigt, wie ungerecht das Volk vom Staat behandelt wird, beispielsweise durch die Aufzählung „[…] sie sind seine Hirten, Melker und Schinder […]“ (Z.90f.), wobei ausschließlich Wörter aus dem Leben eines Bauern benutzt werden um die reale Situation der Bauern und Bürger darzustellen. Weitere Aufzählungen wie „[…] sie haben die Häute der Bauern an […]“ (Z.91) und „[…] sie herrschen frei und ermahnen das Volk zur Knechtschaft“ (Z.94f.) verdeutlichen wieder die Ungerechtigkeit und den Kontrast zwischen Reichtum und Armut, der minimiert werden soll. Zudem wird der Leser wieder direkt angesprochen mit dem Personalpronomen „ihr“ (Z.96) um zu zeigen, wie widersprüchlich und ungerecht dieses System ist. „Ihnen gebt ihr 6 000 000 Fl. Abgaben; sie haben dafür die Mühe, euch zu regieren; d.h. sich von euch füttern zu lassen und euch eure Menschen- und Bürgerrechte zu rauben“ (Z.96ff.) ist eine Ironie, erkennbar am Ausdruck „sich Mühe zu geben“. Das, und die Erwähnung der Menschenrechte die verletzt werden sollen ein letztes Mal die Ungerechtigkeiten auf politischer und sozialer Ebene gegenüber dem Volk untermauern.
Im letzten Abschnitt (Z.100-128) wird eine neue Seite von einem zweiten Autor aufgegriffen, nämlich von dem Pastor Friedrich Ludwig Weidig, der den Text Büchners durch die religiösen Aspekte erweitert hat. Diese haben ebenfalls eine sehr hohe Bedeutung in der Zeit um 1834 da der Glaube noch ein großer Teil des Lebens war. Der erste Satz dieses neuen Teils knüpft an den letzten Satz an und lautet: „Das alles duldet ihr, weil euch Schurken sagen: diese Regierung sei von Gott“ (Z.100f.), wobei er die Regierung mit dem wertenden Nomen „Schurken“ (ebd) als Verbrecher bezeichnet und mit etwas Negativem verknüpft, um das Vertrauen zum Staat zu zerstören. Zudem steht es metaphorisch für ihr Verhalten, denn der Staat raubt das Volk aus und gibt ihnen nichts wieder zurück. Danach stellt Friedrich Ludwig Weidig die Behauptung auf, diese Regierung sei nicht von Gott, sondern vom Vater der Lügen (vgl.101ff.). Das Wort „Vater“ (ebd) wird in diesem Kontext benutzt, um nicht den Namen Gottes mit Lügen, also etwas Negativem in Verbindung zu bringen. Zudem wird daran erinnert, dass der Fürst keine rechtmäßige Obrigkeit ist (vgl. Z.104), sondern dass allein Gott der größte ist. Dies dient als ein Appell bzw. Erinnerung an das Volk, dass Gott derjenige ist zu dem man aufschauen soll, und nicht der Fürst. Zusätzlich wird erklärt, weshalb der Fürst verflucht sei, nämlich weil er nicht aus der Wahl des Volkes, sondern aus Verrat und Meineid hervorgegangen sei (vgl.108ff.). Dies erklärt er, um zum einen zu zeigen, dass jeder Unterstützer des Großherzogtums Gott lästert (vgl.Z.115) und sich gegen Gott stellt und zum anderen, dass Gott auf der Seite des Volkes ist und bei ihnen steht. Dies soll den Menschen Mut machen sich zu wehren und sie ein weiteres Mal von einer Revolution zu überzeugen. Dies bestätigt der Teil „[…] d.h. Gott habe die Teufel gesalbt […]“ (Z.117) in dem die Regierung mit dem Teufel verglichen wird, der das Gegenteil zu Gott ist.
In Zeile 119 wird der Bezug zu Deutschland hergestellt, das das „[…] liebe […] Vaterland […]“ (ebd) genannt. Das geliebte Vaterland ist so etwas wie das Zuhause des Volkes, und durch das Nomen „Vater“ (ebd) wird wieder daran erinnert, dass es die von Gott behütete Heimat ist. Durch diese Formulierung wird daran gezeigt, dass die Menschen eine Bindung mit Deutschland haben, nämlich dass das ihre Heimat ist und, dass diese Fürsten es zerrissen haben (vgl. Z.119f.). Zusammen mit der darauffolgenden Erwähnung der „Voreltern“ (Z.121) wird vor Augen geführt, dass die Regierung nicht nur die Menschenrechte untergräbt und das Heimatland zerstört, sondern auch die Heimat der früheren Generationen. Zudem erinnert der Satz „[…] den Kaiser, den unsere freien Voreltern wählten […]“ (Z.120f.) das Volk daran, dass ein Leben in Freiheit in der Vergangenheit schonmal möglich war und dass es nun auch möglich sein kann. Nach der letzten Kritik am Staat, besonders deutlich gemacht durch die Interjektion (vgl. Z.124), folgt ein Gedankenstrich in Zeile 124. Dieser verdeutlicht zusammen mit dem Adverb „doch“ (Z.124) einen Wendepunkt an. Der Schluss beinhaltet die Prophezeiung „Doch das Reich der Finsternis neiget sich zum Ende“ (Z.124f.). Da eine Prophezeiung eine Verkündigung von Gott ist, sollen die Leute ermutigt werden für Gleichberechtigung u kämpfen, weil Gott an ihrer Seite sei. Schlussendlich wird mit „Über ein Kleines, und Deutschland, das jetzt die Fürsten schinden, wird als ein Freistaat mit einer vom Volk gewählten Obrigkeit wieder auferstehn“ (Z.125ff.) ein Versprechen abgegeben für alle Menschen im Großherzogtum Hessen die benachteiligt werden.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass „Der Hessische Landbote“ die Regierung als sehr fehlerhaft, ungerecht, widersprüchlich und unvertretbar ansieht, auf politisch-sozialer Ebene, als auch auf religiöser Ebene. Der Text soll auf die Missstände und Ungerechtigkeiten dieser Zeit aufmerksam machen und Mut zur Revolution geben, damit im Großherzogtum Hessen Gleichberechtigung und Gerechtigkeit herrschen.
Brief Büchners an die Eltern
Georg Büchners Brief, adressiert an seine Eltern und geschrieben am 5. April 1833 in Straßburg, in der Epoche des Vormärzes, thematisiert die Gesetze und Missstände der damaligen Zeit in Deutschland.
Der Brief setzt ein mit dem Satz „Heute erhielt ich Euren Brief mit den Erzählungen aus Frankfurt“ (Z.1), der verrät, dass Georg Büchner trotz seiner Abwesenheit über die Vorgänge in Frankfurt informiert ist. Der Fokus liegt hierbei auf einer politisch gescheiterten Aktion demokratischer Gesinnter in Frankfurt. Allgemein wurde Deutschland während dieser Zeit ohne Gleichberechtigung und Gerechtigkeit regiert, was vor allem in den unteren Schichten der Gesellschaft sichtbar wurde. Dies wurde auch in den folgenden Jahren nach 1833 stark von Büchner kritisiert. Seine Meinung dazu ist sehr direkt: „Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt“ (Z.2f.). Zudem wird mit dem Personalpronomen „unserer“ (Z.3) verdeutlicht, dass Büchner ein Teil der von der Regierung benachteiligten Gesellschaft ist und dass er weiß wovon er spricht, weil er auch mit dazu gehört. So wirkt seine Behauptung, Gewalt sei die Lösung, vertrauenswürdig und überzeugend und vermittelt Verbundenheit. Diese erläuterte Verbundenheit wird wieder im nächsten Satz mit dem Pronomen „wir“ (Z.3) aufgegriffen. Durch „Wir wissen, was wir von unseren Fürsten zu erwarten haben“ (Z.3) wird deutlich, dass die Regierung den ärmeren Schichten etwas schuldig ist, da das Leben in einem Staat wie ein Vertrag ist. Im Gegenzug zu Arbeit und Steuern bekommt das Volk ein gutes Leben, zum Beispiel durch eine Arbeit, oder durch Gesetze. „Alles, was sie bewilligten, wurde ihnen durch die Notwendigkeit abgezwungen“ (Z.4f.) sagt aus, dass die Regierung nur das Nötigste für das Volk mache und das nur nach Nachfrage und weil sie es muss. „Und selbst das Bewilligte wurde uns hingeworfen, wie eine erbettelte Gnade und ein elendes Kinderspielzeug, um dem ewigen Maulaffen Volk seine eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen“ (Z.5ff.) ist eine Metapher. Das was dem Volk gegeben wurde, sei unbrauchbar und wie eine „erbettelte Gnade“ (ebd.), was verdeutlicht, dass es unter Druck gegeben wurde. Außerdem sei es wie ein „Kinderspielzeug“ (ebd.), also etwas unbrauchbares, wobei das Volk mit etwas Kleinem vergleicht wird, nämlich einem Kind, um die Spanne zwischen Reich und Arm, oder Regierung und Volk und deren Macht zu verdeutlichen. Der „ewige […] Maulaffe […] Volk “ (Z.6) eine Metapher für die Beschwerden seitens des Volkes, und die „[…] zu eng geschnürte Wickelschnur […]“ (Z.7) steht für die Grenzen die die Regierung dem Staat setzt, durch die es unmöglich sei ein gutes Leben zu führen. Zudem bedeutet das, dass der Staat das Volk unter Kontrolle habe und dass man als Bürger keinen Freiraum zur Gestaltung sein eigenes Leben hat, da man zum Beispiel viele Steuern zahlen muss und dadurch arm wird. Die Kernaussage dieses Satzes ist, dass die Regierung seine Macht gegenüber dem Volk ausspiele und nur das Nötigste für es tue. Der Satz „Es ist eine blecherne Flinte und ein hölzerner Säbel, womit nur ein Deutscher die Abgeschmacktheit begehen konnte, Soldatchens zu spielen“ (Z.8ff.) ist eine weitere Metapher um besser zu veranschaulichen, dass der Staat sein Volk mit schlechten bis unmöglichen Voraussetzungen für das Leben ausstattet. Das soll vor allem herausheben, dass es nicht reiche, was die Regierung Deutschlands für sein Volk tue, und dass es abgeschmackt sei, also unverschämt oder lächerlich zu erwarten, dass das Nötigste reiche. Im zweiten Abschnitt (Z.11-30) erwähnt Büchner den Aspekt der Gewalt vom Anfang wieder. Er rechtfertigt die Gewalt und beginnt mit der Aussage: „Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor“ (Z.10) und stellt die Frage „Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand?“ (Z.11f.) und mit der er versucht die Gewalt als etwas Alltägliches und somit auch Normales darzustellen um sie zu verharmlosen. „Weil wir im Keller geboren und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, dass wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde“ (Z.12ff.) bringt zum Ausdruck, dass das Volk seit seiner Geburt ganz unten in der Gesellschaftsschicht lebt. Zudem sei es eingesperrt, also nicht frei. Zudem dürfe das Volk seine Meinung nicht sagen, was aus der Metapher „Knebel im Munde“ (Z.15) hervorgeht. Darüber hinaus ist an der Metapher „mit angeschmiedeten Händen und Füßen“ (Z.14) erkennbar, dass die Regierung das Volk zu seinen Gunsten forme und dass sie weder Handlungs- noch Meinungsfreiheit hätten.
Nach der ironischen Frage an die Regierung „Was nennt ihr denn gesetzlichen Zustand?“ (Z.15) folgt „Ein Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zum fronenden Vieh macht […]“ (Z.15ff.). Diese Metapher bringt zum Ausdruck, dass die bisher bestehenden Gesetze den einzigen Zweck verfolgen die Bürger Hessens wie Arbeitstiere zu behandeln, die also der Regierung unter gestellt sind und die für Arbeit missbraucht werden. All dies tue der Staat, um seine „unnatürlichen Bedürfnisse“ (Z.17) zu befriedigen. Damit soll ausgedrückt werden, dass der Staat nicht natürliche Bedürfnisse hat, wie das Bedürfnis nach Essen, sondern welche wie nach Luxus. Dies veranschaulicht, dass es der Regierung sehr gut geht. Für diesen Wohlstand müsse das Volk schuften und ein Leben in Armut leben. Die Gegenüberstellung der „große[n] Masse der Staatsbürger“ (Z.16) und der „unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl“ (Z.17f.) soll zudem vor Augen führen, dass nur eine kleine Minderheit von dieser Armut profitiert und dass die Mehrheit ein schlechtes Leben führt. Dies soll die Ungerechtigkeit der Gesetze, sowie des Staates verdeutlichen. Darauf heißt es, dass dieses Vorgehen des Staates mit „rohe[r] Militärgewalt“ (Z.19) durchgesetzt werde, sodass das Volk keine andere Wahl habe. Die Antithese „dumme Pfiffigkeit“ (Z.19) soll aussagen, dass die Regierung nicht schlau sei. Dies soll verdeutlichen, dass die Regierung egoistisch sei und für ihr eigenes Wohl immer einen Weg finde. Durch „dies Gesetz ist eine ewige, rohe Gewalt“ (Z.20) wird der vorher erwähnte „ewige[…] Gewaltzustand“ (Z.12) erklärt, denn damit soll ausgesagt werden, dass die Gesetze die über das Volk herrschen und gewaltsam umgesetzt werden ein einschränkender Dauerzustand im Leben der Bürger ist und ebenfalls nur mit Gewalt bekämpft werden kann. Abschließend schreibt Büchner, dass er diese Ungerechtigkeit „mit Mund und Hand“ (Z.21) bekämpfen will. Dies bedeutet, dass er sich nicht nur körperlich dagegen aufbäumen will, sondern auch mit Worten in Form von Schriften ans Volk. Dies verdeutlicht seine Entschlossenheit.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Georg Büchner mithilfe von Metaphern und wertenden Aussagen scharfe Kritik an den Gesetzen, die Art wie sie umgesetzt werden und der Ausbeutung der unteren Gesellschaftsschichten ausübt.
Vergleich Woyzeck und Innstetten
Der Protagonist Woyzeck aus dem gleichnamigen Drama und der Ehemann Innstetten von Effi aus dem Roman „Effi Briest“ haben einige Parallelen und Unterschiede.
In beiden Werken spielt die Gesellschaft eine große Rolle, so auch in Innstettens und Woyzecks Leben. Woyzeck ist ein armer Soldat mit wenig Geld, der der unteren Gesellschaftsschicht angehört, wo hingegen Innstetten zum oberen Stand gehört. Als Landrat ist Innstetten höher angesehen und in einer Position, in der er Macht besitzt. Woyzecks Situation ist hingegen das Gegenteil, er muss dem Hauptmann in der 5. Szene rasieren und ihm dienen, was zeigt dass er Macht über Woyzeck hat. Eines verbindet jedoch die beiden, nämlich die Abhängigkeit von der Gesellschaft. Woyzecks Geldnot bringt ihn dazu dem Hauptmann zu dienen und sich auf das Erbsenexperiment mit dem Doktor einzulassen (8. Szene). Darüber hinaus ist er abhängig von dem Geld was er vom Doktor und Hauptmann bekommt um zu überleben. Innstetten wiederrum hat zwar einen Beruf und Erfolg, jedoch kann durch die Verachtung der Gesellschaft ihm alles wieder entzogen werden, weswegen er auch Crampas erschießt. Dies beweist aber auch, dass das gesellschaftliche Ansehen für Innstetten noch wichtiger ist als für Woyzeck, da Woyzeck sowieso schon zur unteren Schicht der Gesellschaft gehört. Das spielt auch im nächsten Aspekt eine Rolle. Beide hatten Liebschaften, die fremdgegangen sind. Innstetten war mit Effi verheiratet und Woyzeck war mit Marie zusammen und hatte mit ihr ein uneheliches Kind. Beide schenkten ihren Frauen zu wenig Aufmerksamkeit, beide weil sie arbeiten mussten. Ihre Motive waren jedoch unterschiedlich, da Woyzeck arbeitete um zu Überleben und um seiner Familie ein gutes Leben bieten zu können, Innstetten jedoch nur für sein gesellschaftliches Ansehen. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass Woyzeck wegen seiner gesellschaftlichen Stellung betrogen wurde, da Marie sich von dem angesehen Tambourmajor verführen ließ. Innstetten jedoch wurde betrogen, weil er sich zu viel um seine gesellschaftliche Stellung gekümmert hat statt sich um Effi zu kümmern. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sich beide mit Mord an der Affäre rächen, Innstetten an Crampas, weil es die Gesellschaft so fordert, Woyzeck hingegen an Marie, weil er verletzt war.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Woyzeck und Innstetten einige Gemeinsamkeiten haben. Innstetten jedoch ist ein Mann der der Erwartungen der Gesellschaft folgt und sie über seine Gefühle stellt und dass Woyzeck überleben will und aus Liebe handelt.
'Novellen =
Haus in der Dorotheenstraße
Der vorliegende Textausschnitt aus Harmut Langes Novelle „Das Haus in der Dorotheenstraße“, veröffentlicht im Jahr 2013, thematisiert das Ende einer gescheiterten Ehe.
Der Textauszug (Z.256-275) behandelt das Ende der Novelle. Der Protagonist Gottfried Klausen lebt zusammen mit seiner Frau Xenia in einem abseitsliegenden Teil von Berlin, in einem Haus in der Dorotheenstraße. Er ist Journalist und wird eines Tages nach London versetzt. Da seine Frau nicht mitkommen möchte, fliegt er allein. Er ruft sie die Zeit über mehrmals an, sie geht jedoch kaum ans Telefon, bis sich eines Tages am anderen Ende der Leitung eine Männerstimme meldet. Klausen besuchte zuvor das Theaterstück „Othello“, sodass er beginnt sich Sorgen um seine Ehe zu machen. Als er versucht zurückzufliegen, um seine Ehe zu retten, wird er von einer Aschewolke eines isländischen Vulkans aufgehalten. Er vernachlässigt seine Arbeit und lässt sich nach Island versetzen. Am Ende der Novelle werden Andeutungen auf eine Gewalttat von Klausen gegenüber seiner Frau gemacht.
Der vorliegende Textauszug beginnt mit mehreren Fragen, wie beispielsweise „Und das Haus in der Dorotheenstraße?“ (Z.256) die nicht nur auf den Titel der Novelle hinweisen, sondern auch auf den Anfang der Novelle. Der Anfang der Novelle besteht nämlich mit Beschreibungen rund um den Wohnort von Gottfried Klausen und seiner Frau Xenia. Bei näherer Betrachtung fiel auf, dass diese detaillierten Beschreibungen der Gegend, des Hauses und der Umgebung, metaphorisch für die Ehe beziehungsweise für das Leben von Gottfried Klausen steht. Dies verdeutlicht, dass die Handlung mit dem Haus beginnt und dass sie mit dem Haus endet was wiederum seine immense Bedeutung zeigt. Das Haus steht außerdem für die Heimat Klausens, was auch im Satz „War dies nicht der Ort, dem sich Klausen über Jahre hinweg und mit wachsender Zuneigung verbunden fühlte?“ (Z.256f.) deutlich wird. Zudem verdeutlicht dies, wie sich Klausen in der Ehe mit Xenia gefühlt hat. Die Interpunktionen deuten jedoch daraufhin, dass Klausen dies nun in Frage stellt und dass er weiß, dass die Ehe, in der er sich immer wohlgefühlt hat und dass das Haus, das für ihn immer eine Heimat war und dass er mit seiner Ehe verbunden hat, nach dem möglichen Betrug seiner Frau nicht mehr dasselbe sein wird. Im nächsten Satz stellt Klausen seine Entscheidung nach Island, und nicht nach Berlin zu fliegen, in Frage, was an der Interpunktion „?“ (Z.260) festzumachen ist. Die Frage „Und hätte er nicht allen Grund gehabt, statt nach Island mit dem nächstbesten Flugzeug nach Berlin zu fliegen, genauer, nach Kohlhasenbrück, in jene Gegend, in der der Linienbus mit der Nummer 118 Mühe hatte, auf holpriger Straße zu wenden?“ (Z.257ff.) erinnert abermals an den Anfang, indem sowohl Kohlhasenbrück als auch der Bus mit der Nummer 118 beschrieben werden. Dies verdeutlicht Klausens Wunsch die Zeit zurück zu drehen und sich anders zu entscheiden. Zudem deutet dies an, dass er seine Ehe gerne erhalten hätte. Im Kontrast dazu steht jedoch die offen stehende Frage, warum er nicht zurückgeflogen ist, sobald er die Möglichkeit dazu hatte, obwohl er „allen Grund gehabt [hätte]“ (Z.257). Untermalt wird dies auch hier durch die Interpunktion „?“ (Z.260) und die Benutzung des Konjunktiv II, erkennbar am Beispiel „hätte“ (Z.257). Die Metapher des Buses der versucht zu wenden, steht für Klausens verpasste Chance seine Ehe zu retten. Die letzte Frage „Und war es überhaupt möglich, dass Gottfried Klausen, so wie sich die Verhältnisse nun einmal entwickelt hatten, dass er dort, als wäre nicht geschehen, wieder hätte auftauchen können, um wenigstens seine persönlichen Sachen zusammenzusuchen?“ (Z.260ff.), zeigt Klausens Gedanken, ob, wenn man die Zeit zurückdrehen konnte, das Scheitern seiner Ehe unvermeidbar gewesen wäre, oder ob sie friedlich und ohne Affären hätten auseinander gehen können. In diesem Abschnitt (Z.256-254) lassen sich Spuren des auktorialen Erzählens finden. Da sich die Fragen, wie bereits herausgestellt, mit Klausens Gedanken rund um seine Ehe beschäftigen, also die Innensicht von Klausen offenbaren, lässt sich feststellen dass es sich bei diesen Textauszug um einen allwissenden, also auktorialen Erzähler handelt, Erkennbar ist dies auch am nächsten Abschnitt (Z.264-275) und dem Satz „Was letztendlich geschah, wir wissen es nicht“ (Z.264). Das Pronomen „wir“ (ebd.) deutet an, dass es den Erzähler und den Leser miteinbezieht und dass der Erzähler Teil des Geschehens ist und dieses kommentiert. Der Satzteil „wir wissen es nicht“ (ebd.) deutet darüber hinaus auf das offene Ende der Novelle hin. Es folgt wieder eine Beschreibung der Umgebung wie am Novellenanfang, die für Klausens Leben beziehungsweise seine Gewohnheit hindeutete. Die Beschreibung „da es seit langem ungewöhnlich warm war“ (Z.265f.) deutet auf die Situation von Klausens Leben am Novellenende hin, die im Kontrast zum Anfang steht. Die Metapher „Mühe [zu haben] durch die Kronen der Bäume hindurch jenes Haus zu erkennen“ (Z.266f.) ist eine Andeutung auf ein bevorstehendes Ende, da etwas, dass zugewachsen ist nicht mehr erkennbar ist oder vollendet ist. Gemeint ist hierbei die Ehe von Xenia und Gottfried. Das Haus, „das wie immer hell erleuchtet war“ (Z.267), hält die Vorstellung, dass alles in Ordnung ist aufrecht. Der Satzteil „Wer sich darin auskannte“ (Z.267), deutet indirekt an, dass es sich hierbei um Klausen handelt, da er derjenige ist der im Haus der Dorotheenstraße mehrere Jahre gewohnt hat. Im nächsten Teil des Satzes werden die Räume des Hauses und ihre Reihenfolge angesprochen, die den vorherigen Teil des Satzes unterstützen und abermals andeuten, dass es hierbei um Klausen handelt. Der Satz „Hin und wieder hörte man ein Frauenlachen, und wer das lachte, der sollte sich nicht allzu sicher fühlen“ (Z.269f.) deutet nicht nur an, dass es sich bei der lachenden Frau im Haus um Xenia handelt, da sie diejenige war die in Berlin zurückblieb, sondern macht auch die erste Vorausdeutung auf eine böse Wendung. Unterstützt wird dies durch den Kontrast zwischen dem „Frauenlachen“ (ebd.), dass etwas Fröhliches akzentuiert, und dem Satzteil „sollte sich nicht allzu sicher fühlen“ (ebd.), das etwas Böses andeutet. Untermalt wird dies ebenfalls durch den darauffolgenden Satz „Denn es war durchaus denkbar, dass irgendwann, nicht am Tage, sondern nachts, doch noch ein Auto vorfuhr und dass sich jemand auf den Eingang zubewegte“ (Z.270ff.), der abermals Andeutungen macht, dass Xenia etwas zustoßen könnte. Das offenhalten dieser Option wird durch den Konjunktiv II unterstützt und kreiert zusammen mit dem Offenhalten des genauen Zeitpunktes eine düstere Atmosphäre die ahnen lässt, dass etwas passieren wird. Diese Offenheit lässt sich auf die Ehe von Xenia und Gottfried anwenden, da sie in ihrer Ehe nie viel miteinandergesprochen haben und da nun am Ende davon noch viele Fragen offenstehen, und Antworten fehlen. Die Tatsache, dass er „einen Schlüssel [besaß], […] hier zu Hause [war]“ (Z.272) ist abermals eine Andeutung darauf, dass es sich um Gottfried Klausen handelt, der „also alles Recht [hatte], das zu tun, was er für nötig befand […]“ (Z.272f.). Dieser Satz deutet auf einen Gedankengang von Klausen hin, der sich etwas einzureden versucht und der etwas vorhat, dass gegen „alles Recht“ (ebd.) verstößt. Mit dem Satz „‘Put out the light!‘, rief er“ (Z.274) lässt sich eine Parallele zu dem Theaterstück ‚Othello‘ ziehen, dass Klausen sich zu einem früheren Zeitpunkt der Novelle angeschaut hat. Es handelt sich hierbei um eine Tragödie, in der der Protagonist Orthello von seiner Geliebten betrogen wird, und die er am Ende deswegen tötet. Dass diese Novelle dasselbe Ende findet, lassen die Sätze „man hörte noch eine Tür klappen, [und] es erloschen im Haus an der Dorotheenstraße die Lampen. Das Haus lag in völliger Dunkelheit“ (Z.274f.) vermuten, da Dunkelheit für das Böse steht. Darüber hinaus lässt sich in diesem Textausschnitt ein hypotaktischer Satzbau feststellen, wie an „Wir wissen nur, dass am Ufer des Teltowkanals, da es seit langem ungewöhnlich warm war, die Kastanien zu blühen begannen und dass man, wenn man auf der Nathanbrücke stand, Mühe hatte, durch die Kronen der Bäume hindurch jenes Haus zu erkennen, das wie immer hell erleuchtet war“ (Z.264ff.) erkennbar, der abermals auf den detailliert beschriebenen Anfang hindeutet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem Textauszug viele offen stehende Frage wiederzufinden sind, die für Klausens Gedanken und seinen Wunsch die Zeit zurückzudrehen, um seine Ehe zu retten stehen. Außerdem fragt er sich ob dies etwas genützt hätte, und ob das Scheitern der Ehe unvermeidbar war. Zusätzlich erinnert das Ende der Novelle an die anfänglichen Beschreibungen der Umgebung und des Hauses an den Anfang der Novelle, die in diesem Fall symbolisch für das Ende der Ehe stehen. Zudem werden sehr viele Andeutungen gemacht, dass Klausen seine ehemalige Frau umbringt, was anhand von Kontrasten und Parallelen zum Theaterstück Othello festzumachen ist. Jedoch wird offen gelassen ob dies wirklich geschieht, was die durchgehende Verwendung des Konjunktiv II akzentuiert. Er verdeutlicht ebenfalls die offengebliebenen Fragen Klausens sowie seinen Schmerz, dass seine Frau ihn betrogen hat und das seine Ehe mit ihr nun zu Ende ist. Außerdem handelt es sich hierbei um einen auktorialen Erzähler und einen hypotaktischen Satzbau.
Entwicklung der Marquise von O....
Die Novelle „Die Marquise von O…“ und ihre Protagonistin, genannt die Marquise von O…. oder Julietta machen eine Entwicklung durch, die in der Handlung verfolgbar ist.
„Die Marquise von O…“ beginnt damit, dass sie als „[…] eine Dame von vortrefflichem Ruf“ (Z.2) vorgestellt wird. Sie ist Witwe und lebt mit ihren Kindern bei ihren Eltern in guten Verhältnissen. Jedoch steht die Annonce die darauf folgt, im Gegensatz dazu. Dort sucht sie nach einem Mann, der der Vater ihres ungeborenen Kindes sein soll und den sie bereit ist zu heiraten. Diese Gegenüberstellung direkt am Anfang zeigt erstmals, dass die Entwicklung einen Wendepunkt hat, da eine guterzogene Frau Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich von ihrem Ehemann schwanger sein sollte, bzw. wissen sollte von wem sie schwanger ist. Doch in einer Zeitungsannonce öffentlich zu fragen wer der Vater ihres Kindes ist war ein Tabu und zeigt darüber hinaus, dass sie sich während der Handlung entwickelt. Die Marquise lebt noch immer zusammen mit ihren Eltern, obwohl sie bereits zwei Kinder hat. Sie ist Witwe und wieder in die Rolle als Tochter zurückgefallen, was daran erkennbar ist, dass sie vor allem am Anfang, immer das getan hat was ihre Mutter von ihr verlangt hat (vgl. Z. 393- 400). Sie ist sogar bereit den Grafen von F… zu heiraten, weil ihre Mutter sich das wünscht (vgl. Z. 400ff.), obwohl Aussagen wie „Doch es war mein Entschluß, mich nicht wieder zu vermählen“ (Z.383 f.) deutlich zeigen, dass sie dies nicht will. Textstellen wie „Der Marquise stürzte der Schmerz aus den Augen“ (Z.614 f.) und „Die Marquise rief: mein liebster Bruder! unter vielem Schluchzen; drängte sich ins Zimmer, und rief: mein teuerster Vater! und streckte die Arme nach ihm aus“ (Z.622 ff.) verdeutlichen, dass sie nur noch ihre Eltern hat und Angst hat die auch zu verlieren und deshalb alles dafür tut, dass sich ihre Eltern nicht von ihr abwenden. Dies zeigt, dass die Marquise sich fügsam und unterwürfig verhält. Doch wenige Zeit später wird sie von ihren Eltern verstoßen und raus geschmissen, die ihr darüber hinaus auch die Kinder wegnehmen wollen. An diesem Punkt legt jedoch die Marquise die Unterwürfigkeit ab und zeigt sich als Mutter, indem zu ihrem Bruder sagt „Sag deinem unmenschlichen Vater, daß er kommen, und mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen könne!“ (Z.639 f.). Das verdeutlicht, dass sie sich nicht alles von ihren Eltern gefallen lässt und sich auch wehren kann. Sie zieht in den Landsitz ein und wird dort, wo sie gezwungenermaßen allein zurecht kommen muss. Jedoch blüht sie während diese Zeit auf und wird selbstständiger und selbstbewusster, was unter anderem an dem Zitat „Lassen sie mich augenblicklich! […] ich befehls Ihnen! Riß sich gewaltsam aus seinen Armen, und entfloh“ (Z.743 ff.) deutlich wird. Darüber hinaus spiegelt sich dieses Selbstbewusstsein in der Zeitungsannonce wider, da sie sich damit öffentlich gegen die gesellschaftlichen Konventionen stellt. So etwas hätte die Marquise vorher nicht gemacht, da sie sich den gesellschaftlichen Anforderungen anpasst, was beispielsweise daran erkennbar ist, dass sie fast den Mann der sie gerettet hat, aus Dankbarkeit geheiratet hätte (vgl. Z.397ff.). Doch diese Entwicklung zur Eigenständigkeit verfliegt wieder, als ihre Mutter sie besuchen kommt um sie um Verzeihung zu bitten. Sie verfällt fast vollständig wieder in alte Muster und lässt sich von ihrer Mutter überreden ihren Vergewaltiger zu heiraten. Zwar zögert sie und stimmt nicht direkt zu wie sie es vorher getan hätte und legt dem Graf F… einen „Heiratskontrakt vor, in welchem dieser auf alle Rechte eines Gemahls Verzicht tat, dagegen sich zu allen Pflichten, die man von ihm fordern würde, verstehen sollte“ (Z. 1124 ff.), weil das die einzige Freiheit ist die ihr bleibt, jedoch stimmt sie schlussendlich zu ihn zu heiraten. Nach einem Jahr nähern sich der Graf F… und die Marquise an und sie hat ihm verziehen, weshalb sie ein zweites Mal heiraten. Jedoch zeigt der Satz „ er würde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht bei seiner ersten Erscheinung, wie ein Engel vorgekommen wäre“ (Z.1164 f.), dass sie sich am Ende nicht gegen die elterlichen und gesellschaftlichen Zwänge durchsetzen konnte, obwohl sie es versucht hat.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Marquise von O… eine von der Gesellschaft und ihren Eltern beeinflusste Frau ist, die sich anfangs immer dem Willen ihrer Eltern beugt, jedoch ab der Verstoßung von der Tochter zur Mutter wird und an Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein gewinnt. Mit der Zeitungsannonce stellt sie sich gegen die gesellschaftlichen Konventionen und beweist somit Mut. Nachdem aber der Mann, der sie geschwängert hat gefunden ist und die Marquise wieder bei ihren Eltern aufgenommen wird, muss sie sich wieder der Gesellschaft anpassen und dem Willen ihrer Eltern beugen indem sie den Mann gegen ihren Willen heiratet.
Sachtexte (1)
Vogt (Personale Erzählsituation)
Der vorliegende Sachtext „Personale Erzählsituation“, aus dem Buch „Aspekte erzählender Prosa“ von Jochen Vogt und 1979 erschienen, thematisiert den personalen Erzähler und seine Merkmale.
Der Sachtext beginnt mit dem ersten Sinnabschnitt (Z.1-14) und dem einleitendem Beispiel aus „Thomas Manns erstem Roman ‘Buddenbrooks. Verfall einer Familie‘, erschienen 1901“ (Z.15f.). Dieser Textauszug dient dem Sachtext als roter Faden und somit als immer wiederkehrendes Beispiel zur Verdeutlichung. Somit beginnt Vogt mit der Feststellung, dass das Beispiel „auf den ersten Blick keine Spuren des Erzähltwerdens [zeigt]“ (Z.16). Diese Untersuchung des Textes bezeichnet er, wie an „auf den ersten Blick“ (Z.16) erkennbar, als oberflächlich und deutet indirekt an, im Folgenden das Beispiel näher zu untersuchen. Mit „Keine vermittelnde Instanz scheint dem Leser vom Geschehen zu berichten […]“ (Z.16f.) legt er die Funktion beziehungsweise die Wirkung des fehlenden Erzähltwerdens dar. Dies ist ebenfalls der Fall in „er verfällt der Illusion, sich selbst auf dem Schauplatz der Handlung zu befinden“ (Z.17f.), wobei hier darüber hinaus auch das erste Merkmal des personalen Erzählers angeführt wird, nämlich Teil des Geschehens zu sein. Der nächste Sinnabschnitt (Z.19-26) beginnt mit der Anführung der „szenischen Darbietung der Dramatik“ (Z.19f.), sodass Vogt neben der Epik zeigt, dass der personale Erzähler auch in anderen Gattungen, wie der Dramatik existiert. Dieser Vergleich wird in „wie Dramenfiguren“ (Z. 23) deutlich. Mit „Auch hier“ (Z.21) zieht Vogt den direkten Vergleich zum anfangs angeführten Beispiel und bezieht sich mit „Auch hier scheint man eine Szene zu betrachten“ (Z.21) auf Thomas Manns Roman. Die informative Feststellung „Raum und Requisiten werden sachlich beschrieben“ (Z.21f.) steht im Zusammenhang mit dem Kommentar „man könnte an Regieanweisungen denken“ (Z.22), der ein veranschaulichender Vergleich ist. Das Nomen „Unmittelbarkeit“ (Z.25) verdeutlicht abermals die breits anfangs angeführte Illusion „[…], sich selbst auf dem Schauplatz der Handlung zu befinden“ (Z.17), da es Nähe zeigt. Dieses Nomen steht im Zusammenhang mit der „direkten Dialogform“ (Z.25), die ein typisch für die Dramatik ist, die wiederum in Beziehung zum personalen Erzähler steht, da sie komplett in „direkter Rede“ (Z.24) verfasst ist, und somit aus der Perspektive einer Figur geschrieben ist. In Zeile 26 folgende ist wieder der gegensätzliche Fall zur, in diesem Fall, direkten Rede darstellt. Dies zeigt der Konjunktiv, erkennbar am Verb „würde“ (Z.26). Dadurch wird abermals ein Vergleich gezogen, durch den Vogt von seinem Inhalt überzeugt. In der Correctio „Der Text enthält- zumindest in den ersten Absätzen- […]“ (z.28) bezieht sich Vogt abermals auf das Beispiel. Es folgt eine Aufzählung von Feststellungen (vgl. Z.29ff.), deren Wirkung er zusammenfassend durch die Nomen „‘Objektivität‘ und ‚Neutralität‘“ (Z.329 benennt. Somit zählt Vogt auch die Gegenseiten des personalen Erzählens auf, da sie, wie er behauptet, manchmal den Eindruck einer sachlichen Wiedergabe machen. Dies untermalt er durch die Gegenüberstellung von „‘Darstellung‘“ (Z.33) und „‘Erzählung‘“ (Z.33). Mit der Darstellung ist hierbei die ausschließlich sachliche Wiedergabe gemeint, wobei Erzählungen ausgeprägt und ausgeschmückt wiedergegeben werden. Im Folgenden wir gesagt, dass diese Art der Wiedergabe „nicht den Anschien eines ‚fiktiven Erzählers‘“ (Z.34f.) erwecke. Hierbei spricht Vogt den Gegensatz zum personalen Erzähler an, nämlich den auktorialen. Diese weitere Anführung eines Gegensatzes dient abermals zur Veranschaulichung und zum Vergleich, um die Unterschiede zu betonen. Vogt zieht also das Fazit, dass das personale Erzählen auch den Eindruck der Neutralität vermitteln könne, wobei dies nicht in der Dramatik vorzufinden sei. Anhand von „Stanzel“ (Z. 35) lässt sich feststellen, dass Vogt sich auf den Literaturwissenschaftler Stanzel und sein Werk „Typische Formen des Romans“ aus dem Jahr 1981 bezieht um seinem Inhalt Seriosität zu verleihen. Auffällig ist hierbei, dass erstmals der Begriff „‘personale Erzählsituation‘“ (Z.35f.) fällt. Vogt hat also erst ein paar Merkmale, wie den Glauben Teil des Geschehens zu sein, genannt und benennt erst zum jetzigen Zeitpunkt des Textes den Begriff. Dies verdeutlicht, dass er sich in seinem Sachtext dem Thema aufbauend nähert, damit der Leser den Text besser versteht. In „gemeint ist die Haltung, die eine der Handlungspersonen einnehmen würde, wollte sie über das Geschehen berichten“ (Z.36f.) erklärt bzw. gibt er wieder, was mit dem Begriff gemeint ist. Im letzten Teil dieses Sinnabschnittes (Z. 28-42) spricht Vogt den Idealfall des personalen Erzählers an, was an „sollte“ (Z.42) deutlich wird. Statt neutralem Wiedergeben solle das „[…] ‚personale […]‘ Erzählen im engeren Sinne die Geschehensdarbietung aus der Perspektive einer der anwesenden Personen […]“ (Z.41f.) sein. Ab Zeile 44 des letzten Sinnabschnittes (Z.44-64), wird kurz auf das anfängliche Beispiel eingegangen. Mit dem Konjunktiv „könnte“ (Z.44) fügt Vogt an, dass eine Textstelle missverstanden bzw. anders gedeutet werden könnte. Er deutet also an, dass das Beispiel nicht komplett personal erzählt wird, indem er feststellt, dass „‘äußere […] und ‚innere[…]‘“ (Z.45) Vorgänge beschrieben werden. Die Innensicht ist jedoch ein Merkmal des auktorialen Erzählers. Neben diesen ersten Hinweisen findet Vogt jedoch mehr Belege dafür, dass das Beispiel nicht rein personal erzählt ist (vgl. Z.49ff.). Seine inhaltliche Schlussfolgerung ist diese, dass „[k]eine der tatsächlich anwesenden Personen hätte berichten können, was die kleine Tony Buddenbrooks während ihres Katechismus-Vortrags dachte“ (Z.52f.). Vogt nimmt also das, was den personalen Erzähler ausmacht (nämlich, dass das Geschehen aus der Perspektive einer Person wiedergegeben wird) und wendet das auf dieses Beispiel an und kommt zu dem Entschluss bzw. zur Feststellung, dass sich in dem Textauszug auch Spuren des auktorialen Erzählers befinden. Der personale Erzähler hätte folglich nicht wissen können, was Ton Buddenbrook dachte. Diese Feststellung wird durch das Adverb „logischerweise“ (Z.54) bekräftigt, in welcher Vogt wieder erklärt, weshalb es sich hierbei um einen auktorialen Erzähler handelt. Mit „Ausformung der Erzählfunktion“ (Z.57) ist hierbei gemeint, dass das hiergenannte Merkmal der Innensicht sehr charakteristisch für den auktorialen Erzähler ist und dass es sich beinahe offensichtlich um auktoriales Erzählen handelt. Zudem wird die „Spur des Erzähltwerdens“ (Z.67f.) erwähnt. Da der auktoriale Erzähler über die „‘Allwissenheit‘“ (Z.58) verfügt, die eine unmenschliche, fast göttliche Fähigkeit ist, ist sich der Leser beim lesen der Erzählung stets bewusst, dass er etwas vermittelt bekommt. Das bezeichnet Vogt hier als „Spur des Erähltwerdens“ (ebd.), aus der, laut Vogt, unweigerlich Allwissenheit zu schließen ist. Daraufhin wird zusammengefasst, dass es sich um „‘episches Präteritum und damit um fiktionales Erzählen‘ handelt“ (Z.59). Er behauptet hierbei, dass das Erzählen in Vergangenheitsform ein weiteres Merkmal des auktorialen Erzählers sei. Am Ende geht Vogt, erkennbar am Adverb „einschränkend“ (Z.60) und am Adverb „freilich“ (Z.60), darauf ein, dass durch Textpassagen, die auktorial erzählt werden, der „rein personale [..] Charakter“ (Z.61) verloren gehe. Mit dem, oft im Sachtext wiederzufindenden, hypotaktischen Satzbau, erkennbar an „Allerdings zeigt sich, dass oft in einem Text verschiedene Erzählsituationen abwechseln oder sich vermischen und dass besonders der personale Typus fast nie in voller Reinheit zu finden ist“ (Z.62ff.), wird der Inhalt und seine Seriosität unterstützt. Zusammenfassend ist zu sagen, das Jochen Vogt in seinem Sachtext über den personalen Erzähler schreibt, indem er in erster Linie ein Beispiel aus Thomas Manns Roman als roter Faden und zur Erläuterung nutzt. Darüber hinaus erklärt er viele Merkmale des personalen Erzählers, indem er sie durch die Gegenüberstellung der Gegensätze oder durch Vergleiche näher erläutert. Zudem stellt er fest, dass das personale Erzählen auch neutral wirken kann, und dass viele Erzählungen Spuren des auktorialen Erzählen aufweisen, also selten dem Idealtyp entsprechen. All dies untermauert er durch Vergleiche, hypotaktischen Satzbau, Correctios und einen kohärenten Textaufbau.
2. Aufgabe
Im Folgenden wird die Erzählsituation im Textauszug (Z.981-996) aus Heinrich von Kleists Novelle „Die Marquise von O…“ unter Anführung von Belegen näher betrachtet.
Die Marquise von O… lebt zusammen mit ihren Eltern im Familienhaus und wird eines Tages überfallen und angegriffen. Sie fällt in Ohnmacht und wird vermeintlich vom Graf F… gerettet. Er fragt sie ob sie ihn heiraten möchte, woraufhin die Marquise vor Überraschung erst keine Antwort darauf hat. Der Graf F… muss auf eine Dienstreise nach Neapel. In der Zwischenzeit jedoch stellt sich heraus, dass die Marquise schwanger ist. Sie hat keine Ahnung, wer der Vater ist und wird von ihren Eltern wegen angeblicher Lügen verstoßen. Die Mutter sorgt sich jedoch nach einiger Zeit um sie und reist zu ihr, um sie mit einer List zu testen. Dabei stellt sie fest, dass ihre Tochter die Wahrheit sagte und schämt sich dafür, dass sie ihr misstraute. Die Marquise zieht zurück ins Elternhaus, wo der Vater sie ebenfalls mit Reue empfängt. Die vorliegende Textstelle handelt davon, wie die Mutter den Obristen und die Marquise zusammen sieht. Sie sitzt auf seinem Schoß und schläft, während er sie küsst. Im späteren Verlauf der Novelle heiratet die Marquise den Grafen F…, der der Vater ihrer Kinder ist und der sie vergewaltigt hat, weil sie wieder bei ihren Eltern ist und die sie dazu überreden.
Im vorliegenden Textauszug lässt sich schon am ersten Satz erkennen, dass es sich um auktoriales Erzählverhalten handelt. Am Verb „dachte“ (Z.981) lässt sich erschließen, dass es sich hierbei um die Innensicht der Obristin handelt, da ein personaler Erzähler nicht wissen kann, was andere denken, denn nur der auktoriale Erzähler verfügt über Allwissenheit. Dies baut jedoch eine Distanz zwischen Leser und Handlung auf. Auf der anderen Seite jedoch erfährt man viel mehr und die Erzählung wird detaillierter.
Der Satz ab Zeile 983 lässt anfangs vermuten, dass es sich um einen personalen Erzähler handelt, da die Handlung sachlich dargestellt wird. Jedoch zeigt das Verb „wusste“ (Z.984), dass die Obristin sich wieder etwas gedacht hat. Dies zeugt abermals von Allwissenheit. Zudem lässt sich anhand von „[…] um ihn sogleich hineinzulegen, sobald er nur [..] erscheinen würde […]“ (Z.984f.) erkennen, was sich die Obristin vornimmt, also was sie in der Zukunft vorhat. Dies kann ein personaler Erzähler nicht wissen. Diese Allwissenheit hat auch etwas Göttliches, da nur etwas Übermenschliches in die Zukunft schauen kann. Dies vermittelt den Eindruck einer vom Himmel herabschauenden, gottähnlichen Kreatur, die Geborgenheit und Sicherheit ausstrahlt.
Die Allwissenheit wird abermlas deutlich in „Sie vernahm, da sie mit sanft an die Tür gelegtem Ohr horchte, ein leises, eben verhallendes Gelispel, das, wie es ihr schien, von der Marquise kam […]“ (Z.987f.), da ein personaler Erzähler nicht wissen könnte, was die Obristin hört. Das Adverb „endlich“ (Z.990) aus „drauf endlich öffnete sie die Tür“ (ebd.) gleicht eine wertenden Beitrag, was wiederum ebenfalls ein Kennzeichen für den auktorialen Erzähler ist, genauso wie „gerade wie ein Verliebter!“ (Z.996).
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Wiedergabe des Geschehens auf den personalen Erzähler hindeuten könnte, es sich bei genauerer Betrachtung jedoch um einen auktorialen Erzähler handelt. Die Allwissenheit und Kommentare verdeutlichen Geborgenheit und Details.
Lämmert (Rede als Mittel der Personengestaltung)
Der Auszug „Die Rede als Mittel der Personengestaltung“, aus Eberhart Lämmerts 1993 erschienenen wissenschaftlichem Sachtext „Die Bauformen des Erzählens“ handelt davon, was für eine Bedeutung die wörtliche Rede für die Charakterdarstellung einer epischen Erzählung hat. Der einleitende Satzteil „Es ist kein Zufall […]“ (Z. 1) des ersten Sinnabschnittes (Z. 4ff.) verdeutlicht, dass es sich bei „Es ist kein Zufall, dass jene Erzählungen, die auf Charakterdarstellung angelegt sind, sich eben durch ihren besonders großen Redeanteil von der ‘fabulierenden‘ Epik absondern“ (Z. 1f.) um eine These handelt. Eberhart Lämmert behauptet hierbei, dass wenn der Charakter einer Figur im Zentrum einer Erzählung stehen soll, viel wörtliche Rede von Nöten ist. Dies hebt sich von der fantasievollerzählenden Epik ab, da sie nicht die Wahrheit einer Figur bzw. eines Charakters einfangen kann, wie es die wörtliche Rede laut Lämmert kann. Der zweite Sinnabschnitt (Z.8 -19) beginnt damit, die vorher erläuterte These genauer zu erklären. Mit „Freilich“ (Z. 4) wird diese These als selbstverständlich und somit richtig dargestellt. Jedoch widerspricht sich der Satz „Freilich sagt die Quantität der Rede nichts aus über die Art und die Subtilität der Personencharakterisierung“ (Z. 4f.) mit dem was er in seiner These behauptet, da er nun sagt, dass die Länge des Redeanteils nicht entscheidend für eine detaillierte Personencharakterisierung sei. Trotzdem führt er mit dem Satz „die Rede kann ebenso zur Dokumentierung allgemein-typischer Seelenhaltungen des Menschen wie zu individueller Personencharakteristik genutzt werden“ (Z.5 f.) ein Beispiel für seine These an, in dem er aufzeigt, dass wörtliche Rede die Möglichkeit bietet, die allgemeinen inneren Haltungen eines Menschen zu erkennen, wie beispielsweise gegenüber der Gesellschaft, da diese ein Teil einer Person sind. Daneben gehört aber auch die Einzigartigkeit dazu, wie beispielsweise bestimmte Eigenschaften die nur ein paar Menschen haben. Durch dieses Beispiel wird klar, dass die wörtliche Rede in einer Erzählung den kompletten Charakter einer Figur einfangen kann. Mit „So lässt er Redereichtum einer Erzählung an sich nur die eine allgemeine Feststellung zu, in der sich in der Tat alle die angeführten Dichtungen verschiedenster Epochen begegnen […]“ (Z. 8f.) wird verdeutlicht, dass die wörtliche Rede auch Merkmale der jeweiligen Epoche, in der die Erzählung spielt oder geschrieben wurde, widerspiegelt. Darüber hinaus haben die Epochen auch Einfluss auf den Charakter der Figuren. Durch den Satz „Die Vorstellung menschlicher Reaktion dominiert bei ihnen gegenüber der Kundgabe bloßer Aktionen und Begebenheiten“ (Z. 9ff.) wird verdeutlicht, dass bloße Beschreibungen von Taten den Charakter einer Figur nicht ausmacht, sondern dass wichtiger ist was sie sagen bzw. wie sie in Bezug auf etwas reagieren. Das wiederholt im darauffolgenden Satz angeführte Adverb „freilich“ (Z.11), dient abermals zur Bestärkung seiner These, die damit als selbstverständlich dargestellt wird. Mit „Freilich darf diese Hervorkehrung menschlicher Rektionen nicht schlechthin als das Mittel verstanden werden, schicksalshafte Bezüge zwischen Mensch und Welt dichterisch auszudrücken“ (Z.11 ff.) wird verdeutlicht, dass mit „menschliche[n] Reaktionen“ (Z.11) nicht gemeint ist, dass die Welt etwas tut und dann beobachtet wird wie der Mensch reagiert. Der Satz „Doch ist jeweils die Art und Weise bezeichnend, in der Mensch und Welt gebannt werden“ (Z.13) vermittelt den Eindruck, dass die Welt und der Mensch zusammen interagieren, und nicht „zwischen[einander]“ (Z.12). Besonders hervorgehoben und betont wird dieser Aspekt durch die Tautologie „Art und Weise“ (ebd.). Mit dem Beispiel an Heinrich von Kleists Novellen (vgl. Z. 14ff.), erklärt Lämmert wie es auf den Leser wirkt, die Hervorkehrungen menschlicher Reaktionen als Mittel schicksalhafter Bezüge zwischen Mensch und Welt dichterisch darzustellen. Er besagt dabei, „[…] dass solche Dichtungen auf eine besondere, metapsychische Weise Tragik oder auch Komik des Menschenschicksals gestalten“ (Z.14 ff.) In solchen Werken „[…] ist der Vollzug des Handelns und Leidens selbst das Entscheidende […]“ (Z.16f.), was verdeutlicht, dass in solchen Erzählungen die Welt und das was geschieht im Vordergrund steht. In „[…] während wir bei redereichen Erzählungen immer wieder in Verlegenheit geraten, wenn wir durch die Wiedergabe des Handlungsablaufs die ‚Welt‘ der Dichtung wiederzugeben versuchen“ (Z.17 ff.) wird eine Erfahrung dargelegt, die Inhalt und Leser verbindet. Zusätzlich wird dies unterstützt durch das Personalpronomen „wir“ (Z. 17), dass den Leser miteinschließt. Dieser Satz verdeutlicht darüber hinaus, dass diese vorher genannte Art der Erzählung nicht die Charaktere fokussiert, sondern die Handlung und die Welt in der die Erzählung spielt. Dieser Aspekt wird am Anfang des dritten Sinnabschnittes (Z. 20- 26) thematisiert. Mit dem Satzteil „Durch das Medium der Person erfährt die erzählte Welt eine spezifische Brechung […]“ (Z.20) wird verdeutlicht, was für eine Wichtigkeit der Charakter in einer Erzählung haben kann. „[…] [U]nd eben diese Brechung der Außenwelt dient dem Erzähler gleichzeitig zur Anreicherung eines typischen oder individuellen Charakterbildes“ (Z.21f.) verdeutlicht ebenfalls, dass das Charakterbild im Zentrum steht und die Außenwelt in den Hintergrund gerät. Betont wird dies durch die Wiederholung des Nomens „Brechung“ (ebd.). Darüber hinaus verdeutlicht dies, dass die Figuren mit jedem Redeanteil der erzählten Welt einen Teil ihrer Meinung dazugeben und sie somit mit gestalten. Mit „Das geschieht freilich nicht durch jedes Gespräch in gleichem Maße“ (Z.22) will Lämmert keine Regel aufstellen, dass an jedem Gespräch der komplette Charakter einer Person ablesbar sei, sondern, dass „[z]ur Nachprüfung des Personengefüges […] vielmehr die Gesamtkonstellation der Gespräche […]“ (Z.23), also das sich entwickelnde End Bild untersucht werden muss. Zudem wird mit „[…] und dann die besondere Haltung eines jeden Sprechers zu jedem anderen […]“ (Z.24) verdeutlicht, dass die wörtliche Rede nicht nur bei der Charakterdarstellung hilft, sondern dass sie darüber hinaus auch die Beziehung zu anderen Figuren darstellt. Der Ausdruck „ […] im Wandel von Phase zu Phase […]“ (Z.25f.) beschreibt und betont noch einmal, dass die Gesamtkonstellation der Gespräche das Wesentliche eines Personengefüges darstellt. Mit den Nomen „Längsschnitt“ (Z.25) und „Querschnitt[…]“ (ebd.) wird der am Anfang stehende Widerspruch nochmals aufgegriffen. Dies verdeutlicht, dass die Charaktergestaltung sowohl durch viel als auch durch wenig Redeanteil deutlich werden kann. Aus „hat sich bei der Interpretation unseres Textes ein solcher Querschnitt ergeben, so sei nun am gleichen Objekt der Längsweg einer derartigen Untersuchung über eine kleine Verlaufsspanne hin abgeschritten und im größeren Zusammenhang wenigstens angedeutet“ (Z.27f.) lässt sich erschließen, dass man durch eine bestimmte Textstelle, also einem „Querschnitt“ (ebd.), Ansätze eines Charakters findet, die man „im größeren Zusammenhang“ (ebd.), also im „Längsschnitt“ (ebd.) deuten kann. Das folgende Beispiel (vgl. Z.31) unterstützt diese Behauptung exemplarisch. Der nächste Abschnitt bezieht sich auf das Beispiel mit der Feststellung, „[…] dass auch der Erzähler selbst zum Kreis der handelnden Personen gehör[e]“ (Z.35 und dass er „seine Stellung bezieh[e]“ (Z.36). Damit fügt er bei, dass neben der wörtlichen Rede auch das „‘erzählende Ich‘“ (Z.36) Einfluss auf die Charakterdarstellung einer epischen Erzählung hat. Der durch die adverbiale Konjunktion „aber“ (Z.36) eingeführte Satzteil „nun von ganzer anderer Seite“ (Z.36f.) verdeutlicht, dass die direkte Rede eines „‘erzählenden Ich[s]‘“ (Z.36) ein anderes bzw. neues Licht auf eine Person wirft. Im Falle des angeführten Beispiels „[…] wird der Ehrbegriff des Enkels auf seine Person eingegrenzt“ (Z.37), was verdeutlicht, dass der Begriff der Ehre in Bezug auf den Enkel und nach diesem Querschnitt, eine neue Rolle in seinem Charakter spielt. „[…] [G]leichweit ist die neue Stellungnahme des Erzählens entfernt von dem leichtfertigen Verwerfen menschlicher Ehre und von ihrer kategorischen Hervorkehrung, hinter der ein verkappter Ehr-Geiz lauert!“ (Z.37 ff.) beschreibt die Wirkung der Stellungnahme des Erzählers. Die Stellungnahme, dass er seinem Enkel trotz seines Verstoßes gegen die Ehre nicht helfen könne, setzt ihn von seiner „absoluten Höhe“ (Z.40) als Erzähler herab und nimmt ihm seine „Selbstsicherheit“ (Z.41). Der darauffolgende Satz (Z.42f.) beschreibt, wie aus diesem beliebigem Querschnitt eine Interpretation bzw. Schlussfolgerung für den Längsschnitt gemacht wird. Dass der Erzähler den Begriff „zuletzt“ (Z.45) gebraucht, verdeutlicht, dass er das letzte Wort, bzw. den Überblick hat, den die anderen Personen nicht haben. Aus diesem Grund wird zu dem Erzähler ein „besonderes Zutrauen“ (Z.50) aufgebaut.
Zur Überzeugung von seiner These setzt Lämmert darüber hinaus wissenschaftliche Sprache ein und verwendet einen hypotaktischen Satzbau, wie beispielsweise „Freilich darf diese hervorkehrung menschlicher Reaktionen nicht schlechthin als das Mittel verstanden werden, schicksalhafte Bezüge zwischen Mensch und Welt dichterisch auszudrücken“ (Z.11f.). Dies verleiht Seriosität und Glaubhaftigkeit für die These. Fachwörter wie „‘fabulierend‘“ (Z. 2) haben ebenso wie die Hypotaxe eine erklärende Wirkung, die abermals zur Überzeugung der These beitragen soll.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Eberhart Lämmert die These aufstellt, dass die wörtliche Rede essentiell für die Darstellung eines Charakters in einer Erzählung sei. Überzeugen versucht er von dieser durch Beispiele, Wiederholungen des Adverbes „freilich“ (ebd.), durch eine Tautologie, die Verwendung des Personalpronomens „wir“ (ebd.), durch den hypotaktischen Satzbau und der wissenschaftlichen Sprache.
Vogt (auktoriale Erzählsituation)
Jochen Vogts Auszug „Auktoriale Erzählsituation“, aus seinem Roman „Aspekte erzählender Prosa“ aus dem Jahr 1979, behandelt die Bedeutung des auktorialen Erzählers sowie seine Merkmale.
Der erste Abschnitt (Z.1-10) setzt mit dem Romananfang des von Thomas Manns geschriebenen Roman „Der Zauberberg“ von 1924 ein. Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass der Textauszug neben „wir“ (Z.1), „die uns in hohem Grade erzählenswert scheint“ (Z.3f.) und „diese Geschichte ist sehr lange her“ (Z.5f.) weitere zahlreiche Merkmale des auktorialen Erzählverhaltens aufweisen. Dieser Abschnitt dient also als einleitendes Beispiel zur Veranschaulichung der Wirkung des auktorialen Erzählers. Im folgenden Abschnitt legt Vogt die Merkmale mithilfe des Beispiels nochmals genauer dar. Das Adverb „schon“ (Z.12) aus der Aussage „[s]chon der erste Satz aus Thomas Manns Roman ‘Der Zauberberg‘ von 1924 zeugt von einer völlig anderen Erzählsituation“ (Z.12f.) drückt aus, wie schnell am oben angeführten Beispiel zu erkennen ist, dass es sich um eine von gewöhnlichen Erzählformen unterscheidende Erzählart handelt, was wiederrum die Besonderheit der auktorialen Erzählers hervorhebt. Er behauptet damit, dass der auktoriale Erzähler eine, sich von anderen abhebende , Erzählsituation schafft, was durch die Steigerung „völlig andere[…]“ (ebd.) betont wird. Der Satzteil „die Spuren des Erzähltwerdens sind in diesem Text so zahlreich und deutlich ausgeprägt, dass man versucht sein könnte, ‘die Anwesenheit eines persönlichen, sich in Einmengungen und Kommentaren zum Erzählten kundgebenden Erzählers‘ zu behaupten […]“ (Z.13ff.) verdeutlicht zum einen, dass der Leser durch Merkmale wie „Kommentare[…]“ (ebd.) den Eindruck bekommt, der auktoriale Erzähler sei eine selbsthandelnde Figur im Geschehen. Zum anderen werden hierin die ersten beiden Merkmale des auktorialen Erzählers benannt, nämlich das Benennen der eigenen Meinung durch „Kommentare“ (ebd.) sowie das sich Einmischen in das Geschehen, erkennbar am Nomen „Einmengungen“ (ebd.). All dies wird unterstützt durch das Zitieren des Buches „Typische Formen des Romans“ aus dem Jahr 1981, dass von dem Literaturwissenschaftler Franz Karl Stanzel verfasst wurde. Das Zitieren eines Experten verleiht dem Sachtext Seriosität und Glaubhaftigkeit. Die Verwendung des „Personalpronomen[s] ‘wir‘“ (Z.17) ist ein weiteres Merkmal, dass den Erzähler „verr[ät]“ (Z.18), da es genauso vermuten lässt, der Erzähler sei mitten im Geschehen drin. Ironischerweise benutzt Vogt im darauffolgendem Satz ebenfalls das Personalpronomen „wir“ (Z.18), für die Verdeutlichung seiner These und als Beweis für das, was er zuvor anführte. Darüber hinaus zitiert er wiederholt einen Literaturwissenschaftler, nämlich „Käte Hamburger“ (Z.18), die behauptet, dass „auch ‘eingestreute Ich-Floskeln wie ich wir, unser Held u. a.‘ nur den ‘Anschein‘ einer fiktiven Erzählerexistenz erwecken sollen, letztlich also Kunstmittel des wahren Erzählers (=Autors) sind“ (Z.18ff.). Den Eindruck zu haben der Erzähler sei dabei, ist also Mittel des künstlerischen Erzählens des Autors. Darüber hinaus deutet dieses Zitat an, dass Vogt die Grenze bzw. den Unterschied zwischen Autor und Erzähler anzweifelt, in dem er sie durch die Interpunktion „=“ (ebd.) als gleichwertig darstellt. Anhand des Satzes „Aus dem Zusammenwirken zahlreicher solcher Kunstmittel entsteht, was Stanzel als die ‘auktoriale Erzählsituation‘ benannt hat“ (Z.21f.) lässt sich erkennen, dass ein Zusammenspiel dieser Merkmale von Nöten ist um von einer „‘auktoriale Erzählsituation‘“ (ebd.) reden zu können. Im darauffolgendem Satz wird ein weiteres Merkmal genannt, nämlich die „‘Allwissenheit‘“ (Z.23), die der Erzähler „beim personalen Erzählen weitgehend ‚unterschlägt‘“ (Z.23). Damit deutet Vogt an, dass der personale Erzähler nicht in der Lage sei, zu wissen was in der Handlung als nächstes geschieht, weil er am Geschehen beteiligte Person ist. Darüber hinaus fügt Vogt bei der Belegung seiner These das Gegenstück zum auktorialen Erzähler auf, nämlich den personalen. Somit hat der Leser einen unmittelbaren Vergleich. Dass der auktoriale Erzähler „souverän“ (Z.24) ist, erklärt Vogt näher mit den Nomina „Rückwendungen und Vorausdeutungen“ (Z.25) und erläutert somit näher den Aspekt der Allwissenheit. Anhand von „[i]m obigen Beispiel“ (Z.26) ist erkennbar, dass Vogt sich bei seinen Erläuterungen auf das vom Anfang bekannte Beispiel des Romananfangs bezieht, um seine Erklärungen unmittelbar zu unterstützen. Es folgt ab Zeile 27 eine Aufzählung dieser, wie beispielsweise die „epische Zeitangabe ‘Die Geschichte Hans Castorps… ist sehr lange her‘“ (Z.29f.), „Bezugnahmen auf den Leser (‘denn der Leser wird… kennenlernen‘)“ (Z.31f.) oder die „allgemeine Erörterung (‘Das wäre kein Nachteil für die Geschichte‘ […])“ (Z.33f.). Diese Aufzählung dient als Zusammenfassung aller aufgezählten Merkmale des auktorialen Erzählers im „Zusammenwirken“ (Z.21) mit Unterstützung durch das Beispiel, um den Leser von seiner These, dass sich das auktoriale Erzählverhalten von anderen Erzählformen abhebt, zu überzeugen. Jedoch ist der Kern des Satzes, die „epische Zeitangabe“ (Z.29). Der Satz „[…] Abschweifungen von der ‚Geschichte‘ können im auktorialen Erzählen bis zu regelrecht essayistischen Partien anschwellen“ (Z.35f.) verdeutlicht, dass diese bereits angeführten Abschweifungen in einigen Fällen wie ein Aufsatz wirken können. Das Ziel des Sachtextes von der auktorialen Erzählsituation zu überzeugen, wird durch die Verwendung eines hypotaktischen Satzbaus, wie beispielsweise „Dem Gang des Geschehens werden Erzählereinmischungen, Anreden an den Leser, reflektierende Abschweifungen beigefügt: der Beispieltext aus dem ‚Zauberberg‘ enthält als Geschehenskern im Grunde nur die epische Zeitangabe ‘Die Geschichte Hans Castorps… ist sehr lange her‘, die dann durch erläuternde Einmischungen (‘die wir erzählen wolle,- nicht um seinetwillen‘ usw.), Bezugnahmen auf den Leser (‘denn der Leser wird… kennenlernen‘) und schließlich durch Abschweifung, d.h. eine vom erzählten Geschehen sich lösende, allgemeingültige Erörterung (‘Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte‘ usw.) sehr stark ausgeweitet wird“ (Z. 27ff.) unterstützt, der wiederum auch informativer und überzeugender wirkt. Im Satz „die Souveränität auktorialen Erzählens beweist sich weiterhin in der Personenbezeichnung, die sich der Innensicht bedient […]“ (Z.38f.) wird die Allwissenheit abermals deutlich, das mit dieser der Erzähler in den Kopf der Figuren schauen kann. Durch diese Fähigkeit werden „Indizien der Fiktionalität“ (Z.40) geliefert, was das darauffolgende Beispiel abermals dem Werk „Zauberberg“ entnommen, zeigen soll. Diese Innensicht betont, dass die Geschichte fiktiv, also erfunden ist und verdeutlicht gleichzeitig, die „Tatsache der Vermittlung, des Erzähltwerdens“ (Z.49). Dies verdeutlicht, dass der Leser bei „innere[n] Vorgänge[n] und indirekte[r] Rede“ (Z.47) sich nicht mit dem Geschehen verbunden fühlt, weil diese Allwissenheit ihn nicht vergessen lässt, dass er etwas erzählt bekommt von einer „Instanz (Erzähler, Erzählfunktion)“ (Z.51). Dies steht gegenüber dem personalen Erzähler, bei dem man die Handlung miterleben kann. Durch dieses Bewusstsein für das etwas-erzählt-bekommen, wird die „epische Distanz zwischen Geschehen und Erzähltwerden […] deutlich wahrnehmbar“ (Z.51f.). Anhand des Beispiels vom Anfang wird jedoch ein neuer Aspekt aufgegriffen. Vogt sagt dabei, dass die Geschichte Hand Castpors „mit wohlwollender Ironie erzählt [sei] – was übrigens auch dem Leser eine ähnliche Haltung zur Erzählung nahelegt“ (Z.53f.). Dies bedeutet, dass der auktoriale Erzähler jedoch im Stande ist, den Leser bei seiner Wahrnehmung der Erzählung zu beeinflussen. Darüber hinaus sagt er, „die auktoriale Erzählhaltung [sei] weiterhin typisch für humoristische, aber auch für stark reflektorische Erzählprosa“ (Z.54ff.). Der letzte Abschnitt beginnt mit dem adversativen Adverb „allerdings“ (Z.57), dass die Überlappungen zwischen dem auktorialen und personalen Erzähler einleitet. Vogt nimmt sich den Gegensatz zum allwissenden Erzähler, um zum Fazit zu kommen, dass „die beiden Erzählsituationen insofern als Idealtypen zu verstehen [sind]“ (Z.58f.). Dies verdeutlicht, dass die Grenze dazwischen nicht immer deutlich erkennbar ist, und dass die Proportionen von den individuellen Merkmalen nicht immer gleich sind.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Vogt seinen Sachtext zum auktorialen Erzähler kohärent und strukturell logisch aufgebaut hat. Er überzeugt den Leser mit dem am Anfang eingeführten Beispiel als roten Faden des Textes, und zur beispielhaften Unterstützung des Geschriebenem. Darüber hinaus verleihen der hypotaktische Satzbau und das Zitieren von Experten dem Text eine Seriosität und überzeugen den Leser von seiner Richtigkeit. Außerdem wird durch Aufzählungen der Merkmale die Vielfältigkeit der auktorialen Erzählsituation untermauert.
Lämmert und Marquise von O.... (2.Aufg.)
Das Zitat „Durch das Medium der Person erfährt die erzählte Welt eine spezifische Brechung, und eben diese Brechung der Außenwelt dient dem Erzähler gleichzeitig zur Anreicherung eines typischen oder individuellen Charakterbildes“ aus dem Kapitel „Die Rede als Mittel der Personengestaltung“ aus dem 1993 erschienen Buch „Bauformen des Erzählens“ von Eberhardt Lämmert, lässt sich auf den Textauszug von Zeile 929 bis Zeile 940 der Heinrich Kleist Novelle „Die Marquise von O…“ aus dem Jahr 1808 anwenden. Der Sachtext handelt von der Bedeutung der wörtlichen Rede für die Charakterdarstellung einer Figur in einer epischen Erzählung. Das Zitat behauptet hierbei, dass die im Zentrum stehende Person die Welt in der Erzählung mitprägt und dass sich ihr Charakter in ihren Worten widerspiegelt. Der Textauszug der Novelle handelt davon, wie die Obristin ihre Tochter, die Marquise von O… um Verzeihung bittet, weil sie sie wegen ihrer Schwangerschaft und ihrer angeblichen Lüge nicht zu wissen wer der Vater sei, verstoßen hatte. Bei der Betrachtung des Textauszugs fällt der hohe Anteil von wörtlicher Rede ins Auge. Vor allem die Obristin, die hier „das Medium der Person“ (Z. 20) ist und die mit Schmeicheleien wie „du Herrliche, Überirdische […]“ (Z.930 f.) versucht ihre Tochter von ihrer Reue zu überzeugen, gibt ihrer Außenwelt eine Brechung (vgl. Z. 20f.). Dies macht sie durch Komplimente an ihre Tochter, aber auch indem sie sich ihrer Tochter unterwirft, wie in „nein, eher nicht von deinen Füßen weich ich, bis du mir sagst, ob du mir die Niedrigkeit meines Verhaltens […] verzeihen kannst“ (Z.929 ff.) erkennbar ist. Zudem verspricht sie ihr, „[d]ie Tage [ihres] Lebens nicht mehr von [ihrer] Seite [zu weichen]“ (Z.941 f.] und behauptet keine „andre Ehre mehr, als [ihre] Schande“ (Z.942 f.) zu wollen. All dies ist ein recht ungewöhnliches Verhalten einer Mutter gegenüber ihrer Tochter, sodass damit ein „individuelle[s] Charakterbild […]“ (Z.22) von der Obristin kreiert wird. Zudem ist es für die damaligen Verhältnisse unüblich gewesen, seine Tochter, die schwanger ist und nicht weiß von wem, noch in der Familie zu akzeptieren bzw. noch im Haus zu tolerieren. Aus diesem Grund wurde die Marquise auch vorher von ihren Eltern verstoßen. Die vorliegende Textstelle beweist jedoch, dass die Obristin sich gegen die gesellschaftlichen Anforderungen und gegen den Druck stellt, in dem sie sich bei ihrer Tochter entschuldigt. Dies zeigt ein Wendepunkt in ihres Charakters an. Durch das unübliche Verhalten der Obristin gegenüber ihrer Tochter, „[…] erfährt die erzählte Welt eine spezifische Brechung“ (Z.20), die sich von dem was wir kennen unterscheidet. Die Frage „ich will wissen, ob du mich noch lieben, und so aufrichtig verehren kannst, als sonst?“ (Z.932 f.) lässt daraufhin deuten, dass sich die Obristin wünscht, dass alles wieder so ist wie es vorher war. Zudem verdeutlichen „so will ich dich auf Händen tragen, mein liebstes Kind“ (Z.938f.),“du sollst bei mir dein Wochenlager halten“ (Z.939) und „mit größerer Zärtlichkeit nicht und Würdigkeit könnt ich dein pflegen“ (Z.940f.), dass sich die Obristin die Marquise wieder zurückwünscht. Jedoch zeigt das Verb „pflegen“ (ebd.) und die Formulierung „auf Händen tragen“ (ebd.), dass sie sich die Marquise als ein kleines Kind oder Baby zurückwünscht.
Zusammenfassend ist also zu sagen, dass an der vorgegebenen Textstelle das individuelle Charakterbild der Obristin zu sehen ist, da sie sich den gesellschaftlichen Konventionen stellt sich ihr Charakter wandelt und eine eher unübliche Haltung gegenüber ihrer Tochter hat. Zudem erfährt dadurch die Außenwelt eine „spezifische Brechung“ (Z.20), da die Obristin mit ihrem besonderem Verhalten die Welt in „Die Marquise von O.“ prägt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Textstelle der Kleist-Novelle ein Beispiel bzw. der Beweis für die im Zitat aufgestellte Behauptung ist.
Vogt und Marquise von O.... (2.Aufgb.)
Die Merkmale des auktorialen Erzählers aus dem Sachtext „Auktoriale Erzählsituation“, geschrieben von Jochen Vogt aus dem Jahr 1979, lassen sich auf den Textauszug von Zeile 1134 bis 1165 von Heinrich Kleists Novelle „Die Marquise von O…“ aus dem Jahr 1808, anwenden. Im folgenden werden die Merkmale der Erzählsituation anhand von exemplarischen Textstellen herausgearbeitet und erläutert.
Der angegebene Textauszug ist das Ende der Novelle, in dem die Marquise gezwungen wird, den Grafen von F zu heiraten, der, wie sich im Verlauf der Handlung herausstellt, die Marquise während einer vermeintlichen Heldentat nicht gerettet, sondern vergewaltigt hat. Er befasst sich mit der Hochzeit sowie mit der darauffolgenden Taufe des Sohnes und dem Verlauf ihres Lebens, indem der Graf F Nähe zur Marquise findet. Der Textausschnitt setzt mit der Hochzeit und dem Satz „Erst an dem Portal der Kirche war es dem Grafen erlaubt, sich an die Familie anzuschließen“ (Z.1134f.) ein. In diesem Beispiel wird das erste Mal die Allwissenheit des auktorialen Erzählers deutlich, da der Erzähler über die schwierigen Verhältnisse und Umstände dieser Heirat genauestens Bescheid weiß. Die Allwissenheit hat eine wichtige funktionale Bedeutung für diesen Textauszug, da somit deutlicher wird wie die Stimmung zwischen der Familie, dem Grafen von F und der Marquise ist. Dadurch kann man der Handlung konstant folgen, was beim personalen Erzähler, der ausschließlich das wiedergibt was die personalerzählte Person wahrnimmt, nicht der Fall ist. Darauffolgend gibt der auktoriale Erzähler die Trauung wieder. Jedoch fällt ihm auf, dass die Marquise „starr auf das Altarbild [guckt]“ (Z.1135) und dem Grafen von F nicht einmal einen „flüchtige[n] Blick“ (Z.1136) zuwirft. Dies verdeutlicht, dass der Erzähler die Reaktion der Marquise genau beobachtet, weswegen ihm dies aufgefallen ist. Das gezielte Beobachten zeigt, dass der Erzähler die Situation wertend betrachtet, also durch seine Augen und durch seine Meinung. Im Folgenden gibt der auktoriale Erzähler die Handlung wieder, in der der Graf von F der Marquise seinen Arm anbietet, sie sich jedoch nach dem Verlassen der Kirche verneigt. Im Satzteil „worauf der Graf etwas stammelte, das niemand verstand“ (Z.1140) wird deutlich, dass er das Geschehen auch aus der Perspektive aller wiedergeben kann, erkennbar am Pronomen „niemand“. Er spricht folglich für alle, und unterscheidet sich somit vom personalen Erzähler, der das Geschehen nur aus einem Blickwinkel betrachten kann. Darüber hinaus wird hier abermals seine Allwissenheit deutlich, da er sonst nicht hätte wissen können, dass ihn wirklich alle nicht verstanden. Durch diesen immer wiederkehrenden Aspekt der Allwissenheit, der sich von der Menschlichkeit abhebt und somit göttlich ist, wird dem Leser bewusst, dass ihm eine Erzählung vermittelt wird. Dieses Bewusstsein baut eine Distanz zwischen Leser und erzähltem Geschehen auf, die es dem Leser verhindert sich in das Geschehen hinein zu versetzen und ‚mit zu fiebern‘.
Sprache (Sachtexte)
Hinrichs
Der Text „Hab isch gesehen mein Kumpel – Wie die Migration die deutsche Sprache verändert hat“ aus dem Buch „Texte, Themen und Strukturen“ , geschrieben von Uwe Hinrichs und veröffentlicht im Jahr 2012, thematisiert den deutschen Sprachwandel, mit Fokus auf dem Einfluss der Migration.
Um in die Thematik die deutsche Sprache in Bezug auf Migration einzuleiten, beginnt Uwe Hinrichs den ersten Satz mit der These, dass „[…] [d]er deutsche Sprachraum […] seit je und von allen Seiten von fremden Sprachen und Kulturen umgeben [ist]“ (Z.1ff.). Mit der Phrase „von allen Seiten“ (ebd.) deutet er auf die geografische Situation Deutschlands an, die schon immer zentral in Europa war, wodurch dementsprechend Deutschland auch viele Nachbarländer mit fremden Kulturen hatte und hat. Die adversative Konjunktion „trotzdem“ (Z.3) deutet an, dass Deutschlands aktuelle Situation, trotz des langwierigen Kontakts mit anderen Kulturen und Sprachen, während der „Nachkriegszeit“ (Z.4) und „zur Zeit des Wirtschaftswunders“ (Z.4f.) anders war. Zu dieser Zeit nämlich habe Deutschland „die weiche Variante des Sprachenkontakts kennengelernt […]“ (Z.5f.). Die Metapher „weiche Variante“ (ebd.) impliziert, dass man damals nicht gezwungen war, sich mit einer Fremdsprache auseinander zu setzen, man hatte also die Wahl. Die anhängende Erläuterung „gesteuert, kulturell abgefedert und ohne wirkliche soziale Konsequenzen“ (Z.7f.) dient als nähere Erklärung davon und verdeutlicht zudem, dass Deutschland keine Erfahrungen mit den negativen Seiten der Migration in Bezug auf die deutsche Sprache gemacht hat. Die Beispiele „Man las englische Autoren, lernte in der Schule Französisch und Latein, [und] reiste in den Ferien nach Ibiza“ (Z.8ff.) bekräftigen dies und unterstützen den bereits erläuterten Aspekt der Schonung. Diese Beispiele stehen exemplarisch für Situationen, die auch in der heutigen Zeit möglich wären, sodass sich der Leser in diese Situationen hineinempfinden kann und die Rolle derer Beispiele für dieses Thema verstehen können. Dies unterstütz ebenfalls das Pronomen „man“ (Z.8), das als verallgemeinernd gilt und somit jeden miteinbezieht. Unterstützt werden die Beispiele durch einen hypotaktischen Satzbau, der ebenfalls zur genaueren Erläuterung des Themas dient. Die Ergänzung „und begegnete später allenfalls ein paar Gastarbeitern, die meistens nur gebrochen Deutsch sprachen“ (Z.10ff.), soll die damals denkbar schlimmste Folge der Migration auf die deutsche Sprache sein, dessen Erwähnung abermals verdeutlicht, dass sich diese, aus heutiger Sicht, harmlose Situation geändert hat. Die adversative Konjunktion „jedoch“ (Z.13) kündigt dies ebenfalls eine Veränderung dieses harmlosen Zustands an und wird darauffolgend erläutert. Der Satz „[D]ie Deutschen [erleben] zum ersten Mal, wie es ist, wenn das Leben im eigenen Land wirklich tiefgreifend von fremden Menschen, Kulturen und Sprachen mitgeprägt und der Alltag auf eine unübersehbare Weise vielsprachig wird“ (Z.13ff.) verdeutlicht, wie die Realität eines solchen Wandels aussieht, also wie es „wirklich“ (ebd.) ist. Zeitliche Einordnungen wie „[s]eit den siebziger Jahren“ (Z.13), sowie „die Nachkriegszeit“ (Z.4) bilden zusammen mit der inhaltlichen Aufführung des Sprachwandels ein einleitendes Hintergrundwissen zur Thematik. Am Ende dieser Einleitung (Z.1-20) steht die Kernfrage „Wie haben die jüngsten Sprachkontakte das Deutsche verändert?“ (Z.19f.), auf die in diesem Abschnitt hingearbeitet wurde. Der zweite Sinnabschnitt (Z.21-40) beginnt mit einer These, bzw. mit der Erklärung, wo der Sprachwandel beginnt, nämlich mit dem, „was [Immigranten] für einfache Kommunikationszwecke mit fremden Sprechern am allerwenigsten benötig[en]“ (Z.21ff.). Der darauffolgende Satz „Das sind die Fälle, die Endungen und die Regeln ihrer Verknüpfung“ (Z.24f.) dient als nähere Erläuterung und verdeutlicht, dass Hinrichs vermitteln will, dass Menschen die Deutsch lernen, weil sie es müssen um sich zu verständigen, sich das Leben leichter machen und kleine Aspekte der Grammatik missachten, oder weglassen. Um dies zu beweisen, wird „Bastian Sicks Bestseller […]“ (Z.26f.) „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ erwähnt, welches ein Buch mit einem berühmten Titel ist, und gleichzeitig passend als ein Beispiel für Vereinfachung der deutschen Sprache ist. Dies verdeutlichen, bzw. unterstützen die Metaphern, „dass der Genitiv bereits einen aussichtslosen Kampf kämpft“ (Z.27f.) und „Aber auch Dativ und Akkusativ müssen Bastionen räumen“ (Z.29f.), die zudem auch Ironie verdeutlichen. Auffällig hierbei ist zusätzlich der Gebrauch von themagerechtem Wortschatz, Beispiele dafür sind die Fachwörter wie „Genitiv“ (Z.27), „Dativ und Akkusativ“ (Z.29f.), die die Glaubhaftigkeit des Verfassers unterstreichen. Mit den fehlerhaften Formulierungen „‘mit diesen Problem‘“ (Z. 31) und „‘wir haben hier ein Rest‘“ (Z.33) nennt er das Problem nicht nur beim Namen, sondern unterstreicht im darauffolgendem, dass man das „nicht nur überall hören [kann]“ (Z.34f.), sondern „es wird schon zum Teil, auch in Examensarbeiten, schon so geschrieben“ (Z.36ff.). Hinrichs betont mit den „Examensarbeiten“ (ebd.), dass die zuvor aufgeführten Fehler selbst in wichtigen Arbeiten im späteren Leben gemacht werden, und deutet damit seine eigene Meinung an. Da er die „junge[n] Leute“ (Z.37) als die ansieht, die die meisten solcher Grammatikfehler machen, deutet es darüber hinaus an, dass sich solche Fehler nicht in der Zukunft legen, sondern dass sie Jugendliche bis ins Berufsleben verfolgen. In den darauffolgenden Sätzen korrigiert er die vorher angeführten Fehler (Z.38ff.) und führt damit indirekt vor Augen, dass es nötig ist diese Fehler zu korrigieren. Nach der Erläuterung des Problems im zweiten Sinnabschnitt, folgt der Bezug zum Thema Migration im dritten Sinnabschnitt (Z.41-57). Im Satz „Das mehrsprachige Milieu kann auf korrekte Deklination und genaue Endungen durchaus verzichten, weil diese Art Grammatik nur Kodierungsenergie frisst, die woanders viel dringender gebraucht wird, beispielsweise um Defizite im Wortschatz auszugleichen“ (Z.41ff.) Die Metapher Kodierungsenergie zu fressen (vgl. ebd.), sowie die Verwendung des Fachwortes „Deklination“ (ebd.) verdeutlichen Ironie und deuten somit gleichzeitig die Haltung des Verfassers gegenüber dieser Problematik an. Gegenüber dazu steht jedoch der Begriff „Puristen“ (Z.49), die als übertriebene Vertreter der Reinheit zu definieren sind und somit ebenfalls als nicht seriös dargestellt werden. Die Problematik dieses Aspektes wird durch die Correctio „Hinter dem, was Puristen als Verfall, ja Verlotterung anprangern, steckt nur die Strategie, die Sprachkulturen zu vereinfachen, um das Kommunizieren mit Nichtmuttersprachlern zu erleichtern“ (Z.48ff.) eindringlich bekräftigt. Zudem nennt Hinrichs hierbei die fehlerhafte Nutzung der deutschen Grammatik ironisch „Strategie“ (ebd.). Abgeschlossen wird der Sinnabschnitt mit der Prognose, dass „viele Schulkategorien wie Konjunktiv, Plusquamperfekt oder vollendetes Futur […] in naher Zukunft wahrscheinlich kaum noch gebraucht [werden]“ (Z.54ff.)
Im vierten Abschnitt (Z.68-83) geht Hinrichs auf eine weitere Ursache für den Sprachwandel in Deutschland ein. Ein Grund dafür liegt „in den Herkunftssprachen der Migranten“ (Z.59), auf dessen Sprachstrukturen Einwanderer zurückgreifen. Zudem stellt er die Behauptung auf, dass „[d]iese […] ins Deutsche kopiert und im zweisprachigen Milieu gefestigt [sind]“ (Z.62f.). Als ein erläuterndes Beispiel wird das „großstädtische[…] Kiezdeutsch“ (Z.64) benannt, dass von der Expertin „Heike Wiese“ (Z.65) erforscht wird. Diese Behauptung wird durch die Ergebnisse und zahlreiche Beispiele belegt. Ein Beispiel sind Satzmuster aus dem „Arabischen und Türkischen“ (Z.77), „neue Steigerung[en“ (Z.73f.) und die „neudeutschen Ausdrücke mit ‚machen‘“ (Z.80), die ebenfalls wieder exemplarisch belegt und somit verstärkt werden. Somit erklärt Hinrichs in diesen Abschnitt, dass sich Migranten, die ihre Muttersprache mit ins neue Land nehmen, diese und dessen Sprachstrukturen auf die deutsche Sprache anwenden, sodass Deutsch mit ausländischen Sprachkulturen dabei herauskommen. Dass Ausdrücke mit „machen“ (vgl. ebd.) im vorliegenden Text als „neudeutsch“ (ebd.) bezeichnet wird, bestärkt nur einmal mehr Hinrichs‘ Prognose, dass diese neue und einfache Version der deutschen Sprache sich bereits festigt, da sie, wie im Beispiel zu sehen, bereits als deutsch bezeichnet werden. Zusammenfassend kann man also sagen, dass viele Menschen die deutsche Sprache mit ihren ausländischen Satzstrukturen übernehmen und dass sie sich vermehrt durchsetzen. Im vorletzten Sinnabschnitt (Z.84-106) thematisiert Hinrichs die letzte, „heiße Phase“ (Z.84) des Sprachwandels. Zuvor hat er Gründe und Ursachen für die Entwicklung der deutschen Sprache durch Migranten benannt und mit Beispielen erläutert, sodass er in diesem Abschnitt die Bedeutung der anderen Seite anreißt. Dabei bestärkt die Metapher „heiße Phase“ (ebd.) die Bedeutung des folgenden Punktes. Hinrichs führt hierbei nämlich an, „dass die ‚Fehler‘ der Migranten allmählich von den deutschen Muttersprachlern nachgeahmt werden“ (Z.86) und betont gleichzeitig die Bedeutsamkeit dieser Phase. Er vermittelt hierbei nämlich, dass die eigentliche Problematik nicht darin besteht, dass Fehler gemacht werden von Migranten, sondern dass deutschsprachige diese aufnehmen und übernehmen. Zudem stellt er die Prognose auf, dass „es irgendwann nicht mehr auszumachen ist, wer nun gerade richtig – oder falschliegt“ (Z.88ff.) die er mit „die Grenzen verschwimmen“ (Z.90f.) metaphorisch bekräftigt. Er sagt damit also aus, dass die Ursache für die Fehler Migranten seien, Deutsche die Fehler nachahmen und es dementsprechend nicht besser machen. Darauffolgend macht Hinrichs eine kurze Zusammenfassung dessen, was er bereits geschrieben hat (Z.91-97), in der er die einzelnen ‚Schritte‘ des Sprachwandels erläutert und somit ihre Verbindungen besser veranschaulicht. Die Folge dieses Prozesses nennt er eine „neue[…], stabilere[…] Situation“ (Z.98), womit er indirekt darauf anspielt, diesen ausführlich erläuterten Sprachwandel als besser zu bezeichnen. Dies verdeutlicht auch seine Zusammenfassung zu den Änderungen in der deutschen Sprache: „Die Grammatik ist reduziert, der innere Zusammenhalt der Satzteile gelockert, viele Regeln sind vereinfacht oder lösen sich ganz auf, die Sprache wird einfacher (und wird vom Englischen unterstützt)“ (Z.101ff.). Wie auch zuvor verdeutlicht das Adjektiv „locker“ (ebd.) die des Autors positiv gestimmte Meinung. Der abschließende Absatz (Z.107-120) befasst sich allgemein mit der Erforschung des Sprachwandels. Hinrichs stellt dabei fest, dass sich „Wissenschaften […] mit der Erforschung dieser Prozesse jedoch weitgehend zurück[halten]“ (Z.107f.) und stellt dazu anhängend die Hypothese auf, dass Forschungen zum Thema Sprachwandel und den Einfluss Migranten ein Thema ist bei der man vorsichtig sein muss, um nicht als diskriminierend bezeichnet zu werden, da, wie bereits erläutert, der Einfluss enorm groß ist und die Ergebnisse solcher Forschungen danach klingen könnten, dass man Migranten die Schuld für die Veränderung der deutschen Sprach trägen. Dies wird im vorliegendem Text mit der Metapher „Diskriminierungsfalle“ (Z.112f.) noch einmal bekräftig und veranschaulicht. Mit „Dies ist schade“ (Z.113) bekennt sich der Verfasser am Ende des Textes zu seiner Meinung und sagt aus, dass er findet, dass diese Thematik, auf rein wissenschaftlicher Basis, tiefer erforscht werden sollte. Dies bekräftigt er indem er dies nicht als Diskriminierung, sondern als „Gelegenheit, Deutsche und Migranten zusammenzubringen und die Vision einer offenen Gesellschaft mit Leben zu füllen“ (Z.115ff.) bezeichnet, womit er gleichzeitig vermittelt, dass keine seiner Aussagen im Text diskriminierend sein sollen. Der metaphorische Satzteil „offene Gesellschaft“ (Z.117) untermauert des Verfassers Offenheit gegenüber Migranten und unterstützt somit das zuvor erläuterte. Schlussendlich wird der Text mit der Wiederholung der These „Was man nicht braucht, das schleift sich in der Sprache schnell ab“ (Z.119f.) abgeschlossen, die daran erinnern soll, dass nicht die Migranten die Ursache des Sprachwandels sind, sondern dass alle es sind, da sie sich die deutsche Sprache selber vereinfachen.
Abschließend und zusammenfassend lässt sich sagen, dass Uwe Hinrichs‘ Text zum Thema Sprachwandel einleitend mit Hintergrundwissen beginnt und sich mit der Frage, wie sich der vermehrte Kontakt mit anderen Sprache auf die deutsche Sprache auswirkt, beschäftigt. Im zweiten Sinnabschnitt (Z.21-40) werden hierbei die grundlegenden Probleme und häufigsten Fehler thematisiert, für die im dritten Sinnabschnitt (Z.41-57) nach einem Grund oder Ursachen, vor allem in Bezug auf Migration gesucht werden. Dann werden im vierten (Z.58-83) und im fünften Abschnitt (Z.84-106) auf ändernde Satzmuster eingegangen und der komplette Wandel der Sprache zusammengefasst und seine Folgen für die Zukunft erläutert. Hinrichs stellt zudem die Thesen auf, dass Fehler bei als unnötig erscheinenden Regeln auftreten und dass Deutsch vereinfacht, bzw, abgeschliffen wird wo man kann. Am Ende wagt er die Prognose, dass sich Deutsch weiterhin in diese Richtung entwickeln wird. Als bekräftigende Erläuterung dafür enthält der Text viele Beispiele, adversative Konjunktionen, Wiederholungen und einen weitgehend hypotaktischen Satzbau, sowie eine schlüssige Struktur zur Erläuterung der Entwicklung. Darüber hinaus deuten eine Correctio, die Verwendung von Fachwörtern sowie Ironie, und der letzte Abschnitt die Meinung des Autors an.
Mocikat
Der Text „Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben“, verfasst von Ralph Mocikat und veröffentlicht im Jahr 2011, thematisiert die steigende Bedeutung der englischen Sprache in der Wissenschaft und die Gründe weshalb sie für die Wissenschaftskommunikation kontraproduktiv sei.
Der Verfasser des Textes benennt das Ziel, beziehungsweise die Intention des Textes schon im Titel „Deutsch muss als Wissenschaftssprache erhalten bleiben“ (Z.0), der als deutlichen Appell formuliert ist. Diese Deutlichkeit bezüglich seiner Absichten ist darüber hinaus auch im Text wieder zu finden, der mit dem ersten Sinnabschnitt (Z.1-5) und der These „[i]n der Wissenschaftskommunikation wird zunehmend auch im Inland ausschließlich die englische Sprache verwendet“ (Z.1f.) beginnt. Hierbei behauptet Mocikat, dass Wissenschaftler, obwohl sie deutschsprachig sind, die englische Sprache nutzen und stellt somit die Widersprüchlichkeit der Situation vor. Dies wird unter anderem hervorgehoben durch die ergänzende Information „auch im Inland“ (Z.1), wobei hierbei ebenfalls die Problematik sehr konkret benannt wird, da er sich auf das Beispiel Deutschland bezieht. Ebenfalls hervorgehoben wird dieser Aspekt durch das Adverb „ausschließlich“ (Z.1). Mit dem Satz „Das gilt insbesondere für naturwissenschaftliche und technische Disziplinen“ (Z.2f.) nennt er zwei konkretisierende Beispiele und bezieht sich somit näher auf zwei besonders ‚betroffene‘ Bereiche der Wissenschaft. Da Mocikat Molekularbiologe ist, lässt sich die Vermutung aufstellen, dass im vorliegendem Text nicht nur seine Meinung bezüglich des Anglizismus‘ deutlich wird, sondern dass er sich auf seine persönlichen Erfahrungen bezieht. Mit dem Satz „[a]uf Kongressen mit ausschließlich deutschsprachigen Teilnehmern werden Vorträge fast immer nur noch auf Englisch gehalten“ (Z.3f.) benennt er ein Beispiel für den Gebrauch der englischen Sprache von deutschsprachigen Gruppen, was seine Glaubhaftigkeit bezüglich der Thematik festigt und widerspiegelt. Die Repetitio „ausschließlich“ (ebd.) untermauert abermals die Widersprüchlichkeit, dass sich Deutschsprachige auf ihrem Gebiet der Wissenschaft auf Englisch unterhalten, die durch die Wiederholung betont wird. Mithilfe der im darauffolgenden Satz genutzten Formulierung „schreiben oft vor“ (Z.4), übt Mocikat indirekt Kritik auf die „[h]iesige[n] Drittmittelgeber“ (Z.4) aus und deutet damit an, dass einflussreiche Investoren, also zwangsweise Menschen die nicht immer selber an den beispielhaft genannten „Kongressen“ (ebd.) und „Vorträge[n]“ (ebd.) teilnehmen, diese widersprüchliche und später als sinnlos bewiesene Entwicklung fördern würden, indem sie „ [vorschreiben], Förderanträge lediglich in englischer Sprache einzureichen“ (Z.4f.). Zudem vermitteln Adverbien wie „ausschließlich“ (ebd.) und „lediglich“ (ebd.), dass es kaum noch Bereiche in der Wissenschaft in Deutschland gibt, die nicht vom Englischen eingenommen seien. Allgemein und zusammenfassend kann man sagen, dass der erste Sinnabschnitt die Funktion hat in die Thematik und in die genaue Situation einzuleiten, wobei die Dringlichkeit dieser sich im fast überwiegend parataktischem Satzbau widerspiegelt. Zudem verdeutlicht dieser die Deutlichkeit des im Titel genannten Appells beziehungsweise Ziels, sowie Mocikats Meinung diesbezüglich. Der zweite Sinnabschnitt (Z.6-14) beginnt mit der These, dass „ [i]mmer mehr Hochschulen […] Studiengänge komplett auf Englisch um[stellen]“ (Z.6), mit der gezeigt wird, dass auch Neueinsteiger beziehungsweise Lernende der Wissenschaft von der erläuterten Problematik betroffen sind. Mithilfe von „[i]mmer mehr“ (ebd.) stellt Mocikat die Ausbreitung der englischen Sprache dar und stellt gleichzeitig mit der Erwähnung der „Hochschulen“ (ebd.) den Bezug zur jüngeren Generation her, um zu verdeutlichen, wie weit die Entwicklung schon verbreitet ist. Mit dem Adjektiv „komplett“ (Z.6) wird betont, dass der Gebrauch der englischen Sprache in einem Raum voller Deutschsprachiger in Deutschland kein Einzelfall sei. Nachdem Mocikat bis hierhin die Problematik erklärt hat, belegt er nun, eingeleitet durch die adversative Konjunktion „dabei“ (Z.6), weshalb dies widersprüchlich und sinnlos sei und beruht sich dabei auf „verschiedene Studien aus den Niederlanden, Schweden oder Norwegen“ (Z.6f.), die gezeigt haben, dass „das tiefere Verständnis deutlich eingeschränkt ist, wenn Studierende den Stoff in ihrer Disziplin nur in der Lingua franca aufnehmen“ (Z.7ff.). Damit wird angedeutet, dass Studierende, die ihren Lernstoff durch eine Fremdsprache vermittelt bekommen, nur ein oberflächliches Verständnis erlangen, was verdeutlicht, dass dieses Vorgehen, beziehungsweiser dieser Prozess des Anglizismus‘ nicht seinen Zweck erfülle, da die Studierenden in erster Linie nicht Englisch, sondern einer ihrer selbstgewählten Disziplinen (vgl. Z.8) erlernen sollen, und das mit „tiefe[m] Verständnis“ (ebd.). Das Personalpronomen „uns“ (Z.10) des Satzes „[a]uch bei uns erleben wir täglich, welche Konsequenzen es mit sich bringt, wenn Seminare oder wissenschaftliche Besprechungen nicht mehr in der Muttersprache abgehalten werden […]“ (Z.10f.), spiegelt die persönlichen Erfahrungen Mocikats wider, die die Funktion erfüllen, dem Leser mit der Thematik ein Stück näher zu kommen und ihm die Bedeutung der Problematik näher zu bringen. Die Aufzählung der Folgen in Verbindung mit dem Adjektiv „täglich“ (ebd.) erschaffen die Wirkung, dass die Konsequenzen der Problematik schon im Alltag eines arbeitenden Wissenschaftlers zu finden seien, und den dementsprechend negativ beeinflussen. Die indirekte Frage, was passiere wenn diese wichtigen wissenschaftlichen Besprechungen nicht mehr in der Muttersprache abgehalten würden, wird durch die parataktische und somit deutliche Antwort „Sie verflachen“ (Z.12) klar beantwortet. Dies hebt die Sicherheit und das Selbstbewusstsein des Verfassers bezüglich dieser Thematik hervor und wirkt gleichzeitig überzeugend auf den Leser. Das durch das Pronomen „man“ (Z.12) verallgemeinernde Beispiel „In vielen Seminaren merkt man beispielsweise, wie die Diskussionsbereitschaft dramatisch schwindet, wenn die Fachsprache Englisch ist“ (Z.12f.), verdeutlicht abermals die Seriosität und Glaubhaftigkeit der Argumentation und der Thesen. Zudem wird durch das hyperbolische Adjektiv „dramatisch“ (ebd.) hervorgehoben, wie drastisch die Anteilnahme an Diskussionen sinke, was zusätzlich vermuten lässt, dass das durch die Fremdsprache fehlende Verständnis das Interesse an der Wissenschaft nehme. Mit „selbst wenn alle Teilnehmer das Englische hervorragend beherrschen“ (Z.13f.) entkräftet er das Gegenargument einige Studenten könnten einfach nicht genug Englisch, im Vorhinein. Damit deutet er an, dass das Problem nicht im fehlenden Können liegt, sondern das es andere Ursachen habe, auf die Mocikat im nächsten Abschnitt eingeht.
Der dritte Sinnabschnitt (Z.15-33) beschäftigt sich mit den Gründen gegen das Englische in der Wissenschaft, was unter anderem an dem Satzteil „[d]as liegt daran“ (Z.15) erkennbar ist. Er behauptet der Grund dafür, dass man Englisch nicht durch die Muttersprache ersetzen kann sei, „dass Sprache nicht nur eine kommunikative, sondern auch eine kognitive Funktion hat“ (Z.15f.). Den Begriff „kognitiv“ (ebd.) definiert er näher mit dem Satz „Unsere Denkmuster, das Auffinden von Hypothesen, die Argumentationsketten bleiben- auch in Naturwissenschaften- stets in dem Denken verwurzelt, das auf der Muttersprache beruht“ (Z.16ff.). Seine Glaubhaftigkeit bekräftigt er hier abermals mit Beispielen (vgl. ebd.) und verleiht gleichzeitig seinem Text einen logisch-kohärenten Geschmack. Zudem deutet er an, dass ein Mensch, egal wie gut Englisch er sprechen kann, immer zuerst in seiner Muttersprache denkt, da diese in seinem „Denken verwurzelt“ (ebd.) sei. Mit „Wissenschaftliche Theorien arbeiten immer mit Wörtern, Bildern, Metaphern, die der Alltagssprache entlehnt sind“ (Z.18f.) bezieht er sich wieder auf seinen Zielbereich, die Wissenschaft. Die Aufzählung verdeutlicht die Vielfalt einer Muttersprache und deutet gleichzeitig an, dass diese nicht durch eine Fremdspracheersetzt werden kann. Dies erklärt er genauer mit den Worten „Die ganze Tragweite von Anspielungen und Bildern kann man nur in der jeweiligen Muttersprache voll erfassen und für die Forschung fruchtbar machen“ (Z.19ff.) und zeigt dadurch auch, dass das fehlende tiefe Verständnis durch den Gebrauch von Englisch dazu führt, dass die Wissenschaft nicht weiterkommt. Der Nachwuchs, der auch verantwortlich dafür ist, dass die Forschung Fortschritte macht habe also nur ein oberflächliches Verständnis, dass kontraproduktiv ist. Dies wird durch die Personifikation „für die Forschung fruchtbar machen“ (ebd.) veranschaulicht wird.
Krischke
Der vorliegende Sachtext “Schreiben in der Schule- booaaa mein dad voll eklich wg schule”, geschrieben von Wolfgang Krischke und veröffentlicht im Jahr 2011, thematisiert den Grund für fehlerhafte Sprache der Schüler in Bezug auf elektronische Medien.
Die Einführung in die Thematik beginnt schon mit dem Titel, der nicht nur ein repräsentatives Beispiel für eine von einem Schüler verfasste SMS darstellt, sondern gleichzeitig die Vielzahl der Fehler veranschaulicht. Denn im Satz “booaaa mein dad voll eklich wg schule” fehlt nicht nur ein Prädikat, auch die Grammatik ist falsch, sowie die Rechtschreibung und Groß- und Kleinschreibung. Darüber hinaus ist er umgangssprachlich formuliert, enthält einen Anglizismus und eine Interjektion. Diese Veranschaulichung zeigt exakt die Stellen, an denen Schüler in der deutschen Sprache Probleme hätten, sodass der Titel direkt zu Beginn die Problematik aufzeigt, dass Schüler zu viele Fehler machen würden. Dazu antithetisch steht der erste Satz des Untertitels “Simsen macht Schüler nicht dumm” (Z.1), der gleichzeitig eine These ist. Diese Behauptung deutet an, dass der Autor der Meinung ist, dass diese Form des Simsen nicht unbedingt einen negativen Einfluss auf die geschriebene Sprache der Jugendlichen habe, obwohl sie meist, wie im Titel veranschaulicht, sehr viele Fehler aufzeigen. Auf der anderen Seite deutet Krischke, eingeleitet durch eine adversative Konjunktion, mit der These “Aber ihre Texte sind heute fehlerhafter als früher” (Z.1) bereits an, dass das Problem die Texte von Schülern seien heutzutage fehlerhafter als früher, nicht direkt im Zusammenhang mit fehlerhaften Textnachrichten in Verbindung stehe. Mit “Kinder lesen zu wenig?” (Z.2) beginnt der erste Sinnabschnitt (Z.2-14) vom Sachtext, der zugleich eine heutzutage oft vertretene Meinung mit der parataktischen Antwort “Von wegen” (Z.2) dementiert. Mit dieser Frage verdeutlicht Krischke seinen Standpunkt bezüglich der Vor- und Nachteile zum Thema soziale Medien, in dem er mit der parataktischen Antwort “Von wegen” (ebd.) die Behauptung aufstellt, Kinder lesen heute viel mehr als man denkt, was er durch den danach folgenden Satz “Wohl noch nie zuvor haben sie so viel gelesen und geschrieben wie heute” (Z.2f.) sogar zuspitzt. Er behauptet also nicht nur, dass Kinder viel lesen, sondern auch, dass sie mehr als je zuvor lesen würden. Die These untermauert er durch die darauffolgenden Beispiele, die Situationen oder Möglichkeiten zeigen, wo Kinder tagtäglich lesen. Dabei umfasst bei genauerer Betrachtung das “[t]äglich[e] Tippen [...] von Wörtern auf ihren Handy- und Computertasten” (Z.4f.) und das “[V]erbringen [von] Stunden mit der Lektüre von SMS- Nachrichten, Chat-Sprüchen, E-Mails und Internet-Infos” (Z.4ff.) den Bereich der elektronischen Medien. Daraus resultierend wird hier also aufgezeigt, dass Kinder aufgrund von modernen Möglichkeiten viel lesen, jedoch das alte, “klassische” Lesen von Printmedien wie Buch und Zeitung überholt sei. Anhand der adversativen Konjunktion und des Satzes “Trotzdem kommt bei Pädagogen und Ausbildern keine rechte Freude auf” (Z.6f.) lässt sich jedoch sagen, dass das Lesen von SMS-Nachrichten etc. jedoch nicht die beste Lösung sei, um richtige Grammatik, Rechtschreibung und Co. zu erlernen, also um fehlerfreie Texte zu schreiben. Der Grund dafür, weshalb dies nicht die beste Alternative sei, liefert der Satz “Denn den Simsern, Chattern und Twitterern dient die Schrift vor allem als Plaudermedium” (Z.7f.). Das sogenannte plaudern hat den Zweck, sich gemütlich und zwanglos zu unterhalten, oft in kurzer sprachlicher Form. In Bezug darauf bezieht sich Zwanglosigkeit wieder rum auf einfaches schreiben, ohne auf Falsch und Richtig zu achten, sodass bei dem zwanglosen plaudern über beispielsweise Twitter sprachlich falsche Sätze herauskommen. Als Beispiel für solch einen Satz dient die Überschrift (ebd.). Unglücklich über die vermehrte Nutzung von Chats etc. sind “Pädagogen und Ausbilder[...]” (ebd.) also deshalb, weil diese ein unvorbildliches Lesemedium darstellen können, ganz im Gegensatz zu Büchern und Zeitungen, die von extra Ausgebildeten auf Orthografie geprüft werden, und bei denen man grundsätzlich davon ausgehen könne, dass sie fehlerfrei seien. Somit erklärt Krischke den Unterschied zu früheren Lesemöglichkeiten und weshalb Experten die eigentlich positiv klingende Entwicklung nicht für gut heißen. Da also Beispiele wie Chat-Nachrichten Plaudermedien seien, und somit oft in einer fehlerhaften Alltagssprache formuliert sind, seien sie “von den Normen der Hochsprache [...] Lichtjahre entfernt” (Z.8f.). Damit wird gleichzeitig hyperbolisch das Ausmaß dieser Entwicklung angedeutet, wobei er dadurch auch betont, dass Schüler mit solch einer Vielzahl an Fehlern, wie im Titel dargestellt, nicht den eigentlichen Anforderungen gerecht werden und, dass die Unterschiede zwischen Hochdeutsch und der Sprache die Kinder zum plaudern benutzen immens seien. Ein weiteres Beispiel im nächsten Satz, sowie die Metapher “lässt Freunde des Dudens und ganzer Sätze noch immer zusammenzucken” (Z.11f.), weisen wieder auf die Vielzahl der Fehler hin, sodass damit gleichzeitig die These, Schüler machten heute viel mehr Fehler als früher (vgl. Z.1) unterstützt wird. Zusammenfassend kann man sagen, dass Krischke im ersten Sinnabschnitt zwei Feststellungen macht. Zum einen stellt er heraus, dass Kinder heute mehr lesen also zuvor, jedoch überwiegend sprachlich Falsches, zum anderen stellt er die Behauptung auf, Texte von Schülern seien heutzutage fehlerhafter. Mit der Frage “Können Jugendliche, die sich in diesen Trümmerlandschaften bewegen, überhaupt noch einen lesbaren Aufsatz, einen präzisen Bericht, ein angemessenes Bewerbungsschreiben verfassen?” (Z.12ff.) wagt er die Behauptung, dass diese beiden Thesen in Zusammenhang stehen könnten. Mit der Metapher “Trümmerlandschaften” (ebd.) wird noch einmal betont, wie weit einige SMS-Nachrichten von einem hochdeutschen Satz entfernt seien und wie zugespitzt die Situation sei. Der zweite Sinnabschnitt (Z.15-34) bezieht sich allgemein auf eine von Experten durchgeführte Forschung bezüglich dieses Themas. Dabei wurde diese Entwicklung von der Germanistik-Professorin Clara Dürscheid von der Universität Zürich erforscht, die sich mit 16- bis 18-jährigen Schüler aller Schulformen aus dem Kanton Zürich beschäftigt hat (vgl. Z.16ff.). Durch die detaillierte Erklärung des Ablaufes der Forschung gewinnt Krischkes Text an Glaubhaftigkeit und Seriösität, da er sich auf wissenschaftliche Ergebnisse beruft. Bei dem Experiment wurden die beiden Textarten, einmal die private und einmal die schulische, unmittelbar untersucht und verglichen auf verschiedene Aspekte wie “Rechtschreibung, Interpunktion[,] [...] Grammatik, [...] Wortschatz, [...] Stil und den Aufbau der Texte” (Z.22f.), womit die Genauigkeit der Forschung unterstrichen wird.