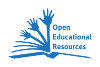Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Lyrik
Inhaltsverzeichnis |
Heil'ge Bläue
Das Naturgedicht „Heilige Bläue“, welches von Conrad Ferdinand Meyer geschrieben und 1896 veröffentlicht wurde, thematisiert die Schönheit der Natur und das Gefallen eines Menschen am Himmel. Das Naturgedicht ist in sechs Verse verteilt und besteht aus einer Strophe. Im ersten Vers wird eine Personifikation deutlich, da die „Bläue“ (V. 1) mit „du“ (V. 1) angesprochen wird, obwohl es nur eine Farbe ist. Die „Bläue“ (V. 1) könnte für den Himmel stehen. Dass der Himmel etwas Wertvolles und Göttliches ist, erkennt man an dem Adjektiv „heil‘ge“ (V. 1). Dies wird auch schon in dem Titel „Heilige Bläue“ zum Ausdruck gebracht. Zudem hat der Himmel eine religiöse Bedeutung für das lyrische Ich. In dem Ersten und Zweiten Vers erkennt man einen Paarreim. Da der „Glanz“ (V. 3) das lyrische Ich „Immer freut aufs neue“ (V. 2), erkennt man, wie wichtig ihm der Himmel ist und, dass er sich geborgen und wohl fühlt, wenn er in den Himmel schaut. Außerdem wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sein Gefallen am Himmel nie verschwindet oder kleiner wird. Zudem wird an dem „Glanz“ (V. 3) die Schönheit des Himmels, beziehungsweise der Natur zum Ausdruck gebracht. Die Metapher „stille“ (V. 3) zeigt, dass der Himmel sehr klar sein muss, wodurch sich auch der „Glanz“ (V. 3) erklären würde. Dies könnte aber auch auf das Wasser bezogen sein, in dem er sich auch wohl und geborgen fühlt. Zudem wird dadurch deutlich, dass das lyrische Ich gerne alleine ist, beziehungsweise es ruhig mag. Durch den „Abgrund ohne Ende!“ (V. 4) wird die Unendlichkeit und Weite des Himmels verdeutlicht. Weiterhin wird dadurch deutlich, dass das lyrische Ich auf dem Rücken liegt und in den Himmel schaut. Die göttliche und religiöse Bedeutung des Himmels für das lyrische Ich wird mithilfe der Worte „[h]immliches Gelände“ (V. 5) wiederholt. Die Weite und Unendlichkeit des Himmels wird erneut deutlich, da er als „Gelände“ (V. 5) beschrieben wird. Das sich das lyrische Ich im, beziehungsweise am Wasser oder im Himmel wohl und geborgen fühlt wird erneut deutlich, da es seiner „Seele“ (V.6) befielt „unter“ (V. 6) zu „tauche[n]“ (V. 6). Dies ist eine Metapher. In den Versen drei bis sechs erkennt man einen umarmenden Reim. Er bildet mit dem Paarreim einen Schweifreim und sorgt für die Bindung der Verse. Das Naturgedicht ist im Trochäus geschrieben und verleiht dem Text eine melodische Wirkung. Dies passt zum Inhalt des Gedichts, denn es spiegelt die harmonische und beruhigende Wirkung des Himmels wieder. Das Gedicht bringt zum Ausdruck, wie schön und göttlich der Himmel ist. Zudem wird deutlich, dass das Wasser und der Himmel gut für die Seele und das Wohlbefinden sind. Zuletzt wird deutlich, dass das lyrische Ich etwas Religiöses mit dem Himmel verbindet.
Die blaue Blume
Das romantische Gedicht „Die blaue Blume“, welches von Joseph von Eichendorff geschrieben und 1818 veröffentlicht wurde, thematisiert die Sehnsucht und verzweifelte Suche eines Menschen nach etwas Bedeutsamen. Das Gedicht ist in drei Strophen unterteilt. Sie bestehen alle aus vier Versen, weshalb eine Struktur und ein Schema erkennbar ist. Dies wirkt strukturiert und einheitlich. Es ist kein klares Reimschema zu erkennen. Zudem gibt es kein Metrum, die Verse enden aber meistens abwechselnd auf weibliche und männliche Kadenzen. Da es kein Metrum gibt, wird zum Ausdruck gebracht, dass das lyrische Ich gemischte Gefühle hat. Es ist eine Mischung aus Hoffnung und Enttäuschung. Die ersten zwei Verse beginnen mit der Anapher „Ich suche [...]“ (V. 1f.). Dadurch wird die Sehnsucht verdeutlicht, also wie sehr das lyrische Ich die „blaue Blume“ (V.1) finden möchte. Dies wirkt betonend und einprägsam. Die „blaue Blume“ (V.1) ist eine Metapher, die immer wieder in dem Gedicht genannt wird. Sie wirkt geheimnisvoll, da man nicht genau erkennen kann, für was die Blume steht. Sie steht für das Glück, oder die Liebe, welches das lyrische Ich sucht. Die „blaue Blume“ (V.1) ist aber auch ein Symbol aus der Romantik-Epoche, welches für Vollkommenheit und Glück steht. Zudem ist die „blaue Blume“ (V.1) eine Alliteration und wirkt einprägend und verdeutlichend. Dass das lyrische Ich schon lange auf der Suche nach dem Glück ist wird deutlich, da es die Blume „nie“ (V.2) „finde[t]“ (V.2). Die Sehnsucht ist schon so schlimm, dass das lyrische Ich davon „träumt“ (V.3). Weiterhin wird deutlich, dass das lyrische Ich von sich redet, da es immer wieder „Ich“ (V.1f) sagt. Das lyrische Ich denkt, dass wenn es die „Blume“ (V. 3) findet, es „gute Glück“ (V.4) hat. „[G]utes Glück“ (V.4) ist wiederum eine Alliteration und verstärkt die Bedeutung vom Glück. Dies bedeutet, dass es ein gutes Leben führen kann. Mit beispielsweise Gesundheit und Liebe. Im 3.. und 4. Vers kann man ein Enjambement erkennen, welches flüssig und rhythmisch wirkt. Der jeweils erste Vers „Ich wandre [...]“ (V.5&9) in den nächsten beiden Strophen ist eine Anapher und wirkt einheitlich. Die zweite Strophe beschreibt die Suche nach der „blauen Blume“ (V. 8). Das lyrische Ich wandert durch „Länder, Städt und Au‘n“ (V.6). Dies ist eine Aufzählung und wirkt verdeutlichend. Außerdem wird dadurch zum Ausdruck gebracht, wie sehr sich das lyrische Ich bemüht die Blume zu finden. Weiterhin erkennt man hier wieder einen Enjambement, weshalb der Vers rhythmisch wirkt. Dies ist auch in den Versen sieben und acht der Fall. Es schaut „in der Runde“ (V.7) weshalb Verzweiflung deutlich wird. Doch auch dort kann es die Blume „nirgends“ (V.7) finden. In der letzten Strophe wirkt es, als hätte das lyrische Ich die Suche schon aufgegeben, da es schon „seit lange“ (V.9) wandert. Auch wird dies im nächsten Vers zum Ausdruck gebracht, da es „lang gehofft, vertraut“ (V.10) hat. Dies ist ein Asyndeton und wirkt intensiver oder geengt, da die Aufzählung direkt nacheinander geschrieben ist. Die letzten zwei Verse sind eine Inversion und wirken unstrukturiert. Durch die Injektion „ach“ (V.11) wird die Verzweiflung und Sehnsucht erneut deutlich. Zuletzt wird zum Ausdruck gebracht, dass es das Glück oder die Liebe immer noch nicht gefunden hat, da es „Die blaue Blum [noch nirgends] geschaut [hat]“ (V.11f.). Zusammenfassend fällt auf, wie sehr das lyrische Ich nach dem Glück sucht und wie viel es dafür tut. Aus diesem Grund wird auch deutlich, weshalb es am Ende so enttäuscht und verzweifelt ist, als es das Glück nicht findet. Bei der Sprache fällt auf, dass das Gedicht schon sehr alt ist, da es manchmal merkwürdig formuliert ist. Häufig verwendete rhetorische Stilmittel sind zum Beispiel die Alliteration, diese soll das Ausgesagte einprägen, die Anapher, welche die Sehnsucht verdeutlicht und die Metapher, welche das Glück verbildlicht.
Willkommen und Abschied
Das Liebesgedicht „Willkommen und Abschied“, welches von Johann Wolfgang Goethe geschrieben und 1810 veröffentlicht wurde, thematisiert die Gefühle zweier Liebender bei der ersten Begegnung und dem Abschied. Das Gedicht besteht aus 4 Strophen mit jeweils 8 Zeilen. Die Kadenzen enden immer abwechselnd auf männliche und weibliche Kadenzen. Die daraus erkennbare Struktur spiegelt sich im Inhalt des Gedichtes wieder, da sich die Gefühle des lyrischen Ichs immer abwechseln. Der Titel „Willkommen und Abschied“ ist ein Gegensatz, welcher den Inhalt des Gedichts kurz und knapp zusammenfasst. Dies wird in dem folgenden Text belegt. Am Anfang des Gedichts wird die große Vorfreude des lyrischen Ichs deutlich, da das Herz „geschwind zu Pferde“ (V. 1) schlägt. Durch das pochende Herz wird allerdings auch ein wenig Unruhe deutlich, welche beschreibt, dass das lyrische Ich nicht mehr abwarten kann seine Geliebte zu treffen. Er läuft zu seinem Pferd um die Ungeduld und Unruhe loszuwerden, und endlich zu seiner Geliebten zu gelangen. In dem ersten Vers wird das Metrum, der Jambus, deutlich. Dieses Versmaß passt besonders gut zu diesem Vers, da es galoppierend und rhythmisch wirkt. Dadurch kann man sich das galoppierende Pferd und die ganze Szene besser vorstellen. Das Gedicht besteht aus Kreuzreimen. Diese passen wiederum zum Inhalt, da diese sich Überkreuzungen sozusagen abwechseln und somit die wechselnden Gefühle des lyrischen Ichs verstärkt werden. Durch die Personifikation „wiegte“ (V. 3) wird die Stille welche herrscht deutlich. Weiterhin wird dadurch eine ruhige und harmonische Stimmung simuliert und alles wirkt unbeschwert. Dies unterdrückt die eigentlich bedrohliche Wirkung der Dunkelheit. Die „Eiche“ (V. 5) welche wie ein „aufgetürmter Riese“ (V. 6) aussieht, ist umgeben von einem „Nebelkleid“ (V. 5). Dies wirkt bedrohlich. „Aufgetürmter Riese“ (V. 6) und „Nebelkleid“ (V. 5) sind Personifikationen und Metaphern und lassen die Situation menschlich und gleichzeitig unwirklich erscheinen. Hier kommen zum ersten Mal Selbstzweifel des lyrischen Ichs zum Ausdruck, da seine Glücksgefühle nicht mehr die schaurige Wirkung des Waldes übertönen. Durch die nächste Personifikation wird das Ganze verstärkt und das lyrische Ich fühlt sich von „schwarze[n] […] Augen“ (V. 8) beobachtet. Da der „Mond […] kläglich aus dem Duft hervor sah“ (V.9,10), wird deutlich, dass das lyrische Ich sogar die Planeten abwertet, da diese im Gegensatz zu seiner Geliebten unwichtig sind. Zudem wird durch diese Situation auch eine schaurige und bedrückende Wirkung belegt, da nur wenig Licht in den Wald fällt und es somit fast komplett dunkel ist. Da die „Nacht […] tausend Ungeheuer [schuf]“ (V. 13), werden erneut Selbstzweifel durch die bedrohliche Stimmung deutlich. Das lyrische Ich hat Angst, dass seine Geliebte die Gefühle nicht erwidert. Doch diese verfliegen wieder schnell, da die Liebe stärker ist und es schöpft neue Hoffnung da sein Mut „frisch und fröhlich [war]“ (V. 14). Dies ist eine Alliteration und wirkt einprägsam. Dadurch soll es die positive Einstellung behalten und seine Hoffnung nicht aufgeben. In den Versen 15 und 16 wird durch die Metapher, welche in Form von Ausrufen formuliert sind, „In meinen Adern, welch ein Feuer!/ In meinem Herzen, welche Glut!“ die Euphorie und Entschlossenheit des lyrischen Ichs deutlich. Zudem ist dies eine Repetition und soll die Aussagen verstärken. In dem 17. Vers wird die Geliebte zum ersten Mal angesprochen und durch die Inversion „Dich sah ich“ (V. 17) wird ihre Wichtigkeit betont, da das „Dich“ (V. 17) am Satzanfang steht. Durch die Metapher „die milde Freude/ Floss von dem süßen Blick auf mich“ (V. 17,18) wird deutlich, wie positiv die Geliebte auf das lyrische Ich wirkt. Zudem wird seine Liebe noch stärker, da die Freude/ [auf das lyrische Ich] [f]loss“ (V. 18). Es liebt nur sie, da das Herz „ganz […] an [ihrer] Seite“ (V. 19) ist. Weiterhin kommt zum Ausdruck, dass das lyrische Ich nicht ohne seine Geliebte leben kann oder will, da „jeder Atemzug für“ (V. 20) sie ist. Das „rosenfarbne[…] Frühlingswetter“ (V. 21) lässt die ganze Situation sehr lieblich und fröhlich wirken. Da das lyrische Ich mit „Götter[n]“ (V. 23) redet, wird das Glücksgefühl des lyrischen Ichs verstärkt. Ein paar Selbstzweifel werden jedoch am Ende dieser Strophe erneut deutlich, da es meint es „verdient‘ es nicht“ (V. 24). Durch die Interjektion „ach“ (V. 25) wird eine Enttäuschung des lyrischen Ichs deutlich, die darauf hinweist, dass etwas passiert. Da schon „mit der Morgensonne […]/ der Abschied […] das Herz [verengt]“ (V. 25,26) wird zum Ausdruck gebracht, wie kurz das Treffen war und wie sehr der Abschied das lyrische Ich bedrückt. Das der Abschied auch der Geliebten schwer fällt, wird deutlich, da in ihren Augen „Schmerz“ (V. 28) zu erkennen ist. Anhand der Repetition in den Versen 27 und 28, wird der Schmerz und die Trauer deutlich. Dies wird auch durch den Gegensatz „Ich ging, du standst“ (V. 29) deutlich. Die lässt die Stimmung bedrückt wirken und die Geliebte muss weinen, was an den Wörtern „nasse[r] Blick“ (V. 30) verdeutlicht wird. Das das lyrische Ich aber dankbar dafür ist, dass es es geliebt wird und lieben durfte, wird durch dem Chiasmus „Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!/ Und lieben, […] welch ein Glück“ (V. 31,32) verstärkt. Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Gedicht aus einer Mischung aus den Gefühlen des Glücks, bzw. der Hoffnung und der Trauer, bzw. der Enttäuschung besteht. Erst ist das lyrische Ich voller Freude seine Geliebte zu treffen und am Ende muss es mit dem Abschied zurecht kommen. Trotzdem schätzt es, dass es lieben durfte und auch geliebt wurde. Damit man sich besonders gut in die Lage des lyrischen Ichs bzw. in das Gedicht hineinversetzten kann, wurden viele Metaphern und Personifikationen zur Anschauung verwendet. Sie wurden aber auch verwendet, um die gemischten Gefühle des lyrischen Ichs darzustellen.