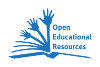Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Analyse Guratzsch: Unterschied zwischen den Versionen
(→Carina) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
In seinem zweiten Abschnitt „Sprachwandel bedingt auch Verlust“ geht Guratzsch konkret auf die Konsequenzen für den einzelnen Normalbürger ein. Er berichtet unter anderem darüber, dass das Institut für Deutsche Sprache (IDS) auch noch seine Jahrestagung in Mannheim dem Thema widmete“ (Z.24f.), wodurch in gewisser Weise ein Ende des Sprachverfalls hervorgerufen wurde, was durch die metaphorische Aussage „wurde das Halali geblasen“ (ebd.) untermauert wird. Des Weiteren zitiert Guratzsch den Sprachwissenschaftler Otto Behagel, welcher die stetige Veränderung der Sprache als signifikant erachtet, „denn Stillstand bedeute Tod“ (Z. 29f.). Eben diese Meinung würden laut Guratzsch auch das Institut für Deutsche Sprache vertreten, jedoch macht der Autor darauf aufmerksam, „dass auch auf diesem Forum von etwas ganz anderem als in der deutschen Öffentlichkeit die Rede war“ (Z.31f.). Die Begebenheit, dass „nur wer ganz genau hin hörte“ (ebd.) dies verstehen bzw. wahrnehmen konnte zeigt, wie tückisch diese Institute vorgehen. Des Weiteren vergleicht Dankwart Guratzsch die Situation des Sprachverfalls für einen Sprachwissenschaftler mit der eines Normalbürgers. Für den Sprachwissenschaftler sei eben diese Veränderung der Sprache das Fesselnde und Bereichernde, da er sich in seinem Beruf mit der Sprache selbst, ihren Strukturen, Formen und Funktionen befasst, feste Regeln für ihn jedoch nicht von Bedeutung sind. Für den Normalbürger bedeute dies jedoch, dass er eben diese Regeln der Sprache verliere was durch die Alliteration „Fülle, Farbigkeit, Feinheit im Ausdruck“ (Z.36) deutlich wird. Die Gegebenheit, dass der Autor hier hauptsächlich affirmative Nomen für die Beschreibung verwendet, verdeutlicht seine hohe Überzeugung der deutschen Sprache und die daraus resultierende Forderung, dass eben diese erhalten bleiben müsse, denn für den Normalbürger sei „sein Leiden am Sprachwandel […] ein Leiden am Verlust“ (Z. 36f.), wodurch untermauert wird, dass sich der Sprachverfall nachteilig auf das Leben der einzelnen Einwohner auswirken würde. Als mögliche Konsequenzen formuliert er die Fragen „Werden Jugendliche in fünfzig Jahren überhaupt noch Goethe […] im Original lesen können? Oder sind ihnen bis dahin viele Vokabeln des Deutschen abhanden gekommen?“ (Z.38f.). Guratzsch merkt jedoch an, dass eben diese Kernfragen keine Bedeutung bei der Jahrestagung erlangt haben, wodurch ebenfalls untermauert wird, dass die Sprachinstitutionen nicht auf mögliche Konsequenzen für die Normalbürger achten und hauptsächlich auf ihren eigenen Profit fokussiert sind. | In seinem zweiten Abschnitt „Sprachwandel bedingt auch Verlust“ geht Guratzsch konkret auf die Konsequenzen für den einzelnen Normalbürger ein. Er berichtet unter anderem darüber, dass das Institut für Deutsche Sprache (IDS) auch noch seine Jahrestagung in Mannheim dem Thema widmete“ (Z.24f.), wodurch in gewisser Weise ein Ende des Sprachverfalls hervorgerufen wurde, was durch die metaphorische Aussage „wurde das Halali geblasen“ (ebd.) untermauert wird. Des Weiteren zitiert Guratzsch den Sprachwissenschaftler Otto Behagel, welcher die stetige Veränderung der Sprache als signifikant erachtet, „denn Stillstand bedeute Tod“ (Z. 29f.). Eben diese Meinung würden laut Guratzsch auch das Institut für Deutsche Sprache vertreten, jedoch macht der Autor darauf aufmerksam, „dass auch auf diesem Forum von etwas ganz anderem als in der deutschen Öffentlichkeit die Rede war“ (Z.31f.). Die Begebenheit, dass „nur wer ganz genau hin hörte“ (ebd.) dies verstehen bzw. wahrnehmen konnte zeigt, wie tückisch diese Institute vorgehen. Des Weiteren vergleicht Dankwart Guratzsch die Situation des Sprachverfalls für einen Sprachwissenschaftler mit der eines Normalbürgers. Für den Sprachwissenschaftler sei eben diese Veränderung der Sprache das Fesselnde und Bereichernde, da er sich in seinem Beruf mit der Sprache selbst, ihren Strukturen, Formen und Funktionen befasst, feste Regeln für ihn jedoch nicht von Bedeutung sind. Für den Normalbürger bedeute dies jedoch, dass er eben diese Regeln der Sprache verliere was durch die Alliteration „Fülle, Farbigkeit, Feinheit im Ausdruck“ (Z.36) deutlich wird. Die Gegebenheit, dass der Autor hier hauptsächlich affirmative Nomen für die Beschreibung verwendet, verdeutlicht seine hohe Überzeugung der deutschen Sprache und die daraus resultierende Forderung, dass eben diese erhalten bleiben müsse, denn für den Normalbürger sei „sein Leiden am Sprachwandel […] ein Leiden am Verlust“ (Z. 36f.), wodurch untermauert wird, dass sich der Sprachverfall nachteilig auf das Leben der einzelnen Einwohner auswirken würde. Als mögliche Konsequenzen formuliert er die Fragen „Werden Jugendliche in fünfzig Jahren überhaupt noch Goethe […] im Original lesen können? Oder sind ihnen bis dahin viele Vokabeln des Deutschen abhanden gekommen?“ (Z.38f.). Guratzsch merkt jedoch an, dass eben diese Kernfragen keine Bedeutung bei der Jahrestagung erlangt haben, wodurch ebenfalls untermauert wird, dass die Sprachinstitutionen nicht auf mögliche Konsequenzen für die Normalbürger achten und hauptsächlich auf ihren eigenen Profit fokussiert sind. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Alina == | ||
| + | |||
| + | Der Sachtext „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“, verfasst von Dankwart Guratzsch und veröffentlicht auf der Website www.welt.de der Tageszeitung Welt und 2013 veröffentlicht thematisiert den Verlust von deutscher Sprache. | ||
| + | |||
| + | Zu Beginn des Sachtextes leitet der Autor den Sachtext mit sechs Fragen ein, um den Leser auf das Problem aufmerksam zu machen. Gibt es einen „Verfall“ der deutschen Sprache? Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Macht das schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus? Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber? Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen? (Z. 1-5). Mit seiner ersten Frage nimmt Guratzsch direkten Bezug auf das Thema des Textes und stellt somit die Frage an den Leser, ob die deutsche Sprache wirklich an Wert verliert und wenn ja, auf welche Art und Weise? Diese stellt der Autor mit den folgenden zwei parataktischen Fragen „Stirbt der Konjunktiv?“ (ebd.) Der Konjunktiv ist einer der drei wichtigsten Modi eines Verbs, zusammen mit dem Indikativ und Imperativ und wird als Möglichkeitsform bezeichnet. Stimmt es, dass dieser Modus ausstirbt?, fragt sich Guratzsch und versucht mit dieser Frage, den Leser ebenfalls zum Nachdenken anzuregen. Zudem stellt Guratzsch die Frage, ob „der Dativ dem Genitiv sein Tod?“ (ebd.) sei und fasst damit ein weiteres Problem in der deutschen Sprache auf. Im Bezug auf diese sprachlichen Probleme folgt die weitere Frage, in der der Autor die deutsche Sprache als „schludrige[s] Denglisch“ (ebd.) bezeichnet. Mit dem Neologismus „Denglisch“ (ebd.) wird die deutsche Sprache negativ kritisiert, da eine Zusammensetzung zwischen den Sprachen Englisch und Deutsch verwendet wird. Dies weißt darauf hin, dass unsere deutsche Sprache von der englischen Sprache geprägt ist und somit eine Mischung aus englischen und deutschen Wörtern entsteht. Des weiteren nimmt der Autor Bezug auf die deutsche Sprache, indem er sagt, dass aus dem „schludrigen Deutsch“ (ebd.) „dem reinen deutschen Idiom den Garaus“ (Z. 3) gemacht wird. Damit wird die Sprache ebenfalls negativ kritisiert, indem die Verwendung der Substantivs „Garaus“ (ebd.) darauf hinweist, dass die ‘denglische‘ Sprache der deutschen Sprache überhand und die Kontrolle übernimmt, sodass die reine deutsche Sprache vernachlässigt wird. Zudem bezeichnet der Autor die deutsche Sprache als „schauderhaft“ (Z. 3) und „Toten[grab]“ (Z. 4), was ebenfalls eine negative und angegriffene Stimmung auf den Leser erzeugt, sodass die Möglichkeit, sich Gedanken über den Sprachverfall der deutschen Sprache zu verschaffen, nicht zu verhindern ist. Zuletzt stellt Guratzsch die Frage, wo diejenigen sind, die sich darum kümmern, die ‘alte‘ deutsche Sprache wieder zurück zu holen, indem sie sich mit denjenigen befassen, die die deutsche Sprache verändert haben (vgl. Z. 4f.). Diese Menschen bezeichnet der Autor als „Sprachverderber“ (Z. 5). Dieser Neologismus spielgelt seine Meinung konkret wider. Um auf diese Fragen eine Antwort zu erhalten, benennt er drei Institute „für Deutsche Sprache“ (Z. 6), die sich jedoch nicht mit dem Sprachverfall beschäftigen. Diese sind zum einen „Mannheim“ (Z. 6); „Wiesbaden“ (Z. 7) und „Darmstadt“ (Z. 8), welche eine Akademie für Sprache und Dichtung ist. Diese drei Institute werden als „dreigetelte[s] Olymp der deutschen Sprachwissenschaft“ (Z. 9) bezeichnet. Allein diese Bezeichnung verweist auf sehr gute und bekannte Institute hin. Die Aussage „ein Hochsitz ohne Götter“ (Z. 10) untermauert den sehenswerten Status der Institute, wohingegen der Verweis auf „ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“ (ebd.) aussagt, dass die Institute trotz des hohen Ranges dem hiergenannten „Olymp“ in Athen nicht gleichgestellt werden können und somit nur im ersten Augenblick von Relevanz sind. Denn um sich gegen den Sprachverfall wehren zu können, benötige man laut Guratzsch „Schwerter und Kanonen“ (ebd.), die sie jedoch nicht besitzen. Somit fehlt den Sprachwissenschaftlern das nötige Etwas, um den Menschen deutlich zu machen, wie sich unsere Sprache verschlechtert hat. Im „Rhein-Neckar-dreieck“ (Z. 9f.) wird jedoch „nur angesessen und Buch geführt“ (Z. 11). Dies bedeutet so viel wie, dass sie sich nicht auf das Wesentliche und Wichtige konzentrieren, sondern immer das gleiche machen und keinen Veränderungen auf den Grund gehen. Guratzsch verdeutlicht somit nochmal den Status der Institute. Daraufhin stellt Guratzsch fest, dass „jedes Rascheln im Gesträusch […] den Lauernden wie Musik in den Ohren [klingt]“ (Z. 11f.). Der Autor verwendet Synonyme aus dem Wortfeld der Jagd und verdeutlicht mit „jede[m] Rascheln“ (ebd.), jede kleinste Veränderung, die die Institute verbessern und „den Lauernden wie Musik in den Ohren [klingt]“, bedeutet soviel wie, dass sich die Menschen, die auf Verbesserung der neuen Sprache hoffen, mit jeder kleinsten Verbesserung zufrieden sind, welche metaphorisch als „Musik in den Ohren“ (ebd.) dargestellt wird. | ||
| + | |||
| + | Des weiteren stellt der Autor sich die Frage „was bei solcher Pirsch herauskommt, das hat der mit großer Spannung erwartete, vor drei Wochen publizierte „Bericht zur Lage der deutschen Sprache“ erwiesen“ (Z. 13f.). Wieder verwendet der Autor ein Wort aus dem Wortfeld der Jagd, indem er „Pirsch“ (ebd.) als eine Jagdart, für den Prozess der Verbesserung der deutschen Sprache verwendet. Mit der Nutzung der Wörter des Wortfeldes Jagd, versucht der Autor die Leser auf die Problematik hinzuweisen, denn aus seiner Sicht, ist der Sprachverlust ein großes Problem. Mit seinem Text versucht er gegen den Sachverhalt anzukämpfen. | ||
| + | |||
| + | Die Ergebnisse die des Berichtes, welches hier als „Dickicht des Gegenwartdeutschs“ (Z. 15) benannt werden, ergaben, dass diese „nur so von Leben [strotzten]“ (Z. 16). Als „Dickicht des Gegenwartdeutschs“ (ebd.) ist die Vermehrung der verflachten deutschen Sprache gemeint, die heute immer mehr verwendet wird und somit als Neologismus „Gegenwartsdeutsch“ (ebd.), zu bezeichnen ist. Allein die Verwendung von Neologismen, deutet auf die Veränderung der deutschen Sprache hin, da jeder weiß, was mit diesen Ausdrücken gemeint ist. Das Verb „strotzen“ (ebd.) setzt nur nochmal den Fokus auf den immer weiter schreitenden Prozess der Verflachung unserer Sprache und das dieser Prozess kein Ende nehmen wird. Somit wird laut Guratzsch behauptet „Der deutsche Wortschatz sei heute reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 16f.). Damit stellt er Goethe, als einer der berühmtesten deutschen Literaten in den Schatten und bezeichnet die heutige Sprache als „reich“ (Z. 17) und somit als wertvoller und kostbarer. Jedoch trügt die Verwendung des Konjunktivs, die in der Behauptung mit „sei“ (ebd.) zu erkennen ist. Somit ist die Behauptung nicht klar zu bestätigen, sondern ist nur eine mögliche Überlegung wahzunehmen. Zudem behauptet Guratzsch „die Grammatik werde immer einfacher, die Anglizismen ließen sich verschmerzen und selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“ (Z. 17ff.). Damit erläutert der Autor die relevantesten Probleme, die sich in der deutschen Sprache erkennen lassen, jedoch seien diese Aussagen nicht eindeutig erkennbar, was an der wiederholten Verwendung des Konjunktivs „werde“ (Z. 17), zu erkennen ist. Der Autor ist der Meinung, dass „Anglizismen sich verschmerzen“ (ebd.) ließen, was darauf hin deutet, dass die englische Sprache immer mehr an Bedeutung in der deutschen Sprache gewinnt und somit keine Chance mehr besteht, die englische Sprache aus unserem Wortschatz zu entfernen. Zudem betitelt er die kleinen Wörter wie „ehm, nh etc.“ als „hässliche Strecksatzgefüge“ (Z. 19f.), da diese unsere Sprache zum verflachen bringen uns somit an Wert verliert, jedoch von den Menschen schon akzeptiert werden „sogar als sinnvoll erwiesen“ (ebd.) werden. „Mit anderen Worten“ (Z. 20) behauptet Guratzsch „Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z. 20f.). Damit verdeutlicht er ausschließlich, dass das Suchen, die Kraft sich gegen den Verfall der deutschen Sprache zu wehren, nicht mehr sinnvoll ist, da die Verwendung von englischer Sprache, Anglizismen, Strecksatzgefügen etc. schon so alltäglich im Gebrauch sind, sodass es nur sehr schwer ist diese wieder aus der Sprache zu entfernen. | ||
Version vom 11. März 2019, 18:41 Uhr
Analyse des Sachtextes von Dankwart Guratzsch: Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht
Carina
Der hier vorliegende Sachtext “Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht” wurde von Dankwart Guratzsch verfasst und 2013 auf der Internetseite “www.welt.de” veröffentlicht. Thematisch befasst sich der Text mit der Veränderung der deutschen Sprache und den daraus resultierenden Konsequenzen.
Schon bereits die Überschrift “Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht” leitet die Thematik des Textes ein. Der Autor ist der Auffassung, dass die deutsche Sprache mit der Zeit zunichte gehe. Um diese Problemstellung zu fokussieren, formuliert Guratzsch in seiner Einleitung in den Bericht, die sich durch den Artikel ziehende Leitfrage “Gibt es einen “Verfall” der deutschen Sprache? “ (Z. 1), welche den roten Faden des Textes darstellt. Um weiter auf seine Fragestellung einzugehen, definiert der Autor weitere Konsequenzen, die aus dem Sprachverfall resultieren (vgl. Z. 1ff.). Exemplarisch formuliert er die Frage “ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber? “ (Z. 3f.). Durch das Adjektiv “schauderhaft” (ebd.) lässt sich eine erstmalige Wertung des Autors erkennen, wodurch deutlich wird, dass er den Sprachverfall der deutschen Sprache als Problem betrachtet. Aufgrund dieser Problematik empfindet Guratzsch es als notwendig, dass man gegen dieses Phänomen vorgeht, was unter anderem durch die rhetorische Frage “Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen? “ (Z. 4f.) untermauert wird. Die Tatsache, dass er diese Frage auf drei unterschiedlichen Sprachinstitute bezieht, welche nicht gegen den Verfall vorgehen, untermauert, dass der Autor ihnen vorwirft, dass diese den Sprachverfall nicht aufhalten wollen (vgl. Z. 6ff.). Eben diese Ignoranz wird durch die dreifache Repetitio des Partikels “nicht” (ebd.) untermauert sowie durch den metaphorischen Vergleich “ist ein Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen” (Z. 10). Dieser unterstreicht nochmals den Vorwurf von Guratzsch, dass niemand gegen den Sprachverfall vorgeht und ihn nicht versucht aufzuhalten, da “hier (..) nur angesessen und Buch geführt (wird) “ (Z. 11). Besonders durch das Adverb “nur” (ebd.) wird eine gewisse Bequemlichkeit der Institute hervorgehoben, wodurch die Kritik des Autors an diesen nochmals untermauert wird. Weiterhin ist er der kritischen Auffassung, dass “jedes Rascheln im Gesträuch (..) den Lauernden wie Musik in den Ohren (klingt) “ (Z. 11f.). Die “Lauernden” (ebd.) stellen hierbei die einzelnen Institutionen dar, welche die einzelnen Veränderungen der Sprache als affirmativ gar bereichernd ansehen, wodurch deutlich wird, dass Guratzsch meint, dass diese die Konsequenzen des Verfalls nicht erkennen. Um mögliche Veränderungen in den Fokus zu rücken, bezieht er sich auf den “Bericht zur Lage der deutschen Sprache” (Z. 14f.). In diesem würden die Autoren begeisternd davon ausgehen, dass „das Dickicht des Gegenwartsdeutschs […] nur so von Leben [strotze]“ (Z.15f.). Des Weiteren sind diese Autoren der Meinung, dass die heutige Sprache komplexer als die zu Goethes Zeiten sei (vgl. Z.16ff.). Dies würden die Autoren laut Guratzsch daran begründen, dass „die Grammatik immer einfacher [werde] […] und selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“ (ebd.). Durch das Adjektiv „hässlich“ (ebd.) wird nochmals die Auffassung Guratzsch deutlich, da er zunehmend ironisch über den genannten Bericht spricht und gegensätzlicher Meinung, zu der der Autoren ist. Eben diese Ironie setzt sich auch in dem Fazit „Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z.20f.) fort, da es laut ihm von hoher Signifikanz ist, dass der Verlust der deutschen Sprache aufgehalten wird, wodurch ebenfalls sein Vorwurf gegenüber den Institutionen für deutsche Sprache, dass sie den Verfall ignorieren würden und ihn nicht aufhalten wollen, nochmals verstärkt wird.
In seinem zweiten Abschnitt „Sprachwandel bedingt auch Verlust“ geht Guratzsch konkret auf die Konsequenzen für den einzelnen Normalbürger ein. Er berichtet unter anderem darüber, dass das Institut für Deutsche Sprache (IDS) auch noch seine Jahrestagung in Mannheim dem Thema widmete“ (Z.24f.), wodurch in gewisser Weise ein Ende des Sprachverfalls hervorgerufen wurde, was durch die metaphorische Aussage „wurde das Halali geblasen“ (ebd.) untermauert wird. Des Weiteren zitiert Guratzsch den Sprachwissenschaftler Otto Behagel, welcher die stetige Veränderung der Sprache als signifikant erachtet, „denn Stillstand bedeute Tod“ (Z. 29f.). Eben diese Meinung würden laut Guratzsch auch das Institut für Deutsche Sprache vertreten, jedoch macht der Autor darauf aufmerksam, „dass auch auf diesem Forum von etwas ganz anderem als in der deutschen Öffentlichkeit die Rede war“ (Z.31f.). Die Begebenheit, dass „nur wer ganz genau hin hörte“ (ebd.) dies verstehen bzw. wahrnehmen konnte zeigt, wie tückisch diese Institute vorgehen. Des Weiteren vergleicht Dankwart Guratzsch die Situation des Sprachverfalls für einen Sprachwissenschaftler mit der eines Normalbürgers. Für den Sprachwissenschaftler sei eben diese Veränderung der Sprache das Fesselnde und Bereichernde, da er sich in seinem Beruf mit der Sprache selbst, ihren Strukturen, Formen und Funktionen befasst, feste Regeln für ihn jedoch nicht von Bedeutung sind. Für den Normalbürger bedeute dies jedoch, dass er eben diese Regeln der Sprache verliere was durch die Alliteration „Fülle, Farbigkeit, Feinheit im Ausdruck“ (Z.36) deutlich wird. Die Gegebenheit, dass der Autor hier hauptsächlich affirmative Nomen für die Beschreibung verwendet, verdeutlicht seine hohe Überzeugung der deutschen Sprache und die daraus resultierende Forderung, dass eben diese erhalten bleiben müsse, denn für den Normalbürger sei „sein Leiden am Sprachwandel […] ein Leiden am Verlust“ (Z. 36f.), wodurch untermauert wird, dass sich der Sprachverfall nachteilig auf das Leben der einzelnen Einwohner auswirken würde. Als mögliche Konsequenzen formuliert er die Fragen „Werden Jugendliche in fünfzig Jahren überhaupt noch Goethe […] im Original lesen können? Oder sind ihnen bis dahin viele Vokabeln des Deutschen abhanden gekommen?“ (Z.38f.). Guratzsch merkt jedoch an, dass eben diese Kernfragen keine Bedeutung bei der Jahrestagung erlangt haben, wodurch ebenfalls untermauert wird, dass die Sprachinstitutionen nicht auf mögliche Konsequenzen für die Normalbürger achten und hauptsächlich auf ihren eigenen Profit fokussiert sind.
Alina
Der Sachtext „Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht“, verfasst von Dankwart Guratzsch und veröffentlicht auf der Website www.welt.de der Tageszeitung Welt und 2013 veröffentlicht thematisiert den Verlust von deutscher Sprache.
Zu Beginn des Sachtextes leitet der Autor den Sachtext mit sechs Fragen ein, um den Leser auf das Problem aufmerksam zu machen. Gibt es einen „Verfall“ der deutschen Sprache? Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Macht das schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus? Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber? Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen? (Z. 1-5). Mit seiner ersten Frage nimmt Guratzsch direkten Bezug auf das Thema des Textes und stellt somit die Frage an den Leser, ob die deutsche Sprache wirklich an Wert verliert und wenn ja, auf welche Art und Weise? Diese stellt der Autor mit den folgenden zwei parataktischen Fragen „Stirbt der Konjunktiv?“ (ebd.) Der Konjunktiv ist einer der drei wichtigsten Modi eines Verbs, zusammen mit dem Indikativ und Imperativ und wird als Möglichkeitsform bezeichnet. Stimmt es, dass dieser Modus ausstirbt?, fragt sich Guratzsch und versucht mit dieser Frage, den Leser ebenfalls zum Nachdenken anzuregen. Zudem stellt Guratzsch die Frage, ob „der Dativ dem Genitiv sein Tod?“ (ebd.) sei und fasst damit ein weiteres Problem in der deutschen Sprache auf. Im Bezug auf diese sprachlichen Probleme folgt die weitere Frage, in der der Autor die deutsche Sprache als „schludrige[s] Denglisch“ (ebd.) bezeichnet. Mit dem Neologismus „Denglisch“ (ebd.) wird die deutsche Sprache negativ kritisiert, da eine Zusammensetzung zwischen den Sprachen Englisch und Deutsch verwendet wird. Dies weißt darauf hin, dass unsere deutsche Sprache von der englischen Sprache geprägt ist und somit eine Mischung aus englischen und deutschen Wörtern entsteht. Des weiteren nimmt der Autor Bezug auf die deutsche Sprache, indem er sagt, dass aus dem „schludrigen Deutsch“ (ebd.) „dem reinen deutschen Idiom den Garaus“ (Z. 3) gemacht wird. Damit wird die Sprache ebenfalls negativ kritisiert, indem die Verwendung der Substantivs „Garaus“ (ebd.) darauf hinweist, dass die ‘denglische‘ Sprache der deutschen Sprache überhand und die Kontrolle übernimmt, sodass die reine deutsche Sprache vernachlässigt wird. Zudem bezeichnet der Autor die deutsche Sprache als „schauderhaft“ (Z. 3) und „Toten[grab]“ (Z. 4), was ebenfalls eine negative und angegriffene Stimmung auf den Leser erzeugt, sodass die Möglichkeit, sich Gedanken über den Sprachverfall der deutschen Sprache zu verschaffen, nicht zu verhindern ist. Zuletzt stellt Guratzsch die Frage, wo diejenigen sind, die sich darum kümmern, die ‘alte‘ deutsche Sprache wieder zurück zu holen, indem sie sich mit denjenigen befassen, die die deutsche Sprache verändert haben (vgl. Z. 4f.). Diese Menschen bezeichnet der Autor als „Sprachverderber“ (Z. 5). Dieser Neologismus spielgelt seine Meinung konkret wider. Um auf diese Fragen eine Antwort zu erhalten, benennt er drei Institute „für Deutsche Sprache“ (Z. 6), die sich jedoch nicht mit dem Sprachverfall beschäftigen. Diese sind zum einen „Mannheim“ (Z. 6); „Wiesbaden“ (Z. 7) und „Darmstadt“ (Z. 8), welche eine Akademie für Sprache und Dichtung ist. Diese drei Institute werden als „dreigetelte[s] Olymp der deutschen Sprachwissenschaft“ (Z. 9) bezeichnet. Allein diese Bezeichnung verweist auf sehr gute und bekannte Institute hin. Die Aussage „ein Hochsitz ohne Götter“ (Z. 10) untermauert den sehenswerten Status der Institute, wohingegen der Verweis auf „ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen“ (ebd.) aussagt, dass die Institute trotz des hohen Ranges dem hiergenannten „Olymp“ in Athen nicht gleichgestellt werden können und somit nur im ersten Augenblick von Relevanz sind. Denn um sich gegen den Sprachverfall wehren zu können, benötige man laut Guratzsch „Schwerter und Kanonen“ (ebd.), die sie jedoch nicht besitzen. Somit fehlt den Sprachwissenschaftlern das nötige Etwas, um den Menschen deutlich zu machen, wie sich unsere Sprache verschlechtert hat. Im „Rhein-Neckar-dreieck“ (Z. 9f.) wird jedoch „nur angesessen und Buch geführt“ (Z. 11). Dies bedeutet so viel wie, dass sie sich nicht auf das Wesentliche und Wichtige konzentrieren, sondern immer das gleiche machen und keinen Veränderungen auf den Grund gehen. Guratzsch verdeutlicht somit nochmal den Status der Institute. Daraufhin stellt Guratzsch fest, dass „jedes Rascheln im Gesträusch […] den Lauernden wie Musik in den Ohren [klingt]“ (Z. 11f.). Der Autor verwendet Synonyme aus dem Wortfeld der Jagd und verdeutlicht mit „jede[m] Rascheln“ (ebd.), jede kleinste Veränderung, die die Institute verbessern und „den Lauernden wie Musik in den Ohren [klingt]“, bedeutet soviel wie, dass sich die Menschen, die auf Verbesserung der neuen Sprache hoffen, mit jeder kleinsten Verbesserung zufrieden sind, welche metaphorisch als „Musik in den Ohren“ (ebd.) dargestellt wird.
Des weiteren stellt der Autor sich die Frage „was bei solcher Pirsch herauskommt, das hat der mit großer Spannung erwartete, vor drei Wochen publizierte „Bericht zur Lage der deutschen Sprache“ erwiesen“ (Z. 13f.). Wieder verwendet der Autor ein Wort aus dem Wortfeld der Jagd, indem er „Pirsch“ (ebd.) als eine Jagdart, für den Prozess der Verbesserung der deutschen Sprache verwendet. Mit der Nutzung der Wörter des Wortfeldes Jagd, versucht der Autor die Leser auf die Problematik hinzuweisen, denn aus seiner Sicht, ist der Sprachverlust ein großes Problem. Mit seinem Text versucht er gegen den Sachverhalt anzukämpfen.
Die Ergebnisse die des Berichtes, welches hier als „Dickicht des Gegenwartdeutschs“ (Z. 15) benannt werden, ergaben, dass diese „nur so von Leben [strotzten]“ (Z. 16). Als „Dickicht des Gegenwartdeutschs“ (ebd.) ist die Vermehrung der verflachten deutschen Sprache gemeint, die heute immer mehr verwendet wird und somit als Neologismus „Gegenwartsdeutsch“ (ebd.), zu bezeichnen ist. Allein die Verwendung von Neologismen, deutet auf die Veränderung der deutschen Sprache hin, da jeder weiß, was mit diesen Ausdrücken gemeint ist. Das Verb „strotzen“ (ebd.) setzt nur nochmal den Fokus auf den immer weiter schreitenden Prozess der Verflachung unserer Sprache und das dieser Prozess kein Ende nehmen wird. Somit wird laut Guratzsch behauptet „Der deutsche Wortschatz sei heute reicher als zu Goethes Zeiten“ (Z. 16f.). Damit stellt er Goethe, als einer der berühmtesten deutschen Literaten in den Schatten und bezeichnet die heutige Sprache als „reich“ (Z. 17) und somit als wertvoller und kostbarer. Jedoch trügt die Verwendung des Konjunktivs, die in der Behauptung mit „sei“ (ebd.) zu erkennen ist. Somit ist die Behauptung nicht klar zu bestätigen, sondern ist nur eine mögliche Überlegung wahzunehmen. Zudem behauptet Guratzsch „die Grammatik werde immer einfacher, die Anglizismen ließen sich verschmerzen und selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten sich manchmal sogar als sinnvoll erweisen“ (Z. 17ff.). Damit erläutert der Autor die relevantesten Probleme, die sich in der deutschen Sprache erkennen lassen, jedoch seien diese Aussagen nicht eindeutig erkennbar, was an der wiederholten Verwendung des Konjunktivs „werde“ (Z. 17), zu erkennen ist. Der Autor ist der Meinung, dass „Anglizismen sich verschmerzen“ (ebd.) ließen, was darauf hin deutet, dass die englische Sprache immer mehr an Bedeutung in der deutschen Sprache gewinnt und somit keine Chance mehr besteht, die englische Sprache aus unserem Wortschatz zu entfernen. Zudem betitelt er die kleinen Wörter wie „ehm, nh etc.“ als „hässliche Strecksatzgefüge“ (Z. 19f.), da diese unsere Sprache zum verflachen bringen uns somit an Wert verliert, jedoch von den Menschen schon akzeptiert werden „sogar als sinnvoll erwiesen“ (ebd.) werden. „Mit anderen Worten“ (Z. 20) behauptet Guratzsch „Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden“ (Z. 20f.). Damit verdeutlicht er ausschließlich, dass das Suchen, die Kraft sich gegen den Verfall der deutschen Sprache zu wehren, nicht mehr sinnvoll ist, da die Verwendung von englischer Sprache, Anglizismen, Strecksatzgefügen etc. schon so alltäglich im Gebrauch sind, sodass es nur sehr schwer ist diese wieder aus der Sprache zu entfernen.