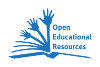Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Gryphius
Es ist alles Eitel
Analyse eines Gedichtes
Vorbereitung: mehrmaliges Lesen und Bearbeiten des Textes (Wichtiges markieren, notieren, gliedern, usw.)
1. Einleitung
• Themasatz: Textart (Natur-, Liebes-, politisches Gedicht, usw.), Titel, Dichter, ev. Entstehungszeit, Epoche; Thema
2. Hauptteil
Inhaltliche, formale und sprachliche Analyse • Gliederung in Sinnabschnitte, deren Funktionen • Darstellung und Deutung exemplarischer Textstellen inhaltlich (Was wird aus-gesagt und was bedeutet das?), sprachlich (Wie wird es ausgesagt und was bedeutet das? - sprachliche Mittel) und formal (Strophen, Reimschema, Metrum, Interpunktion, Enjambement, Wortwahl, usw.) • Wechselbeziehungen zwischen Inhalt, Sprache und Form • eventuell Berücksichtigung des gesellschaftlich-historischen, biografischen, usw. Kontextes, der Position und Perspektive des lyrischen Ich • korrekte Zitierweise • Textintentionen
3. Schluss
• Zusammenfassung der wesentlichen Analyseergebnisse
Inhaltsverzeichnis |
Anne
Das Sonett "Es ist alles eitel" geschrieben von Andreas Gryphius und veröffentlicht 1637 zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, thematisiert die Vergänglichkeit alles Irdischen.
Das Gedicht besteht aus vier Strophen, wobei die ersten zwei Strophen vier Verse enthalten und die letzten zwei drei Verse. Die ersten beiden Strophen sind als umarmender Reim aufgebaut und die letzten Beiden beginnen jeweils als Paarreim, wobei der dritte Vers eine Verbindung zur jeweils anderen Strophe schafft. Außerdem enthält das Gedicht einen sechshebigen Jambus.
Das Sonett beginnt im ersten Vers mit einer Art Einleitung, indem das Thema der Vergänglichkeit, hier "Eitelkeit"(V.1) genannt, direkt angesprochen wird und ein Bezug zur Überschrift geschaffen wird. Mit der Repetitio des Wortes "sihst"(V.1) verdeutlicht das lyrische Ich, dass man, egal wohin man sieht, nichts ewiges finden kann. Man findet lediglich "Eitelkeit auf Erden"(V.1). Die Verwendung des Substantivs "Erden"(ebd.) spezifiziert den Raum in dem man nur Vergängliches sieht. Durch diese Spezifizierung macht das lyrische Ich erkennbar, dass es sich nur um Irdisches Handelt. Er impliziert so direkt zu Beginn des Gedichts, dass sich Ewiges im Übernatürlichen bzw. Göttlichen finden lässt. Im Folgenden ist das Gedicht sehr von Antithesen geprägt. In Vers zwei stehen die beiden Verben "reist"(V.2) und "baut"(V.2) direkt hintereinander und sind lediglich von einem Spiegelstrich getrennt. Durch diesen Chiasmus wird die Differenz zwischen dem "heute"(V.2) und "morgen"(V.2) untermauert und somit des lyrischen Ich's These, die Erde sei vergänglich, unterstützt. Auch Vers 3, der als Anapher eine Verbindung zu Vers 2 schafft, da sie beide Beispiele für Vergänglichkeit liefern, besteht aus einer Antithese. hier wird aufgezeigt, dass aus "Städten"(V.3), die heute existieren in Zukunft "Wiesen"(V.3) werden können. Das Wort "itzund"(V.3) begegnet einem folgend häufiger und beschreibt immer den Gegenwartszustand. Durch den vierten Vers wird noch einmal der Unterschied zwischen verschieden Zeiten hervorgebracht, indem "ein Schäferskind"(V.4), das "mit den Herden"(V.4) spielt, den "Städten"(ebd.) gegenübergestellt wird.
In dem ersten Vers der zweiten Strophe wird die Vergänglichkeit der Pflanzen angesprochen. Diese blühen noch in der Gegenwart, was wieder von "itzund"(V.5) signalisiert wird. Dass diese zertreten werden "sol[len]"(V.5) zeigt, dass diese in keinem Fall ewig bleiben. Im nächsten Vers wird die Vergänglichkeit des Menschen erläutert. Dies ist an der Metapher "pocht und trotzt"(V.6) erkennbar, da diese zum einen für das pochende Herz des Menschen steht, dem Menschen aber auch die Fähigkeit zuspricht zu trotzen, sodass die Annahme, ein Tier könnte gemeint sein, verworfen werden kann. Mit "Asch vnd Bein"(V.6) ist das, gemeint, was vom Körper nach dem Tod noch übrig bleibt gemeint. Das lyrische Ich kommt also zu dem Schluss dass der Mensch ebenso vergänglich ist wie alles andere und sich in der Hinsicht nicht von anderen Lebewesen oder Artefakten unterscheidet. Dass, "Nichts"(V.7) ewig ist, belegt er in Vers drei, indem er sagt das "kein Ertz / kein Marmorstein"(V.7), also nicht mal Gestein, von dem man eigentlich annehmen kann, dass es schwer kaputt geht, ewig sein kann. Das lyrische Ich geht in Strophe Zwei klimatisch vor indem er sich von den Pflanzen zum Menschen bis hin zum Gestein immer weiter steigert, und seine Vergänglichkeit erläutert. Er führt dabei, das wovon man eigentlich denkt es sei am standhaftesten, Gestein, als letztes an und das, wovon man denkt es am leichtesten zu entbehren, Pflanzen, an erster Stelle an. So zeigt er auf dass, zwischen den verschiedenen Beispielen kein Unterschied, bezogen auf die Vergänglichkeit, herrscht. Im letzten Vers bezieht sich das lyrische ich schlussendlich auf das "Glück"(V.8). Antithetisch dazu verfasst er, dass auf dieses "Beschwerden"(Z.8) folgen. Dies lässt ein recht negatives Menschen - und Weltbild erkennen, da das lyrische Ich annimmt, dass Glück nicht ewig ist und Trauer folgen muss. Auf der anderen Seite lässt sich sagen, dass dies eine recht realistische Einschätzung des Lebens ist, die einen auf Schwierigkeiten vorbereiten könnte. Durch die Metapher "donnern"(V.8) verstärkt das lyrische Ich die Extremität des Wandels von "Glück"(ebd.) zu "Beschwerden"(ebd.).
Die dritte Strophe und somit das erste Terzett beginnt mit der Anführung einer weiteren vergänglichen Sache: der "Ruhm"(V. 9). Dieser vergehe "wie ein Traum"(V.9). das lyrische Ich möchte, wie im Rest seines Textes, jedoch besonders an dieser Stelle, an die Menschen appellieren, sich mit den wichtigen Dingen zu beschäftigen."Ruhm"(ebd.), oder Ehre, ist etwas das der Mensch oft anstrebt, aus falschen Intentionen. Der Lyriker möchte den Menschen so davon abhalten. Im zweiten Vers stellt das lyrische ich eine rhetorische Frage, indem er das Leben metaphorisch als "Spiel der Zeit"(V.10) benennt. Durch die vorherige Erklärung einiger Beispiele, die vergänglich sind, lässt sich die Frage verneinen. Der Mensch kann also nicht ewig sein. Das Adjektiv "leicht"(Z.10), welches den Menschen beschreibt, lässt sich auf Vers sieben beziehen, in dem von Gestein, welches nicht ewig ist, die Rede ist. Also schlussfolgert das lyrische Ich, dass wenn nicht einmal Gestein ewig sein kann, auch der "leichte Mensch"(V.10) nicht ewig sein kann. Im letzten Vers zeigt das lyrische Ich die Irrelevanz des Vergänglichen auf. Die Interjektion "Ach!"(V.11) untermauert die Verachtung, die das lyrische Ich bei den zuvor genannten Beispielen empfindet. Die Sachen, die der Mensch als, metaphorisch gemeint, "köstlich"(V.11), also gut, betrachtet, sind nicht ewig und somit nicht der großen Aufmerksamkeit würdig. Der Appell, den das lyrische Ich versucht zu verdeutlichen, wird an dieser Stelle nochmal besonders deutlich.
Die letzte Strophe beginnt mit einer Aufzählung von Symbolen, die für die Vergänglichkeit stehen. Durch das Substantiv "Nichtigkeit"(V.12), wird nochmal die unwichtige Rolle des Vergänglichen untermauert. "Schatten"(V.12) ist ebenfalls nicht dauerhaft, sondern entsteht nur dann wenn es auch Sonnen gibt. Metaphorisch steht der "Schatten"(ebd.) auch für schlechte Zeiten, die ebenso nicht dauerhaft sind. "Staub vnd Wind"(V.12) sind beides vergängliche Zustände. Der Staub kann sehr schnell verfliegen und auch Wind kommt und geht. Um zu verdeutlichen, dass alles Irdische vergänglich ist und keine dieser Sachen eine besonders wichtig sind, da sie eine vergängliche Sache von vielen sind, verwendet das lyrische ich die Metapher einer "Wiesen - Blum / die man nicht wider fndt". Hier lässt sic auch ein Appell herausstellen, da das lyrische Ich den Menschen dazu aufruft, sich nicht zu sehr mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil man sie sowieso "nicht wider find't"(V.13). Im letzten Vers stellt das lyrische Ich heraus, dass "was ewig ist kein einig Mensch betrachten"(V.14) kann. Also hat der Mensch momentan gar nicht die Möglichkeit etwas ewiges zu sehen. Durch das temporale Adverb "Noch"(V.14) wird manifestiert, dass jetz zwar die Möglichkeiten ewiges zu sehen noch nicht gegeben sind, dies aber in Zukunft der Fall sein kann. Mit der Zukunft ist der Tod gemeint, in dem der Mensch, nach christlich- abendländischer Vorstellung, auf Gott trifft. Somit lässt sich sagen, das Gott oder das Göttliche, das einzige ist, was für das lyrische Ich ewig ist. Diese Vorstellung lässt sich auch mit dem ersten Vers verknüpfen, in dem nur von "Eitelkeit auf Erden"(ebd.) die Rede ist. Die Vorstellung von Gott als ewig unterstützt somit die Aussage, dass alles Irdische vergänglich ist.
Das vorliegende Sonett lässt sich außerdem mit seiner Epoche, der Barock, in der es geschrieben wurde verknüpfen. Zu dieser Zeit herrschte der 30. Jährige Krieg, was große Armut verursachte. Außerdem herrschte eine große Differenz zwischen Arm und Reich. Gryphius Gedicht, kann somit also als Stück verwendet werden, dass den Menschen Hoffnung macht. Dadurch, dass er sagt, dass niemand für immer in seinem jetzigen Zustand ist klingt er die Vorstellung einer gerechten Zukunft an. Zudem greift das Gedicht mit dem Thema der Vergänglichkeit und der Erinnerung daran, dass auch der Mensch vergänglich ist und sterben kann, einen der drei zentralen Leitgedanken des Barocks, den Memento Mori, auf.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das lyrische Ich mit dem Sonett, dem Menschen vor Augen führt, dass alles Irdische vergänglich ist. Das einzige, das ewig währt, sei das Göttliche. Sprachlich formal wird dies durch zahlreiche Antithesen und Metaphern unterstützt.
Carina
Das vorliegende Sonnet „Es ist alles Eitel“ wurde von Andreas Gryphius im Jahre 1637 zu Zeiten des Barocks verfasst. Thematisch befasst sich das Gedicht mit der Vergänglichkeit alles Irdischen.
Das Gedicht besteht aus 14 Versen, welche in vier Strophen aufgeteilt sind. Dabei beinhalten zwei Strophen vier Verse und die letzten beiden Strophen drei Verse. Der Aufbau weist daher auf ein typisches Sonnet hin, da es zwei Quartette sowie zwei Terzette enthält. Das Metrum ist ein sechshebiger Jambus. Die beiden ersten Strophen bestehen aus einem umarmenden Reim (abba, abba) während die beiden letzten einen Schweifreim (ccd,eed) bilden. Reimen sich Vers eins und vier ist deren Kadenz identisch (weiblich) sowie die zweiten und dritten Verse männlich, was die antithetische Struktur des Gedichtes hervorhebt.
Bereits die Überschrift „Es ist alles Eitel“ zeugt von der Verzweiflung des lyrischen Ichs, da nichts auf der Welt von ewigem Bestand ist. Dabei akzentuiert das unbestimmte Numeral „alles“ die prekäre Lage. Die erste Strophe knüpft an die Überschrift an, indem das lyrische Ich den Leser mit direkter Ansprache darauf aufmerksam macht, dass alles Irdische vergänglich ist (vgl. V.1). Das Adverb „nur“ (ebd.) verdeutlicht den hoffnungslosen und klagenden Grundton des lyrischen Ich aufgrund der Allgegenwärtigkeit der Vergänglichkeit. Diese resignative Stimmung lässt sich in Verbindung zu dem 30-jährigen Krieg setzen, welcher zu Zeiten des Gedichtes schon 25 Jahre herrschte und Deutschland komplett zerstört hat. Die darauffolgenden drei Verse beschäftigen sich konkret mit dem Verfall und Zerstörung der Städte. So heißt es „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V.2). Auffällig ist, dass die Gegenwart und Zukunft in antithetischer Verbindung stehen, wodurch untermauert wird, dass das Schöne nur kurzen Bestand hat beziehungsweise später keine Bedeutung mehr erlangt. Ebenso stehen die Verben „bauen“ (ebd.) und „einreißen“ (ebd.) gegensätzlich zueinander. Durch das demolieren der Städte wird konkret auf den Krieg angespielt, wodurch zum Ausdruck kommt, dass das lyrische Ich der Auffassung ist, dass die Menschen selbst für ihre Vergänglichkeit bzw. der ihrer Bauwerke verantwortlich sind. Des Weiteren verdeutlichen die Pronomen „dieser“ (ebd.) und „jener“ (ebd.) die Generalisierung der Ereignisse in Europa. Die Antithetik zwischen Gegenwart und Zukunft wird im dritten Vers fortgesetzt, indem es heißt „Wo itzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V.3), wodurch untermauert wird, dass die Natur ihren Platz zurückerobert. Auffällig ist hier, dass ein Rückschritt beschrieben wird. Die „Wiese“ (ebd.) steht dabei für die Natur und durch ihre grüne Farbe für Hoffnung und symbolisch für das Gedeihen neuen Lebens. Diese Idylle wird in dem darauffolgenden vierten Vers fortgesetzt, indem es heißt „Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden“ (V. 4), was den Wunsch nach Frieden verdeutlicht.
Die zweite Strophe wird von der Antithese „Was itz und prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V.5) eingeleitet. Dies hebt die Vergänglichkeit der Natur, mitsamt der blühenden Pflanzen hervor. So heißt es weiter „Was itzt so pocht und trotzt ist Morgen Asch und Bein“ (ebd.). Das „poch[en]“ (ebd.) steht hier metaphorisch für den Herzschlag eines Lebewesens. Die Anapher „Was itz“ (V.5+6) untermauert, dass die Natur und die Lebewesen eine gleiche Gewichtung in der Rolle ihrer Vergänglichkeit haben. Dies wird durch den darauffolgenden Vers unterstützt, in dem mit einer verdoppelten Verneinung nichts als ewig bestehend erklärt wird und soll Klarheit über die Vergänglichkeit alles Irdischen verschaffen (vgl. V. 7). Die Vergänglichkeit wird durch die Akkumulation „kein Erz, kein Mamorstein“ (ebd.) unterstützt, da diese zu Zeiten des 17. Jahrhunderts als unzerstörbar galten. Der letzte Vers der zweiten Strophe wird mit einer Personifikation des Glückes eingeleitet. Antithetisch wird dem Glück eine Synästhesie aus "donnernden Beschwerden" (V.8) gegenübergestellt. Dabei werden zwei unterschiedliche Sinneseindrücke (donnernd = hören, Beschwerden = fühlen) miteinander in Verbindung gesetzt, um das Leid zu verdeutlichen. Des Weiteren bekräftigt diese weitere Personifikation die Assoziation mit dem Krieg, da das Verb „donnern“ mit Waffen in Verbindung gebracht werden kann, welche ebenfalls zur Zerstörung beitragen.
Nach der Betrachtung der beiden ersten Strophen ist deren klimatischer Aufbau auffallend. In der ersten Strophe wird ausschließlich die Vergänglichkeit materieller Güter beschrieben, währenddessen die zweite Strophe die Nichtigkeit der Lebewesen darstellt.
Mit Beginn der dritten Strophe wird der sonnettypische, inhaltliche Bruch eingeleitet, da die ersten beiden Strophen eher aus einer beschreibenden Position stammen und in der dritten und vierten Strophe zu einem bewertenden Standpunkt wechseln, was durch das Fragezeichen in Vers 10 und dem Ausrufezeichen in Vers 13 akzentuiert wird. Inhaltlich befasst sich die erste Terzette mit der Frage was das Leben ist und wie die Menschheit es bewältigt. So heißt es in Vers neun „Der hohe Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn“ (V.9). Dies hebt hervor, dass selbst Reichtum und hochgeschätzte Werte der Vergänglichkeit unterliegen. So wird dem Leser in Vers 10 eine rhetorische Frage gestellt „Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?“ (V.10), um dem Leser zu verdeutlichen, dass ein Kampf gegen die Vergänglichkeit sinnlos erscheint. Der elfte Vers wird durch den Ausruf der Verzweiflung „Ach!“ (V.11) eingeleitet wodurch deutlich wird, dass das lyrische Ich über die Erkenntnis der Vergänglichkeit verzweifelt ist, da der Mensch keine Gewalt über das Leben hat. Auffällig ist hier, dass die dritte Strophe mit der vierten durch ein Enjambement verbunden ist, da die letzte Strophe konkrete Antworten auf die Frage des Lebens gibt.
So wird das Leben akkumulierend „Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind“ (V.12) definiert. Dabei stehen „Schatten, Staub und Wind (ebd.) für kurzlebige Synonyme, welche die Vergänglichkeit des Lebens akzentuieren. Ein weiterer Vergleich stellt Vers 13 dar, in welchem es heißt „Als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfind´t“(V.13). Dabei steht die „Wiesenblum“ (ebd.) metaphorisch für das Leben eines einzelnen Menschen, da auf einer Wiese eine einzelne Blume so unbedeutsam wie das Leben eines Menschen und dessen Vergänglichkeit ist. Der letzte Vers des Sonnets „Noch will was ewig ist kein einig Mensch betrachten!“ (V.14) stellt das Fazit des lyrischen Ichs dar. Dieses ist der Auffassung, dass noch kein Mensch betrachtet hat was für die Ewigkeit besteht. Das Adverb „noch“ (ebd.) gibt jedoch Hoffnung, dass sich in der Zukunft noch ändern und sich der Mensch dem Ewigen zuwenden könnte. Das sogenannte Ewige ist der Glaube an Gott, welchen die Menschen in der Zeit des Barocks durch den 30-jährigen Krieg verloren haben.
Auf der Basis der hier vorliegenden Analyse lässt sich sagen, dass der Text den Leser dazu bringen soll sich auf das Wesentliche, das Leben nach dem Tod, zu konzentrieren. Die Auffassung des lyrischen Ich, dass alles Irdische Vergänglich ist, wird durch zahlreiche Antithesen, Metaphern und Personifikationen geschmückt.
Lorena
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Es ist alles eitel“, verfasst von Andreas Gryphius und veröffentlicht im Jahr 1637, handelt es sich um ein Gedicht aus der Zeit des Barock. Thematisiert wird die Vergänglichkeit des Irdischen. Inhaltlich handelt das Gedicht von der Zerstörung des 30-jährigen Krieges und den Folgen der Zerstörung, sowie dem Vertrauen der Menschen an das Irdische.
Das Gedicht umfasst 14 Strophen und ist in der Form eines Sonettes gegliedert. Als Reimschema liegen in den Quartetten umschließende Reime vor, während die Terzette durch Paarreime gekennzeichnet werden. Als Metrum liegen durchgehend sechs-hebige Jamben vor, die 12 bis 13 Silben beinhalten und durch eine Mittelzäsur geteilt werden. Es liegen sowohl stumpfe als auch klingende Kadenzen vor, die sich dem Reimschema des Gedichtes anpassen.
Der zu analysierende Text setzt mit der Aussage „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V. 1) ein. Die „Eitelkeit“ (ebd.), die bereits im Titel des Gedichtes Erwähnung findet, ist in diesem Fall als veraltetes Synonym für Vergänglichkeit zu verstehen. Der Inhalt des Verses spiegelt die Situation in der Entstehungszeit des Gedichtes wieder. Das Gedicht ist während des 30-jährigen Krieges entstanden, in welchem viele Städte und Gebiete zerstört wurden und in dem die Lebensbedingungen der Menschen sehr schlecht waren. Das Lyrische Ich beschreibt, dass egal wohin man sich wendet, überall nur Vergänglichkeit zu sehen ist. Das Repetitio der Formulierung „du siehst“ (ebd.) veranschaulicht die allgemeine Gültigkeit der Aussage des Lyrischen Ichs. Generell lässt bereits der erste Vers des Gedichts eine resignative Stimmung erschließen, da der Krieg in dieser Zeit für die Bevölkerung sehr belastend ist. Dies wird ebenfalls durch die antithetische Struktur der nächsten Verse verstärkt. Das Lyrische Ich beschreibt „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V. 2). Auffällig sind neben der Kontrastierung zwischen den Zeitangaben „heute“ (ebd.) und „morgen“ (ebd.), auch die Pronomen „dieser“ (ebd.) und „jener“ (ebd.), welche auf jede Person zu beziehen sind und die Aussage somit verallgemeinern. Auch hier wird wieder die Situation während des Krieges in Bezug auf die Vergänglichkeit aufgegriffen. Was die Menschen an einem Tag bauen oder bereits vor geraumer Zeit gebaut haben, kann am nächsten Tag schlagartig zerstört werden. Im folgenden Vers veranschaulicht das Lyrische Ich die Aussage durch das Beispiel „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3). Das Beispiel ist durch das Reimschema formal mit dem vorhergehenen Vers verbunden und verdeutlicht zum einen die Vergänglichkeit, zum anderen aber auch ein Anzeichen für die Zerstörung während des Krieges. Die antithetische Struktur, die in den ersten drei Versen des Textes verwendet wird, wird durch das Versmaß verstärkt. Als Versmaß liegen Alexandriner vor, die durch eine Mittelzäsur geteilt werden. Der monotone Rhythmus des Alexandriners verstärkt die ohnehin resignative Stimmung des Gedichtes, während die Mittelzäsur die genannten Gegensätze voneinander separieren. Diese Trennung wird formal durch ein Komma verbildlicht und somit hervorgehoben. An das Beispiel im dritten Vers knüpft der vierte Vers unmittelbar an. Es ist erneut die Rede von der Wiese „[a]uf der ein Schäfers-Kind wird spielen mit den Herden“ (V. 4). Die Metapher des „Schäfers-Kind“ (ebd.) auf einer Wiese, verdeutlicht die Sehnsucht nach der friedlichen Zeit, wie sie vor dem Krieg war, und wiederholt die Vergänglichkeit bzw. die Nichtigkeit des vom Menschen Erschaffenen. Auffällig ist, dass in diesem Vers, nicht wie in den übrigen, die Mittelzäsur durch ein Komma dargestellt wird. Der Vers wirkt somit trostlos, was durch die stumpfe Kadenz am Versende verstärkt wird.
Die zweite Strophe des Gedichtes setzt mit der Feststellung „[w]as jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5) ein. Erneut ist die Kontrastierung zwischen dem gegenwertigen Zustand und dem zukünftigen Geschehen zu erkennen, somit wird neben der allgemeinen Vergänglichkeit des Irdischen insbesondere die Vergänglichkeit der Natur hervorgehoben. Die antithetische Darstellung wird wiederholt durch eine Mittelzäsur und das Komma formal getrennt, was die Kontrastierung des Inhalts innerhalb des Verses veranschaulicht. Das Adverb „jetzund“, welches zuletzt im 18. und 19. Jahrhundert verwendet wurde, verdeutlicht das Alter des Gedichtes und bestätigt, neben der Sonett-Form und der Verwendung des Alexandriners, dass das Gedicht aus der Epoche des Barock stammt, da dies typische Merkmale für diese Literaturepoche sind. Im zweiten Vers der Strophe „Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V. 6) wird wiederrum die antithetische Struktur des Gedichtes aufgeführt. Die Verben „poch[en]“ (ebd.) und „trotz[en]“ (ebd.) charakterisieren ein lebendiges Wesen. Das Verb „poch[en]“ (ebd.) beschreibt den Herzschlag eines Lebewesens, während „trotz[en]“ (ebd.) als Abwehrhaltung für herannahende Gefahren verstanden wird, die die Existenz des Lebewesens gefährden. Im weiteren Verlauf des Verses wird allerdings auch wider die Nichtigkeit dargestellt, wenn es in Bezug auf das Lebewesen heißt es, es sei „morgen Asch und Bein“ (V. 6). Die Formulierung „Asch und Bein“ (ebd.) steht metaphorisch für den Tod des Lebewesens und verbildlicht somit die Vergänglichkeit des Lebens. Hier lässt sich wieder ein Rückbezug auf die historische Situation vornehmen, da während des Krieges viele Menschen und auch Tiere getötet wurden, die möglicherweise ohne den Krieg noch ein langes Leben geführt hätten. Dieser Umstand verstärkt die resignative Stimmung und deutet bereits eine klimaxartige Steigerung zur ersten Strophe an, da in der ersten Strophe nur die Nichtigkeit des von Menschen Erschaffenen beschrieben wurde, während nun die Vergänglichkeit der Lebewesen Thema ist, auf die der Mensch nicht immer direkten Einfluss hat. Das Lyrische Ich fasst diese Erkenntnis mit dem Befund „Nichts ist, das ewig sei“ (V. 7) zusammen. Unter diesen Befund fallen laut des Lyrischen Ichs auch Materialien wie Erz und Marmorstein (vgl. V. 7), welche im 17. Jahrhundert, in der Zeit als das Gedicht verfasst wurde, noch als unzerstörbar galten und somit wiederholt die Nichtigkeit dessen, was als unzerstörbar galt und des Irdischen im allgemeinen darstellt. Die Strophe endet mit einem Vers in derselben antithetischen Struktur, die bereits in den ersten Versen des Gedichts verwendet wurde. Das Lyrische Ich erklärt „Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden“ (V. 8). Die Personifikation des Glücks steht in diesem Vers der Synästhesie der donnernden Beschwerden gegenüber (vgl. V. 8). Im Zusammenhang mit dem historischen Hintergrund verdeutlicht die Personifikation, dass was die Bevölkerung sich am meisten Wünscht: „Glück“ (V. 8) um zum einen den Krieg zu überleben und zum anderen, dass der Krieg, der sich zu diesem Zeitpunkt schon seit fast 20 Jahren zuträgt, bald endet. Der Krieg wird in diesem Vers durch die donnernden Beschwerden (vgl. V. 8) dargestellt. Das Verb „donnern“ (ebd.) verdeutlicht in der Synästhesie den Beschuss während des Krieges, wohingegen die „Beschwerden“ (ebd.) eine Folge des Beschusses.
Mit der dritten Strophe erfolgt sowohl ein inhaltlicher, als auch ein formaler Umbruch. Während in den ersten beiden Strophen noch vier Verse verwendet wurden und der Kontrast zwischen der gegenwärtigen Situation und den zukünftigen Gegebenheiten in Bezug zur Vergänglichkeit thematisiert wird, werden in der dritten und vierten Strophe nur noch drei Verse verwendet und die Vergänglichkeit des Individuums dargelegt. Die dritte Strophe beginnt mit der Feststellung „Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn“ (V. 9), was soviel heißt wie, die Erfolge, die ein Individuum erzielt hat sind in zum einen in der Zeit des Krieges nichts mehr wert, aber auch im allgemeinen nichts wert, da alles Irdische vergänglich ist. Markant an diesem Vers ist die Verwendung des Metrums in Kombination mit dem Adjektiv „ho[ch]“ (ebd.) in Bezug auf die zustande gebrachten Taten. Zum einen liegt auf dem Adjektiv „ho[ch]“ eine Betonung, welche die Bedeutung des Wortes beim Lesen hervorhebt, aber auch der durch die Zäsur verursachte Anstieg der Stimme bis zum Einschnitt, auf welchen sowohl der Fall der Stimme, als auch der Verfall der Taten folgt. Im folgenden Vers wir das Lyrische Ich, das zuvor nur eine betrachtende und somit eher passive Rolle erfüllte aktiv. Es wirf die rhetorische Frage „Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehn?“ (V. 10). Die rhetorische Frage bezieht sich auf die Vergänglichkeit der Menschen, was an der Metapher „Spiel der Zeit“ (ebd.) deutlich wird. Die Menschen werden mit ihrem Leben als Spielfiguren betrachtet, die nach einer bestimmten Zeit vom Spielbrett gestoßen werden. Der Umstand, dass das Lyrische Ich die Formulierung „der leichte Mensch“ (ebd.) verwendet gibt zum einen Aufschluss über den allgemeinen Wert des Menschen und seines Lebens als Spielfigur und zum anderen wirft es die Frage auf, wer mit den Menschen spielt. Die Antwort auf diese Frage ist nur im Überirdischen zu finden und lässt sich somit mit Gott als Spieler des Spiels beantworten. Er entscheidet darüber in welche Richtung sich die Figuren bewegen, welche Figuren das Spielfeld verlassen und welche bleiben. Der Schlussvers dieser Strophe wird mit der Interjektion „Ach!“ (V. 11) eingeleitet. Dieser Ausruf verdeutlicht die Verzweiflung bzw. die Resignation des Lyrischen Ichs über die gewonnene Erkenntnis bezüglich der Vergänglichkeit. Weiterhin stellt das Lyrische Ich die Frage „was ist alles dies, was wir für köstlich achten“ (V. 11). Das, „was wir für köstlich achten“ (ebd.), sind die irdischen Bestandteile des Lebens der Menschen. Diese vergleicht das Lyrische ich dann zu Beginn der letzten Strophe des Textes „[a]ls schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind“ (V. 12). Das Wortfeld der verwendeten Substantive stammt aus der Vergänglichkeit, deren Bedeutung auch durch die Aufzählung bzw. durch den Parallelismus in Form eines Trikolons bekräftigt wird. Somit haben die irdischen Bestandteile, die den Menschen wichtig sind, genau wie die Menschen selbst eine zeitliche Begrenzung. Dies wird ebenso im letzten Teil des Vergleiches, der zeitgleich auch der letzte Bestandteil des Trikolons ist, deutlich. Die irdischen Bestandteile des Lebens werden mit einer „Wiesen-Blum“ (V. 13) verglichen, welche „man nicht wider find’t“ (ebd.). Die Lebenszeit der, als Metapher für das Leben der Menschen und der irdischen Bestandteile verwendeten, Blume ist abgelaufen und sie lässt sich nicht wieder zurückholen bzw. der Verfall lässt sich nicht rückgängig machen. Der Vers veranschaulicht somit die Unumgänglichkeit der Vergänglichkeit und stellt somit das Verhalten der Menschen, die die irdischen Bestandteile wertschätzen in Frage. Das Lyrische Ich beendet das Gedicht mit der Aussage „Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten“ (V. 14). Hierbei werden die Erkenntnisse aus dem vorangehenden Vers noch einmal aufgegriffen und beantwortet. Da das irdische vergänglich ist, ist das einzige, das Überirdisch ist gleichzeitig auch das einzige das „ewig ist“ (ebd.). Nach den Vorstellungen der damaligen Zeit (Absolutismus), ist das einzige das Überirdisch ist Gott, gefolgt von den obersten Herrschern. Das Lyrische Ich macht somit zum Ende des Gedichtes klar, dass nur der Glaube an Gott zählt und nicht das Vertrauen an irdische Bestandteile.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Lyrische Ich die Leser darauf aufmerksam macht, dass alles Irdische vergänglich und somit nichts wert ist. Letzten Endes zählt somit der Glaube an Gott, was den Menschen jedoch nicht in dieser Form benutzt wird. Zentrale formale Elemente des Textes sind die charakteristischen Merkmale des Barocks, wie beispielsweise das monotone Metrum, die Mittelzäsur, die besonders in den ersten beiden Strophen eine Rolle spielt, aber auch die Form des Sonetts selbst, welches durch die klare Struktur und die formale Gliederung das Verständnis des Textes und insbesondere des Umbruchs formal deutlich macht.
Alina
Das Sonett „Es ist alles eitel“ verfasst von Andreas Gryphius und verfasst im Jahre 1637, stammt aus der Zeit des Barock und thematisiert die Vergänglichkeit des Irdischen.
Das Gedicht besteht aus 14 Versen und ist in vier Strophen gegliedert. Es besteht aus jeweils vier Versen in der ersten und zweiten Strophe und aus jeweils drei Versen in Strophe drei und vier. Der Aufbau weist daher auf ein Sonett hin, da dieses aus zwei Quartetten und zwei Terzetten besteht. Das Metrum ist ein sechshebiger Jambus.
Die erste Strophe beginnt mit der Aussage „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V. 1) und verdeutlicht somit, dass alles was man sieht, auf der ganzen Welt vergänglich ist. Zur Zeit des Barocks bezeichnet man die Vergänglichkeit als Eitelkeit und ist somit ein erstes Merkmal für die Epoche. Zudem wird anhand der Anapher „du siehst“ (V. 1) deutlich, dass das lyrische Ich das vergängliche mit eigenen Augen erkennen kann und sieht, wie sich die Welt verändert. Die Verwendung des sechshebigen Jambus und der männlichen Kadenz, verweist darauf das es sich hierbei um die Realität handelt, da die männliche Kadenz sehr hart auf das Gedicht wirkt und somit Fakten in den Raum stellt. Folgend erkennt das lyrische ich, dass sich die Welt ganz schnell verändern wird indem anhand einer Antithese gesagt wird, „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein;“ (V. 2). Die schnelle Veränderung der Welt wird anhand der Adverbien „heute [und] morgen“ (V. 2) deutlich. Das Pronomen „jener“ (V. 2) verallgemeinert die Situation und lässt daraus schließen, dass jeder bereit dazu wäre, die Welt zu zerstören. Daraufhin folgt ein weiteres antithetisches Beispiel, welches die Vergänglichkeit des Irdischen darstellt, denn „Wo jetzund Städte stehn, wird wird eine Wiese sein“ (V. 3). Mit dieser Aussage bezieht sich das lyrische Ich auf die Zerstörung von Städten und vermutet, was durch „wird“ erkennbar ist, dass später mal auf diesem Platz eine Wiese sein wird, „Auf der ein Schäferkind wird spielen mit den Herden“ (V. 4). Anhand dessen wird klar, dass eine Vorausdeutung in die Zukunft dargestellt ist und die Natur, als die Macht gegen uns Menschen bezeichnet ist. „Schäferskind“ (ebd.) und „Herden“ (ebd.) verdeutlichen die Macht der Natur in Verbindung mit dem Menschen. Im Allgemeinen lässt sich in der ersten Strophe ein sechshebiger Jambus erkennen, mit zwei männlichen Kadenzen in Vers eins und vier und zwei weiblichen Kadenzen in Vers zwei und drei. Zudem liegt ein umarmender Reim (abba) vor, welcher die Gesamtsituation des Vergänglichen darstellt.
Die zweite Strophe folgt mit einer Antithese „Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5) und hebt somit die Vergänglichkeit der Pflanzen hervor. Das lyrische Ich bemerkt also, dass auch die Natur vernichtet wird und das „Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V. 6). Mit „pocht“ (ebd.) und „Asch und Bein“(ebd.) wird metaphorisch das Herz eines Lebewesens welches aufhört zu schlagen dargestellt. Die Anapher „Was jetzt“ (ebd.) untermauert das Natur und Lebewesen unter den gleichen Umständen leiden und mit der Zeit vergehen werden. Zudem wird anhand der Aussage „Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein“ (V. 7) deutlich, das Dinge wie in diesem Beispiel „Erz und Marmorstein“ (ebd.), welche zur Zeit des 17. Jahrhunderts als unzerstörbar galten, auch in der Lage zu zerstören. Und nur das was „ewig sei“ (ebd.) ist nicht vergänglich. Metaphorisch ist mit ewig, Gott gemeint, denn er wird niemals vergehen. Vers acht wird mit der Personifikation „Glück“ (V. 8) eingeleitet, welches „uns [an] lacht“ (V. 8) und mit der Synästhesie „donnern die Beschwerden“ (V. 8) gegenübergesetzt. Das Glück und die Beschwerden stehen uns Menschen im Leben sehr nah gegenüber und verdeutlichen somit die Gefühle der Menschen und lassen somit die Angst vor der Vergänglichkeit deutlich werden. Das Personalpronomen „uns“ (ebd.) unterstreicht, das wir Menschen unter diesen Umständen leiden und bemerken das uns die Angst bevorsteht.
Nina H.
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Es ist alles eitel“, der von Andreas Gryphius verfasst und im Jahre 1637, zur Zeit des 30-jährigen Krieges, veröffentlicht wurde, handelt es sich um ein politisches Gedicht. Es ist der Literaturepoche Barock zuzuordnen, welche besonders durch den sogenannten „Vanitas-Gedanken“, der sich auf die Vergänglichkeit alles Irdischen bezieht, geprägt wurde. Dieser wird auch in dem Gedicht Gryphius` thematisiert.
Das Gedicht ist aus 14 Versen zusammengesetzt, welche in 4 Strophen gegliedert sind. Zwei dieser Strophen sind Quartette, da sie aus je 4 Versen bestehen und die anderen beiden sind Terzette, welche aus jeweils 3 Versen zusammengesetzt sind. Diese Form des Gedichtes nennt sich Sonett. Bezüglich des Metrums liegt ein sechshebiger Jambus vor, dessen Kadenzen abwechselnd betont (männlich) und unbetont (weiblich) sind. In den Quartetten liegt bezüglich des Reimschemas ein umarmender Reim (abba, abba) vor, während die Terzette einen Schweifreim (ccd, eed) aufweisen. Dabei ist im Zusammenspiel mit den Kadenzen eine Besonderheit festzustellen, da die sich reimenden Verse die gleichen Kadenzen aufzeigen.
Bereits der Titel „Es ist alles eitel“ deutet die Vergänglichkeit von alledem, was diesseitig ist, also der Erde angehört, an und leitet somit in die zentrale Thematik des Textes ein. Besonders das Zahlwort „alles“ (ebd.) akzentuiert, dass die Gesamtheit des Diesseitigen von der Vergänglichkeit betroffen ist. Außerdem wird an dieser Stelle bereits die Haltung des Erzählers zu jener angedeutet, da deutlich erkennbar ist, dass er sich der Vergänglichkeit alles Irdischen durchaus bewusst ist. Anschließend setzt das Gedicht damit ein, dass der Erzähler erwähnt, man sehe „nur Eitelkeit auf Erden“ (V. 1). Damit wird erneut der Vanitas-Gedanke aufgegriffen, welcher die Vergänglichkeit alles irdischen Seins und folglich allen Lebens auf der Erde beschreibt. Das Adverb „nur“ (ebd.) hebt dabei insbesondere hervor, dass sich die Vergänglichkeit ausschließlich auf das Irdische beschränkt, wodurch gleichzeitig angedeutet wird, dass das Überirdische, also Gott, für die Ewigkeit besteht. Auf der anderen Seite deutet dies auf die Haltung des Erzählers in Bezug auf die Ausweglosigkeit aus dieser Situation hin, da ihm bewusst ist, dass man der Vergänglichkeit und der Zeit nicht entfliehen kann, was zudem eine gewisse Hoffnungslosigkeit des Erzählers vermuten lässt. Durch die Verwendung des Pronomens „du“ (V. 1) wird der Leser direkt angesprochen und in die Thematik einbezogen, da sie jeden betrifft. Des Weiteren erklärt der Erzähler, was „dieser heute“ (V.2) baue, reiße „jener morgen“ (V. 2) wieder ein. Diese Aussage zielt auf die Folgen des dreißigjährigen Krieges, welcher die Zerstörung vieler Teile Deutschlands mit sich gebracht hat. Besonders auffällig ist jedoch, dass sich die beiden genannten Aussagen antithetisch gegenüber stehen, was vor allem durch die Adverbien „heute“ (ebd.) und „morgen“ (ebd.) hervorgehoben wird. In Verbindung mit den Verben „baut“ (V. 2) und „reißt […] ein“ (V. 2) könnten diese mit der Gegenwart und Zukunft assoziiert werden. Dies bezieht sich darauf, dass etwas in der Gegenwart zu erbauen bedeutet, etwas Neues zu schaffen, was eine positive Wirkung hat, dies jedoch anschließend in der Zukunft wieder einzureißen deutet auf die Vergänglichkeit hin, da diese positive Wirkung nur von kurzer Dauer ist, was an der kurzen Zeitspanne zwischen „heute“ (ebd.) und „morgen“ (ebd.) deutlich zu erkennen ist. Diese Aussage erinnert ebenfalls an den sogenannten „memento mori“, welcher die Lyrik zur Zeit des Barock stark geprägt hat. Mit diesem ist gemeint, dass man bedenken solle, dass man stirbt. Diese Erinnerung an den Todesgedanken sollte die Menschen daran erinnern, sich auf ihr Leben in der Gegenwart zu konzentrieren und dieses zu nutzen. Somit könnte diese antithetische Aussage auch diesen Gedanken, jeden Moment des Lebens zu genießen, da er schnell wieder vergehen werde, vor Augen führen. Diese Vergänglichkeit wird durch das Pronomen „jener“ (ebd.) verallgemeinert, da sie überall zu erkennen ist. Daraufhin wird erneut die Zerstörung als Folge des Krieges sowie die Vergänglichkeit verdeutlicht, wenn der Erzähler erläutert, wo „jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3). An dieser Stelle ist nochmals die Gegensätzlichkeit der Aussagen zu erkennen, welche vor allem durch die Zäsur zwischen der These und der Gegenthese hervorgehoben wird. Diese Zäsur dient jedoch auch dem Rhythmus des Gedichts, da an jener ein Einschnitt beziehungsweise eine Pause erfolgt. Auf die „Wiese“ (ebd.) geht er im Folgenden Vers vertieft ein, indem er erläutert, auf jener werde ein „Schäferskind […] mit den Herden“ (V. 4) spielen. Das Bild des Schäferskindes als Hirte der Herde könnte sich im übertragenen Sinne auf die Religion beziehen, da Gott im Christentum als fürsorglicher Vater des Volkes oftmals auch als Hirte bezeichnet wurde, der jenes schützt. Bezieht man dies wiederum auf den dreißigjährigen Krieg könnte diese Aussage als eine Art Appell des Erzählers an den Leser angesehen werden, da das Vertrauen in Gott, das Überirdische, das nicht vergeht, aus dieser Situation der Zerstörung hinaushelfen könnte. Demnach könnte diese Textstelle dazu dienen, Hoffnung zu vermitteln, dass nach dem Krieg wieder eine friedliche Zeit folgt.
Im Anschluss daran folgt das zweite Quartett mit der Aussage, was jetzt so „prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5). Das Verb „blüht“ (ebd.) erinnert an Blumen und auch diese bestehen nicht für die Ewigkeit, was die Vergänglichkeit der Natur untermauert. Insgesamt fällt bis zu dieser Textstelle auf, dass der Fokus bisher auf der Vergänglichkeit der Natur und den Dingen, die der Mensch geschaffen hat, liegt. Dies ändert sich jedoch mit der darauf folgenden Beschreibung, dass das was noch „so pocht und trotzt“ (V. 6) am nächsten Tag bereits „Asch und Bein“ (V. 6) sei. Insbesondere das Verb „pocht“ (ebd.) lässt erkennen, dass es sich bei dieser Aussage um Menschen handelt, da das Pochen an das menschliche Herz erinnert. Jene Menschen, die erwähnt werden scheinen Widerstand gegen den Krieg beziehungsweise einen feindlichen Angriff zu leisten, was durch das Verb „trotzt“ (ebd.) hervorgehoben wird. Eben diese Menschen seien am nächsten Tag lediglich noch „Asch und Bein“ (ebd.) was mit dem Tod in einer Verbindung steht, welcher eine Folge des Krieges ist. An dieser Stelle ist die Kritik Gryphius` deutlich festzustellen, da er eine der Konsequenzen des Krieges darstellt. Somit wird an dieser Stelle die Vergänglichkeit des Menschen in den Vordergrund gestellt. Die Anapher „Was jetzt“ (V. 5, V. 6), welche die Aussagen der Vergänglichkeit der Natur und die des Menschen einleitet, verbindet diese miteinander und hebt somit hervor, dass alles Irdische vergänglich ist. Dies wird auch durch die im Anschluss folgende Aussage „kein Erz, kein Marmorstein“ (V. 7) vor Augen geführt, da man früher geglaubt hat, man könne sie nicht zerstören und sie würden für die Ewigkeit bestehen. Dies widerlegt der Autor jedoch, denn seiner Meinung nach sind auch diese vergänglich, da sie etwas irdisches sind. Des Weiteren folgt die Personifikation jetzt „lacht das Glück“ (V. 8), welche der Synästhesie bald „donnern die Beschwerden“ (V.8) antithetisch gegenübersteht. Dies soll auf der einen Seite die Vergänglichkeit des Glücks und somit der guten Zeiten darstellen und deutet auf der anderen Seite auf die Folgen des Krieges hin, da die „Beschwerden“ (ebd.) nach dem Krieg häufig durch die darauf folgenden Hungersnöte sowie das Leid der Menschen aufgekommen sind.
Sarah
Das Sonett „Es ist alles eitel“, welches 1637 veröffentlicht und von Andreas Gryphius in der Epoche des Barocks geschrieben wurde, thematisiert die allgemeine Vergänglichkeit irdischer Dinge mit besonderem Fokus auf der Vergänglichkeit des Lebens im 30-jährigen Krieg.
Das Gedicht befasst sich im historischen Kontext mit der Vergänglichkeit des Menschen und im Kontrast dazu hintergründig auch mit der Unendlichkeit bzw. Ewigkeit Gottes, welche besonders in der letzten Strophe zum Ausdruck kommt. Bezogen auf den 30-jährigen Krieg wird so in der Vergänglichkeit die Zerstörung der Menschenleben und Städte ausdrücklich, die zu dieser Zeit Tag für Tag durchlebt werden musste. Darauf bezogen setzt auch die erste Strophe, geschrieben in einem umschließenden Reim, mit den Worten „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“(V. 1) ein. Hierbei wird besonders die Komplexität der Vergänglichkeit, welche im Wort „Eitelkeit“(ebd. ) benannt wird, deutlich, indem der Ausdruck „Du siehst, wohin du siehst“(ebd. ) verwendet wird. Dieser drückt gleich zu Beginn aus, das alles irdische vergänglich ist und dehnt somit den Rahmen auf alles aus. Auffallend ist hierbei jedoch die Verwendung des Verbs „sehen“(ebd. ), welches Anlass gibt, das Vergängliche auf irdischer Ebene zu betrachten, da der Mensch nicht im Stande ist, das überirdische, bzw. „Gott“ zu sehen. Zudem spitzt das Adverb „nur“ (ebd. ) diese Bedeutung des Überirdischen noch einmal zu, indem die Erde somit als alleinig aus Vergänglichkeit bestehend beschrieben wird, weshalb das Reich Gottes indirekt, hier noch nicht ganz deutlich, aber bezüglich der vierten Strophe einen Kontrast zum Irdischen bildet. Die abschließende Interpunktion, die den Satz beendet, verweist dabei noch einmal auf die endgültige Vergänglichkeit aller Dinge und allen Lebens ohne Ausnahme. Daran anschließend konkretisieren die drei folgenden Verse die irdische Situation, indem Beispiele für die Vergänglichkeit genannt werden. In diesem Sinne setzt der Text mit den Worten „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“(V. 2) fort. Besonders kommt dabei die Allgegenwärtigkeit des Vergänglichen in den Pronomen „dieser“(ebd. ) und „jener“(ebd. ) noch einmal zum Ausdruck. Sie verallgemeinern das Bezugsfeld, sodass alle Menschen das Vergängliche miterleben sowie mit beeinflussen. Hierbei redet das lyrische ich in diesem Zusammenhang von Gebäuden, vielleicht auch im metaphorischen Sinne von Errungenschaften einzelner, die wiederum zerstört werden. Die Zerstörung lässt sich dabei auf den historischen Hintergrund und somit auf den 30-jährigen Krieg beziehen, in welchem viele Leben und so auch Lebensräume zerstört wurden. Die antithetische Formulierung, wie auch der Kontrast in „heute“(ebd. ) und „morgen“(ebd. ) spielt dabei jedoch auch gewissermaßen auf die Wechselseitigkeit des Krieges an. Bezüglich der Zerstörung setzt der dritte Vers fort „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“(V. 3), worin wiederum Zusammenhänge zum Krieg gezogen werden können. Hierbei stechen aber auch noch einmal die antithetischen Begriffe „Städte“(ebd. ) und „Wiesen“(ebd. ) hervor, die insbesondere auf die materielle Vergänglichkeit anspielen, aber auch verdeutlichen, dass alles wieder zu seinem Ursprung gelangt, da dort vor der Stadt auch nur eine Wiese gewesen war. Eben diese Art von Kreislauf des Lebens unterstreicht der Vers „Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden“(V. 4). Die Verwendung des Futurs sowie die Simplizität der Situation, die hier dargestellt wird, zeigt das lyrische ich, dass es trotz aller Zerstörung und Vergänglichkeit auch immer wieder einen Neuanfang und so auch neues Leben gibt, welches im Wechsel mit dem Tod bzw. der Vergänglichkeit steht. Auch drückt letztlich der umschließende Reim in den ersten beiden Strophen diese Vergänglichkeit als letztliches Mittel allen Lebens aus, was auch durch die Kadenzen deutlich wird. Hierbei sind der erste und vierte Vers weiblich, enden also auf einer unbetonten Silbe, und die umschlossenen Verse, wie auch in Strophe zwei männlich, enden auf einer betonten Silbe. Dabei ist auffallend, dass die betont endenden Verse jeweils eine Tatsache beinhalten.
Die Kontrastierung zweier Sinnbilder setzt sich auch in der zweiten Strophe fort, was wiederum die Allgegenwärtigkeit des Vergänglichen unterstreicht. In „Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“(V. 5) wird auf gewisse Weise erneut metaphorisch das Leben dem Tod gegenüber gestellt. Besonders drückt darin die Wortwahl die Resignation des lyrischen Ichs aus, welches dem Leben nachtrauert, sich jedoch des Vergänglichen und des Neuanfangs bewusst ist, diesen jedoch nicht völlig zu verstehen vermag. Hierbei sticht jedoch durch die Verwendung des Futurs erneut die Wechselhaftigkeit heraus, die zum einen erneut auf den Krieg, aber zum anderen auch auf die Wechselhaftigkeit des allgemeinen Lebens anspielt. Somit ist es ungewiss, wie lange etwas anhalten und beständig sein wird, da die Möglichkeit des Vergehens jederzeit besteht. Dies entspricht auch dem Tod, der ungewiss eintreten kann, sei es durch Krieg oder aber andere Umstände, wie es in den folgenden Worten „Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“(V. 6) deutlich wird. Besonders steht dabei das Verb „pochen“(ebd. ) für den Herzschlag und somit für Leben, wohingegen „Asch und Bein“(ebd. ) auf eine tote Person andeuten. Besonders wird hier jedoch auch noch einmal die Nichtigkeit einer einzelnen Sache oder Person für die Gesamtheit deutlich, indem die Asche metaphorisch als Symbol der Vergänglichkeit gilt. Zudem gilt sie bezüglich des Todes jedoch auch als Zeichen der Trauer, was die Resignation des lyrischen Ichs untermauert. Rückbezogen auf die verschiedenen Beispiele wie dem Tod oder der Zerstörung von Stätten folgt so als Schlussfolgerung des lyrischen Ichs „Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein“(V. 7). Auch dieser Satz wird wie auch schon der erste durch eine Interpunktion beendet, was die Endgültigkeit der Aussage unterstreicht und somit die Vergänglichkeit verallgemeinert. Dass diese Aussage für alles und jeden gilt, wird dabei in den Worten „kein Erz, kein Marmorstein“(ebd. ) ausdrücklich, da Erz und Marmor in früheren und auch in heutigen Zelten als teure und resistente Stoffe gelten, die vielem Stand halten. Sie unterstreichen die Aussage also insofern, dass sie letztlich die Spitze des Unkaputtbaren darstellen und dennoch vergänglich sind, weshalb sich jegliche anderen Dinge dem unterordnen. Im letzten Vers der zweiten Strophe wird im Anschluss noch einmal besonders auf die Wechselhaftigkeit und den Kreislauf des Lebens angespielt. So zeigt „Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden“(V. 8), dass das Leben gute wie auch schlechte Zeiten beinhaltet und der Wechsel zwischen diesen unabsehbar stattfindet, was das Adverb „bald“(ebd. ) andeutet. Aber auch der Bezug auf ein jedes Leben wird im Personalpronomen „uns“(ebd. ) deutlich, der durch die Personifikation „Jetzt lacht das Glück“(ebd. ) gestärkt wird. Eben diese verdeutlicht, dass das Glück auch etwas unbeeinflussbares ist, wie jeder andere Mensch auch, sodass auch das Aufkommen von Glück etwas ist, das vergänglich ist. Das gleiche drückt so auch die Metapher „bald donnern die Beschwerden“(ebd. ) aus, welche gewissermaßen auch für eine Unbeständigkeit der menschlichen Verfassung und Gemütsstimmung steht und somit auch diese als vergänglich akzentuiert. Betrachtet man die beiden ersten Strophen im Zusammenhang, so fällt ein etwas klimaktischer Aufbau von erster zu zweiter Strophe auf.
Die dritte und vierte Strophe stehen dahingegen etwas im Kontrast zu den beiden vorherigen Strophen, indem das lyrische Ich darin nachdenklich wirkt und über die menschliche Existenz nachdenkt. Fasst man die beiden Strophen zusammen, so fällt gleich der darin vorhandene Schweifreim auf, im Einzelnen also ein Paarreim und eine Weise. Dieses Reimschema, das in den beiden Quartetten und Tärzietten aufzufinden ist, ist das für den Barock typische Reimschema Alexandriner. Zugleich fällt aber auch die durch den im Gedicht stringent verwendeten 6-hebigen Jambus auch auf, dass die Paarreime jeweils betont enden und die sich reimenden Weisen/Schweife dahingegen unbetont. Inhaltlich fällt in diesem Kontext auf dass die unbetonten Verse meist noch etwas positives beinhalten, das den Sinn hinter der Vergänglichkeit ausdrückt. Das Metrum sorgt dahingegen jedoch für eine monotone Darstellung, die bezogen auf den Inhalt die unumgehbare Existenz der Vergänglichkeit darstellt.
Die dritte Strophe setzt mit dem Ausdruck „Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn“(V. 9) ein. Der Vergleich mit einem Traum bringt dabei die Nichtigkeit der Dinge in den Vordergrund. Zwar wird hier konkret von Ruhm gesprochen, über den das lyrische Ich nachdenkt, jedoch lässt dieser sich als ein Exemplar auffassen, dass eigentlich zeigt, wie unwichtig Dinge wie Ruhm und materielles Reichtum sind, da sie letztlich so schnell vorüber und in Vergessenheit geraten sind wie ein Traum, an den man sich oftmals schon nach kurzer Zeit nicht mehr erinnern kann. Darauf folgt die rhetorische Frage „Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?“(V. 10), welche durch die Existenz des Todes ihre Antwort findet. Besonders sticht hier aber auch die Metapher „das Spiel der Zeit“(ebd. ) heraus, welche verdeutlicht, dass die Zeit selbst endlos ist, jedoch das Spiel und somit das Leben des Menschen innerhalb dieser ein Ende findet, wie jedes Spiel irgendwann endet. In diesem Kontext wird der Mensch durch das Adjektiv „leicht“(ebd. ) verallgemeinernd als schwach dargestellt, was sich rückblickend auf den „Marmorstein“(V. 7) als Kontrast zur Härte zeigt, die jedoch auch nicht beständig ist. Somit deutet die Beschreibung des Menschen die vorausgesetzte Endlichkeit dieses an. Dass diese Tatsache das lyrische Ich resignieren lässt, wird in der Interjektion „Ach“(V. 11) deutlich. Im Anschluss daran fragt es sich, „was ist alles dies, was wir für köstlich achten“(V. 11). Durch diese Frage wird deutlich, dass das, was der Mensch zu Lebzeiten verehrt in Anbetracht der Zeit nichts wert ist und bezogen auf die Vergänglichkeit somit auch seinen Sinn verliert.
Direkt im Anschluss und als indirekte Antwort auf diese Frage setzt die vierte Strophe mit den Worten „Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind“(V. 12) ein. Diese akzentuieren im metaphorischen Sinne, dass alles Irdische und vom Menschen erschaffene letztlich nur eine Kleinigkeit, wenn nicht gar nichts für die Gesamtheit ist. So gehören „Schatten, Staub und Wind“(ebd. ) alle zum Wortfeld der Vergänglichkeit, da sie alle Dinge sind, die nur für einen Moment bemerkt werden und kaum sichtbar sind. Diese akkumulierte Darstellung der Nichtigkeit wird auch im folgenden Vers, welcher sich wiederum auf die dritte Strophe bezieht, in „Als eine Wiesenblum, die man nicht wieder find´t!“(V. 13) erneut aufgegriffen. Hierbei zeigt das Bild einer einzelnen Blume den geringfügigen Wert eines Menschen oder aber eines Gegenstandes für die Zukunft und die gesamte Welt. Schafft man hier nochmals eine Überleitung zum Krieg, so deuten diese beiden Verse die Nichtigkeit eines Individuums für einen Staat an, dem sich das lyrische Ich unverständig entgegensetzt. Somit sei alles vergänglich und sobald etwas vergangen ist, ist es vergessen und ohne Bedeutung. Dass dieser ganzen Vergänglichkeit jedoch etwas als eine Art Hoffnung entgegensteht, interessiert die meisten Menschen nicht, weshalb sie am Vergänglichen festhalten. Eben diese Tatsache wird im letzten Vers „Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten“(V. 14) deutlich. Letztlich ist Gott und somit das Leben nach dem Tod das Unendliche, das die Menschen jedoch im Leben noch nicht sehen oder erreichen können, aber auch nicht sehen wollen, indem sie am Irdischen festhalten. Bezogen auf den 30-jährigen Krieg wird hierbei der ursprüngliche Anlass des Krieges, der zu Beginn ein Glaubenskrieg war, herausgestellt. Jedoch vergaßen die Menschen nach und nach den wahren Anlass ihres Kämpfens, sodass der Krieg eher zu einem materiellen Krieg wurde und der Glaube und so zugleich das Endliche vernachlässigt wurden.
Zusammenfassend befasst sich das Sonett im allgemeinen mit der Vergänglichkeit alles Irdischen, dem Gott jedoch kontrastierend gegenübersteht. Eben dieser Kontrast, aber auch die Wechselseitigkeit des Lebens und des Wandels von Gut zu Schlecht werden durch viele antithetische Reime verdeutlicht. So wird auch besonders die Vergänglichkeit des Menschen in den Vordergrund gestellt, während der Kreislauf des Lebens eher hintergründig durch einige Metaphern als eine Art Hoffnung aufgeführt wird. Insgesamt unterstützt jedoch alles, wie auch das Reimschema die These, dass überall Vergänglichkeit enthalten ist und es nur eine Frage der Zeit ist bis Dinge vergehen.
Diana
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel ,,Es ist alles eitel“ und verfasst von Andreas Gryphius handelt es sich um ein Gedicht, welches im Jahr 1637 und somit der Zeit des Barocks zuzuordnen ist. Thematisch geht es in dem Gedicht um die Vergänglichkeit aller Dinge.
Das Gedicht besteht aus 14 Versen und 4 Strophen, wobei der Aufbau die eines Sonetts ist, da die ersten beiden Strophen aus jeweils 4 Versen bestehen und die letzten beiden Strophen aus je 3 Versen. Das Metrum ist ein 6-hebiger Jambus, wobei die Kadenzen abwechselnd betont und unbetont sind, und das Reimschema in den Quartetten ist ein umarmender Reim (abba, abba) und in den Terzetten liegt ein Schweifreim vor (ccd, eed).
Der Titel des Gedichts ,,Es ist alles eitel“ verdeutlicht bereits das Thema, dass alles vergänglich ist, wobei das Wort ,,alles“ die Verzweiflung des Lyrischen Ichs verdeutlicht, da nichts ewig bleibt und gleichzeitig auch hervorbringt, dass alles uns Bekannte und alles Existente vergänglich ist . Die Aussage ,,Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V.1) verdeutlicht ebenfalls die Vergänglichkeit, wobei das Lyrische Ich darüber klagt, dass überall ,,nur“ (ebd.) Vergänglichkeit zu finden sei, also, dass alles auf der Welt vergänglich ist und nichts ewig ist. Dabei spricht das Lyrische Ich auch den Leser an, indem er das Personalpronomen ,,du“ (ebd.) verwendet, wodurch zum Ausdruck gebracht wird, dass diese Vergänglichkeit auch einen selbst betrifft und dies somit ein Thema ist, welches alle betrifft. Durch die nächste Aussage ,,Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V.2) wird die Vergänglichkeit verbildlicht, wobei die Zeitangaben ,,heute“ (ebd.) und ,,morgen“ (ebd.) verdeutlichen, dass das was heute existiert in der Zukunft womöglich nicht mehr existiert, wobei die Zeitspanne dazwischen nicht immer lange ist, sondern Dinge schon bald vergänglich sein könnten. Die Verben ,,baut“ (ebd.) und ,,reißt […] ein“ (ebd.) stehen antithetisch zueinander und verdeutlichen, dass eben nicht nur Schlechtes vergeht, sondern auch Gute und Nützliche Sachen nicht für die Ewigkeit sind und eben auch diese vergehen. Auffällig in dieser Aussage sind aber vor allem auch die allgemeinen Formulierungen wie ,,dieser“ (ebd.) und ,,jener“ (ebd.), was zum Ausdruck bringt dass die Vergänglichkeit alles und jeden betrifft und somit auch auf alles übertragbar ist. Die Antithese dieser Aussage verdeutlicht auch den Kontrast des Daseins und der Vergänglichkeit und das eben aus diesen Dasein schnell Vergänglichkeit werden kann. Die nächste Aussage ,,Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein/ Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden“ (V. 3 f.) stellt eine Metapher dar, die ebenfalls die Vergänglichkeit verdeutlicht, aber auch eine Art Kreislauf der Vergänglichkeit und des Neubeginns. Dabei stehen die ,,Städte“ (ebd.) für das Existierende heute, welches nicht ewig ist und vergehen wird, wobei an Stelle dieser eben ,,eine Wiese“ (ebd.) sein wird, also etwas neues, welches den Platz des zuvor Existierenden eingenommen hat. Eben dieser Neubeginn des Kreislaufes wird durch die Metapher des ,,Schäferkind[es]“ (ebd.) verdeutlicht, da das Kind für neues Leben und des Anfangs steht. Somit wird durch diese Metapher deutlich, dass auch wenn alles vergänglich ist, es trotzdem einen Kreislauf gibt, der dafür einen Neubeginn sorgt. Auch das Nomen ,,Wiese“ (ebd.) steht für einen Neubeginn und Natürlichkeit, wobei das Nomen antithetisch zu dem Nomen ,,Städte“ (ebd.) steht, was ebenfalls die Vergänglichkeit und auch den Neubeginn verdeutlicht, da an Stelle der Stadt eine Wiese ist, die nicht von Menschen erschafft ist, wie die Stadt, sondern natürlich ist.
Das nächste Quartett beginnt mit der Aussage ,,Was jetztund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5), wobei diese Antithese ebenfalls die Vergänglichkeit untermauert. Dabei wird hier darauf angedeutet, dass das Schöne und Positive ebenfalls vergeht, was durch die Metapher ,,Was […] prächtig blüht“ (ebd.) verdeutlicht wird. Die Verzweiflung und resignative Haltung des Lyrischen Ichs wird durch das Verb ,,zertreten“ (ebd.) hervorgebracht, wobei das Lyrische Ich die Vergänglichkeit als etwas Negatives empfindet, da das Schöne, Blühende zerstört wird. Das Adverb ,,bald“ (ebd.) bringt ebenfalls die resignative Haltung und die Klage über die Vergänglichkeit zum Ausdruck, da das Lyrische Ich die Vergänglichkeit als kein entferntes Ereignis sieht, sondern glaubt, sich der Vergänglichkeit in naher Zukunft stellen zu müssen. Dies lässt sich auf die damalige Situation des 30-Jährigen Kriegs übertragen, da man sich der Vergänglichkeit stellen musst, da der Krieg alles zerstört hat. Dies wird auch durch die nächste Aussage ,, Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V. 6) auch verdeutlicht, da durch die Formulierung ,,pocht und trotzt“ (ebd.) deutlich wird, dass Menschen im Krieg gemeint sein könnten, die kämpfen und sich zu verteidigen versuchen. Das Verb ,,poch[en“ (ebd.) erinnert dabei an das menschliche Herz, wodurch also der Mensch und das Leben symbolisiert werde. Durch die Aussage, dass diese zu ,,morgen Asch und Bein“ (ebd.) sind, verdeutlicht die negativen Konsequenzen des Krieges, nämlich, dass Menschen sterben, wobei durch den Ausdruck ,,morgen“ (ebd.) ebenfalls hervorgebracht wird, dass dies bald wieder passiert, was somit die Verzweiflung und Resignation des Lyrischen Ichs zum Ausdruck bringt. Die Anapher der Aussage zuvor und dieser ,,Was jetzt“ (ebd.), bringt dabei hervor, dass das Vergängliche alles betrifft und über all anzutreffen ist. Weither hin wird durch die Aussage ,,Nichts ist, was ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein“ (V. 7) erneut die resignative Haltung des Lyrischen Ichs deutlich, da dieser die Vergänglichkeit über all sieht, was durch die Akkumulation ,,kein Erz, Kein Marmorstein“ (ebd.) wird. Außerdem wird dadurch hervorgebracht, dass auch die Erde vergänglich ist und somit nicht ewig bleibt, was die Klage des Lyrischen Ichs und die Resignation hervorhebt. Die Antithese ,,Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden“ (V.8) untermauert erneut, dass der heutige Zustand in der Zukunft weg ist, wobei die Zeitangaben ,,Jetzt“ (V.8) und ,,bald“ (V.8) ebenfalls die kurze Zeitspanne verdeutlichen, in dem das Heutige existiert und dass die Vergänglichkeit schneller kommt als man denkt. Die Personifikation ,,lacht das Glück uns an“ (V.8) untermauert dabei, dass das Lyrische Ich anklagt, dass sich sehr stark auf das Heutige konzentriert wird und dann vergessen wird, dass bald die Beschwerden ,,donnern“ (ebd.), wodurch auch eine gewisse Angst des Lyrischen Ichs vor der Zukunft verdeutlicht wird und auch die Verzweiflung über die Vergänglichkeit des Glückes. Das Personalpronomen ,,uns“ (ebd.) verdeutlicht, dass die Vergänglichkeit alle Menschen betrifft und das Thema somit sich auf jeden und alles übertragen lässt. Das Verb ,,donnern“ (ebd.) verdeutlicht metaphorisch, dass die ,,Beschwerden“ (ebd.) große Auswirkungen haben werden und die Menschen heftig überkommt. Dadurch wird dann auch erneut die Angst des Lyrischen Ichs vor dem Krieg und der Folgen deutlich, wobei das Verb ,,donnern“ (ebd.) auch mit Waffen und den lauten Geräuschen des Krieges assoziiert werden könnte. Das Metrum dieser beiden Quartette ist dabei regelmäßig und monoton, was ebenfalls die Aussage der immer wiederkehrende Vergänglichkeit und die Regelmäßigkeit des Lebens und des Sterbens untermauert, sowie die regelmäßigen Reime mit den Kadenzen ebenfalls die bestimmte Ordnung im Leben und die faktische Vergänglichkeit untermauert. Außerdem unterstützt die Zäsur zwischen These und Antithese den Gegensatz und führt somit den Inhalt auch besser vor Augen. Auffällig bei den Quartetten ist, dass diese eher die Vergänglichkeit des Erbauten, der Natur und der Menschen beschreibt, wohin gegen in den beide Terzetten eine Bewertung der Vergänglichkeit von dem Lyrischen Ich erfolgt.
Der erste Terzett beginnt dabei mit der Aussage ,,Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn“ (V.9), wobei dies aussagt, dass Ansehen zur Zeit des Krieges auch vergänglich war, da die Menschen in ständigem Bewusstsein lebten, dass der jeder Tag ihr letzter sein könnte. Durch den Vergleich mit dem Nomen ,,Traum“ (ebd.) wird deutlich, dass das Ansehen zwar gewünscht wird, aber nicht geschieht. Das Verb ,,muß“ (ebd.) drückt dabei aus, dass es davor keinen Ausweg gibt und die Vergänglichkeit sozusagen vorherbestimmt ist. Darauf folgt die rhetorische Frage ,,Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn?“ (V.10), welche aussagt, dass der Mensch nicht unsterblich ist und der Mensch der Vergänglichkeit nicht entfliehen kann. Die Metapher ,,Spiel der Zeit“ (ebd.) verdeutlicht dabei die Vergänglichkeit, die jeder Zeit eintreten kann, da durch den Krieg die Menschen ständig mit ihrem Tod rechneten und täglich Menschen starben. Auch das Adjektiv ,,leicht[.]“ (ebd.) führt vor Augen, dass der Mensch nicht lange Bestand hat auf der Erde und eben auch vergänglich ist. Die nächste Aussage wird durch die Interjektion ,,Ach“ (V. 11) eingeleitet, wobei hier die Verzweiflung und Resignation des Lyrischen Ichs vor Augen geführt wird. Des weiteren werden durch das Personalpronomen ,,wir“ (V.11) alle Menschen einbezogen in die Thematik, was verdeutlicht, dass die Vergänglichkeit alle betrifft und das Lyrische Ich auch dadurch sagt, dass alle Menschen das selbe ,,für köstlich achten“ (V.11). Dabei spezifiziert das Lyrische Ich dies in der nächste Terzette durch die Aussage ,,Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind“ (V.12), wobei die Akkumulation die Arten der Vergänglichkeit beschreibt, sodass dadurch ausgesagt wird, dass das Vergängliche über all zu finden ist. Die Nomen ,,Schatten, Staub und Wind“ (ebd.) akzentuieren dabei, dass das alles Irdische vergänglich ist und nicht mehr greifbar ist, sondern dass das Irdische einfach verschwindet. Die nächste Aussage ,,Als eine Wiesenblum, die man nicht mehr wieder find't!“ (V.13) beschreibt ebenfalls die Vergänglichkeit und schafft auch einen Bezug zu der Wiese, die in dem ersten Quartett beschrieben wird (vgl. V.3 f.) und zerstört somit das dort noch friedliche Bild von dem spielenden Schäferskind, da das Lyrische Ich sagt, dass man sie ,, nicht mehr wieder find't“ (ebd.) und somit alles vergänglich ist. Durch die letzte Aussage ,,Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten!“ (V.14) kritisiert und klagt das Lyrische Ich an, dass alle Menschen zwar die Vergänglichkeit erkennen, aber jeder vergisst was Ewig ist, wobei hier Gott gemeint sei könnte. Dabei sei zwar alles Irdische vergänglich, Gott jedoch sei ewig.
Zusammenfassend ist zusagen, dass das Lyrische Ich in den Quartetten die Vergänglichkeit des Irdischen beschreibt, indem es These und Antithese gegenüberstellt, also das noch Existierende und das dann Vergangene, wobei diese Gegenüberstellung durch das Metrum und die Zäsur untermauert werden. In den Terzetten äußert sich das Lyrische Ich hingegen eher bewertend. Insgesamt wird die Thematik der Vergänglichkeit durch Metaphern, Anaphern und allgemein gehaltene Formulierungen unterstützt.
Luisa
Das vorliegende Gedicht ,,Es ist alles eitel", welches von Andreas Gryphius im Jahre 1637 geschrieben wurde, in der Epoche des Barock, thematisiert die Vergänglichkeit alles Irdischen. Ursprung des Gedichtes war der 3O-Jährige Krieg. Das Gedicht besteht aus einer Sonettform, welche die charakterisierende Eigenschaft besitzt, dass das Gedicht in vier Strophen einteilt, jeweils zwei der vier Strophen bestehen sind vier versig und die darauffolgenden sind 3 versig. Das Metrum des Gedichts ist ein sechs-hebiger Jambus, was zudem durch das nicht durchgängig vorhandene Reimschema des Paarreims und zu Ende des Gedichtes des umarmendes Reims untermauert wird. Die sich abwechselnden betonten und unbetonten Kadenzen untermauert die Gefühle des Lyrischen Ichs.
Die Überschrift des Gedichtes ,,Es ist alles eitel" (Z.0) veranschaulicht das Thema des Gedichtes, über welches sich das Lyrische Ich beklagt. Die erste Strophe des Gedichts verdeutlicht die Erschaffung von neuen Dingen, die aber immer wieder vom Menschen selbst zerstört werden. Der erste Vers knüpft an die Überschrift an, denn das Lyrische Ich spricht den Leser direkt an, durch die Anapher ,,Du sieht, wohin du sieht" (V.1), welche den Leser indirekt kritisiert, da die Menschen zwar überall hinschauen, aber nichts hinterfragen. Denn der Mensch sieht ,,nur Eitelkeit auf Erden" (V.1), womit das Lyrische ich die Vergänglichkeit asoziiert. Die Erklärung der ,,Eitelkeit" ( V.1) folgt in dem nächsten Vers, denn ,,Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein" (V.2). Dieser Vers verdeutlicht die Vergänglichkeit durch die Zerstörung des Menschen, was vor allem durch die betonte Silbe am Ende, welche Brutalität untermauert, veranschaulicht wird. Des Weiteren wird diese Vergänglichkeit durchden nächsten Vers verbildlicht, denn ,,Wo jetztund ein Städte stehn, wird eine Wiese sein" (V.3). Vor allem die unbetonte Kadenz untermauert das friedliche und metaphorische Bild einer ,,Wiese" (ebd.). Die Wiese ,,auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden" (V.4) verkörpert den Rückgang der Entwicklung durch die Vergänglichkeit. Die betonte Kadenz bekräftigt das Klagen des Lyrischen Ichs.
Jan
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Es ist eitel“ von Andreas Gryphius, welcher im Jahre 1637 erschienen ist, handelt es sich um ein Gedicht. Zeitlich ist es der Epoche des Barocks zuzuordnen. Thematisch geht es um die Vergänglichkeit des irdischen und der Ewigkeit Gottes im Vergleich dazu.
Das vorliegende Gedicht besteht aus 14 Versen und ist es Sonett, denn es liegen zu Beginn zwei Quartette vor, worauf zwei Terzette folgen. Das Reimschema der Quartette ist umschließend, während das der Terzette aus Paarreimen besteht. Außerdem liegt ein sechs-hebiger Jambus vor.
Die Kadenzen sich weiblich.
Das zu analysierende Gedicht beginnt mit einem Quartett und bezieht sich direkt auf den Leser. „Du siehst , wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V.1) Das Personalpronomen „du“(ebd.) spricht den Leser direkt an und bezieht ihn in diese Aussage mit ein. Diese Aussage kritisiert die Erde bzw. die Menschen, die auf ihr leben, denn diese sind von „Eitelkeit“(ebd.) betroffen und kümmern sich dadurch nur um sich selbst, ohne sich für andere zu interessieren. Außerdem kritisiert er „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V.2). Damit meint er im Prinzip, dass es gutes und böses „auf Erden“(ebd.) gibt und dass es zwischen diesen beiden Parteien oft Konflikte gibt, da der böse Mensch, das vom guten Mensch erbaute einfach so zerstört. Außerdem verdeutlicht dies den ständigen Wandel der Welt und dass nichts ewig ist. Die folgenden beiden Verse „Wo jetztund Städte stehen, wird eine Wiese sein, / Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden“ (V.3f.) verdeutlichen diesen Wandel. Aus Städten werden Wiesen und aus Wiesen werden Städte, die Umgebung wandelt sich ständig. Außerdem werden in diesen Versen Gegensätze gegenübergestellt, wie z.B. „dieser“(ebd.) und „jener“(ebd.), „Städte“(ebd.) und „Wiese“(ebd.) oder „baut“(ebd.) und „reißt […] ein“(ebd.).
Im zweiten Quartett fährt Gryphius damit fort von Gegensätzen zu reden : „Was jetzt prächtig blüht, soll bald zertreten werden; / Was jetzt so pocht und trotz, ist morgen Asch und Bein“ (V.5f.). Das prächtig blühende vertritt dabei das Gute, während das Zertreten das Böse vertritt. Außerdem vergleicht er wiederholt die Gegenwart mit der Zukunft, durch Adverben wie „jetztund“(ebd.), „bald“(ebd.), „jetzt“(ebd.) oder „morgen“(ebd.). Er schließt das Quartett mit den Worten „Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. / Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden“ (V.7f). Damit unterstreicht er zum einen die Vergänglichkeit der Erde / des Lebens und führt vor Augen, dass die Zukunft sehr viel negativer als die Gegenwart sein wird. Dabei benutzt er erneut Adverben wie „jetzt“(ebd.) und „bald“(ebd.), um zwischen Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden.
Nina K.
Andreas Gryphius Gedicht „Es ist alles eitel“, veröffentlicht im Jahr 1637 in der Zeit des Barocks sowie während des 30-jährigen Kriegs, thematisiert die Vergänglichkeit alles Irdischen.
Der Vers „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V.1) der ersten Strophe (V.1-4), deutet die Thematik des Gedichts schon in Ansätzen an. Mit der Wiederholung „du siehst“ (ebd.) wird betont, dass egal wohin ein jemand schauen mag, er Eitelkeit entdecke. Dass diese benannte Eitelkeit allumgreifend und wirklich überall zu finden ist, wird dadurch sowie durch die Benennung der „Erde […]“ (ebd.) hervorgehoben. Auf diese Nichtigkeit wird in darauffolgenden Vers vom lyrischen Ich ausgeführt. Die Pronomen „dieser“ (V.2) und „jener“ (V.2) untermauern dies, da sie offen und verallgemeinernd für jede beliebige Person stehen und dadurch den Aspekt bekräftigen, dass genannte Eitelkeit tatsächlich überall auf der Welt und bei jeder Person zu finden sei. Auf die Rolle des Menschen wird in diesem Kontext näher eingegangen, in dem besagt wird, „[w]as dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V.2). Hier wird der Aspekt der Vergänglichkeit angerissen und gleichzeitig, wie sich der Mensch in Bezug auf dieser verhält. So bauten Menschen Dinge auf, um sie in der Zukunft wieder zu zerstören. „[M]orgen“ (Z.V.2) steht hierbei repräsentativ für einen ungewissen Zeitraum während der Entwicklung des Menschen. Er wird also besagt, dass alle Menschen die Fähigkeit besitzen Dinge aufzubauen, jedoch auch, dass sie irgendwann während ihrer Entwicklung das Gebaute wieder zerstören, um neues darauf zu erbauen. Außerdem ist hier von zwei unterschiedlichen Personen die Rede, einmal „dieser“ (ebd.) und einmal „jener“ (ebd.), wobei der eine erschafft und der andere es zerstört. Es kann also ebenfalls gesagt werden, dass die Menschen aneinander vorbei leben und nicht respektieren, was ihr Vorgänger mit Fleiß und Arbeit erschaffen hat. Im darauffolgenden Vers wird der unkonkrete Inhalt mit einem Beispiel deutlicher. Denn „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V.3) spricht abermals an, dass Menschen Dinge bauen und sie danach wieder dem Anfang gleich machen, da jede Stadt mit einem leeren Grundstück oder einer Wiese begonnen hat. Dieser Prozess mache die Dinge nicht nur vergebens, sondern hebe auch die Vergänglichkeit der Welt hervor. Der letzte Vers der Strophe „Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden“ (V.4) deutet eine Wiederentstehung des Zerstörten an. Denn Kinder stehen symbolisch für den Anfang eines neuen Lebens, sowie auch Schafe und ihre Herden an Leben erinnern. Im Zusammenhang mit den Versen zuvor verdeutlicht dies einen gewissen Kreislauf des Lebens an, an dessen Anfang der Mensch steht, der etwas erschafft und das Erschaffene im Laufe der Zeit wieder zerstört, um danach wieder neues zu bauen. Dieser Kreislauf zeigt gleichzeitig, dass alles von Menschen gemachte zwangsweise vergänglich sei. Die erste Strophe des Sonetts ist ein Alexandriner, der nicht nur typisch für die Zeit des Barocks ist, sondern auch die Regelmäßigkeit die Vorhersehbarkeit des Kreislaufes des Bauens und Zerstörens verkörpert. Zudem handelt es sich um einen umschließenden Reim, der in Vers zwei und drei mit weiblichen, also unbetonten Kadenzen endet, und in Vers eins und vier mit männlichen, die die These, dass alles Irdische letztendlich vergeht, verhärtet und betont, dass es sich hierbei um einen Fakt handele. Die häufig wieder zu findenden Zäsuren, wie beispielsweise im Satz „Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein;“ (ebd.), spalten den Satz nicht nur formal, sondern auch inhaltlich in These und Antithese.
In der zweiten Strophe (V.5-8) wird, an den Versen „Was jetzund prächtig blüht soll bald zertreten werden;/Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V.4f.) zu erkennen, die Zukunft und die Gegenwart antithetisch gegenüber gestellt, sodass das Erschaffene und das Zerstörte vergleichend gegenüber steht und der Aspekt der Vergänglichkeit in den Fokus gerückt wird. Dieser ist im Verb „blühen“ (ebd.) zu erkennen, da Blumen bzw. Pflanzen die Eigenschaft haben zu blühen und diese ebenfalls nicht ewig halten. „Asch und Bein“ (ebd.) erinnert an das Ende eines Menschenlebens, das im Kontext der Zeit des Gedichtes eine bedeutendere Rolle spielt. Da das Gedicht zur Zeit des 30-jährigen Kriegs veröffentlicht und wahrscheinlich auch verfasst wurde, kann man sagen, dass „Asch und Bein“ (ebd.) auf die zahlreichen Toten während des Krieges zurückzuführen ist und dass die Vergänglichkeit dem lyrischen Ich in vor allem so einer Zeit deutlicher vor Augen geführt wird. Im darauffolgenden Vers ist zu erkennen, dass Gryphius selbst in „Erz und Marmorstein“ (V.7) keine Ewigkeit findet, was nochmals verdeutlicht, das wirklich „(n)ichts“ (V.7) ewig ist und dass alles im Laufe der Zeit vergeht, da man zu dieser Zeit davon ausging, dass Gestein unzerstörbar sei. Mit dem Vers „Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden“ (V.8) wird auf der einen Seite ausgesagt, dass das Leben sowohl gute, also vom „Glück“ (ebd.) geprägte Zeiten hat, aber auch gegenteilige Zeiten, in denen die Menschen unzufrieden sind. Die Personifikation „Jetzt lacht das Glück uns an“ (ebd.) deutet an, dass Menschen sich gegenseitig Glück bescheren können. Jedoch zeigt der Vers ebenfalls wie die eine Seite zur anderen wechseln kann und dass selbst ein Gefühl, egal ob es positiv oder negativ ist, vergänglich ist und wechseln kann. Dieser schnelle Wechsel wird wieder durch die Gegenüberstellung von „jetzt“ und „bald“ (ebd.) deutlich.
Der zweite Teil des Sonetts, bestehend aus zwei Terzetten, unterschiedet sich inhaltlich vom ersten Teil. So drehten sich die Quartette um eine Art beschreibende Perspektive des lyrischen Ichs, während sich der folgende Teil mit der näheren Sichtweise des lyrischen Ichs beschäftigt. Dessen Position bezüglich der Vergänglichkeit alles Irdischen lässt sich aus der Struktur der Quartette bereits in Ansätzen erahnen. Auf die Anführung des positiven, wie die das „jetzund prächtig blüht“ (ebd.), folgt die Prognose von etwas, das das Gute nichtig macht, wie „soll bald zertreten werden“ (ebd.). Diese Ersetzung durch das Schlechte lässt erahnen, dass das lyrische Ich der Vergänglichkeit eher klagend gegenübersteht. Der Vers „Der hohe Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn“ (V.9) geht auf eine andere Art der Vergänglichkeit ein, indem angesprochen wird, dass der gute Ruf und die Anerkennung, die daraus resultiert, ebenfalls vergänglich sind. Ruhm und Anerkennung äußern sich als sofern nützlich, dass man sich dadurch als Person in der Gesellschaft Vorteile versprechen kann. Ausnahmezeiten wie die des Krieges entkräften jedoch den Nutzen von Ruhm, da dort jeder für sich selbst kämpft, sodass selbst dieser vergänglich und wertlos wird. Dieser Aspekt wird dem des Traumes gegenübergestellt, der wie ein Gedanke, eine Erinnerung oder eine Idee urplötzlich in den Kopf eines Menschen kommen kann, aber auch in sekundenschnelle verfliegen kann. Mit dem „Spiel der Zeit“ (V.10) wird erstmals ein Aspekt angedeutet, der im Gegensatz zu allem aufgelisteten ewig ist, nämlich die Zeit. Hier wird angedeutet, dass der Zeit gegenüber „der leichte Mensch“ (V.10) stünde. Es ist festzustellen, dass die Existenz des Menschen abhängig von der Zeit ist und dass er gegen die Zeit spielt, mit seinem ständig bestehenden inneren Wunsch nach einem möglichst langen Leben, der auch ein Instinkt oder eine Angst sein kann. Mithilfe der Interjektion „Ach“ (V.11) lässt sich wieder die Position des lyrischen Ichs feststellen, die im Zusammenhang mit „was ist alles dies, was wir für köstlich achten“ (V.11) als klagend und unzufrieden beschrieben werden kann. Zudem lässt sich daraus schließen, dass er aufgrund des Zustands der Vergänglichkeit alles köstliche, also alles schöne und genießbare im Leben in Frage stellt. Dies wird auch im Zusammenhang mit der „schlechten Nichtigkeit“ (V.12), verglichen mit „Schatten, Staub und Wind“ (V.12) deutlich. Die Akkumulation dient wieder als Vergleich für weitere vergängliche Dinge im Leben, da ein Schatten mit der Sonne geht, Staub sich auflöst und ein Wind abebben kann. Diese Beispiele verdeutlichen Flüchtigkeit und zeigt damit auf, dass einige Dinge langsam vergehen, und dass andere auf den anderen Moment verschwinden. Eine weitere Metapher für die Vergänglichkeit bietet der Vers „Als eine Wiesenblum, die man nicht wieder find´t!“ (V.13), der als Ausruf formuliert ist und somit die Bestürzung des lyrischen Ichs verdeutlicht. Im letzten Vers findet das lyrische Ich etwas anderes das ewig weilt, was indirekt mit „Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten“ (V.14) angeführt wird. Da, wie das lyrische Ich es heraus gestellt hat, alles Irdische vergänglich ist, muss das Überirdische, also etwas göttliches ewig sein. Er kommt also zu dem Schluss, dass nichts was wir als Mensch auf der Welt kennen ewig weilen wird und zieht daraus den Schluss, dass Gott das einzig ewig der Welt sei und dass niemand menschliches, der noch lebt, je das Ewige sehen könne. Jedoch wird auch angeführt, dass dies kein Mensch betrachten wolle und drückt damit das Desinteresse der Menschen dem gegenüber aus.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Sonett die Thematik, dass alles Irdische vergänglich sei, im ersten Vers als These anführt, und dann zahlreiche metaphorische Beispiele dafür nennt. Dabei unterstützt das Alexandriner Metrum die wiederholend auftretende Gegenüberstellung von These und Antithese. Zudem wird deutlich, dass der Mensch sich in einem Kreislauf aus Zerstörung und Neuerschaffung befindet. Außerdem sind in den Quartetten umarmende Reime vorzufinden und in den Terzetten ein Schweifreim. Darüber hinaus wird er Standpunkt des lyrischen Ichs in Bezug auf die Vergänglichkeit deutlich, der sich als unzufrieden und klagend äußert. Zum Schluss wird angeführt, dass das einzig wahre Ewige Gott sei und dass die Menschen nicht in der Lage dazu seien das Ewige zu erkennen und zu schätzen.
Maike
Das vorliegende Gedicht „Es ist alles eitel“, geschrieben von Andreas Gryphius und veröffentlicht, thematisiert einen kritischen Blick auf die Welt.
Das Gedicht hat vier Strophen. Strophe eins und zwei haben jeweils vier Verse, die Strophen drei und vier haben jeweils drei Strophen. Das vorliegende Metrum ist ein sechs-hebiger Jambus, das Reimschema, ein umarmender Reim. So wird klar, dass nach jeder Strophe ein Abschluss ist, da dieses Reimschema als Rahmen dient.
Die erste Strophe dient als Einleitung, das Grundproblem, die „Eitelkeit auf Erden“ (V.1) wird dargelegt. Mit Hilfe der Repetitio „siehst“ (V.1) wird deutlich verstärkt, dass überall auf der Welt nur Eitelkeit zu finden ist (vgl. V.1). Im weiteren Verlauf der Strophe wird klar gestellt, dass die Menschen gegeneinander arbeiten, da der eine „heute [etwas] baut“ (V.2), aber der andere es morgen wieder zerstört (vgl. V. 2). Jetzt kommt eine positive Äußerung, da gesagt wird, dass dort „wo jetzund Städte stehn , […] eine Wiese sein [wird]“ (V.3), dies wird durch die Alliteration „Städte stehn“ (V. Ebd.) noch einmal verstärkt dargestellt. Es folgt ein Enjabement , wodurch ein Zusammenhang deutlich wird, da dort die Rede von „Schäferskind[ern]“ (V.4) ist, welche auf der „Wiese“ (V.3) mit den Schafsherden spielt (vgl. V. 4).
In der zweiten Strophe ist von der Zerstörung, vor Allem in der Pflanzenwelt die Rede. Beispielsweise schreibt Gryphius, „was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V.5). Er stellt außerdem durch „jetzund“ (V. 3,5) eine Verbindung zur vorherigen Strophe hergestellt. Vers 5 und 6 sind im Übrigen durch die Anapher „Was“ (V.5,6) verbunden. Zusammenfassend sagt der Autor, das Glück lache uns nun an, bald würden allerdings die Beschwerden donnern (vgl. V. 8).
Janette
Das vorliegende Naturgedicht „Es ist alles eitel“ wurde von Andreas Gryphius 1637 in der Epoche des Barocks verfasst und thematisiert das Sterben alles irdischen.
Das Gedicht ist eine Sonett, da die beiden ersten Strophen vierzeilig sind und die letzten beiden Strophen dreizeilig sind. Das Reimschema lautet abba abba ccd eed. Somit liegt in den ersten beiden Strophen ein umarmender Reim vor und die letzten beiden beginnen mit einem Paarreim aber enden schließlich mit einem Schweifreim. Zudem ist das Metrum des Gedichts ein sechshebiger Jambus mit weiblichen und männlichen Kadenzen.
Zu Beginn wird von dem lyrischen Ich die These aufgestellt: „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V. 1). Somit wird direkt einen Bezug zum Titel geschaffen, „nur Eitelkeit auf Erden“ (ebd.) herrscht. Das Repetition „du siehst“ (ebd.) bestärkt zudem die Vergänglichkeit der Erde und somit allem Irdischen, stellt jedoch auch zugleich eine Ansprache an den Leser, um deutlich zu machen, dass die Situation unumgänglich ist. Hier wird zudem Bezug zum 30 jährigen Krieg genommen, in diesem Kontext ist jedoch „nur Eitelkeit auf Erden“ (ebd.) eine Hyperbel, welche verdeutlichen soll, welches Elend die Leute ausgesetzt waren und diese keinen Ausweg hatten. Weitergehend wird eine Antithese „[w]as dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V. 2) aufgestellt. Durch das Metrum, der sechshebige Jambus, werden die These und Antithese gegenübergestellt, was durch die Zäsur, also dem Einschnitt hervorgehoben wird. So wird verdeutlicht, dass nichts Bestand hat und all das was man sich aufgebaut hat am nächsten tag nicht mehr da sein kann. Dies wird auch im darauffolgenden deutlich: „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3). Auch dieser Satz ist antithetisch. „Städte“ (ebd.) stehen jedoch hierbei metaphorisch für das Leben der Menschen, da sie dort ihren Wohnort haben, ihr zu Hause finden und ihre Existenz. Somit ist zu sagen, dass das Leben ebenfalls vergänglich. Untermauert wird dies durch die männlichen Kadenzen des Paarreims, da diese einen Schluss setzten und somit auch mit dem Tod assoziiert werden können. Der letzte Vers des ersten Quartetts steht jedoch im Kontrast zu den anderen Versen. Das „Schäferskind“ (V. 4) bringt eine friedliche Stimmung herbei. Da dieses „wird spielen mit den Herden“ (V. 4) wird ein glücklicher Moment geschildert, welcher jedoch als Wunschvorstellung angesehen werden kann, da ein Kontrast zu den anderen Versen gesehen werden kann.
Zu Beginn des zweiten Quartetts wird die Nichtigkeit der Natur zum Vorschein gebracht: „Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5). Somit ist dass harmonische Bild des Schäferskind zerstört, so sei alles vergänglich. Allerdings wird nicht nur ausgesagt, dass die Natur vergänglich sei, sondern auch der Mensch, was im darauffolgenden deutlich wird. So heißt es: „Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V. 6). Sowohl „pocht“ (ebd.) als auch „trotzt“ (ebd.) sind Merkmale des Menschen oder auch der Tiere. Beide Gruppen besitzen ein pochendes Herz und beide können Widerstand leisten. Die Metapher „Asch und Bein“ (ebd.) verkörpert somit den Todesgedanken aller Lebewesen die Knochen besitzen. Die Anapher „[w]as“ (ebd.) leitet die antithetischen Verse ein, was eine Verbindung zu den Versen schafft. Zuerst wurde die Vergänglichkeit der Natur angesprochen und danach das Leben von Mensch und Tier, was verdeutlichen kann, dass fernab kein Leben existieren kann. Im nächsten Vers wird zudem erneut auf die Natur eingegangen, so sei „kein Erz, kein Marmorstein“ (V. 7) zerstörbar. Diese Naturalien galten jedoch zur Zeit des 17. Jahrhunderts als unzerstörbar. Allerdings ist auffallend, das alles geschilderte Vergänglichkeit zum Ausdruck bring, so muss es auch mit unzerstörbar geglaubten Utensilien sein da des Rhythmus des Jambus keine Änderung hervorruft. Somit herrscht im gesamten Sonett eine monotone Stimmung. Die Personifikation „lacht das Glück“ (V. 8) akzentuiert die Vorstellung, wie das Leben sein sollte. Jedoch ist diese Vorstellung direkt verworfen, da „bald donnern die Beschwerden“ (V. 8). Diese Synästhesie umfasst die Sinnesreize des hören und fühlen, was das Leiden der Menschen im Krieg unterstreichen soll. Das Personalpronomen „uns“ (V. 8) verallgemeinert zudem die Situation und stellt somit keine Unterscheidung an, was erneut die Aussichtslosigkeit des Krieges verdeutlicht.
In den Quartetten wird eine beschreibende Perspektive geschildert, jedoch jetzt im Wechsel zu den Terzetten wird eine bewertende Haltung des lyrischen Ichs eingenommen. Dieser Perspektivwechsel wird vor allem durch die Interpunktionen am Ende der Verse deutlich, so wird neben einem Fragezeichen (vgl. V. 10) auch Ausrufezeichen (vgl. V. 13-14) verwendet. „Der hohe taten Ruhm“ (V. 9) ist erneut eine Wunschdenken, da zur Zeit des Krieges kein Ruhm vorhanden war. Alle Menschen die zuvor Geld besaßen und reich waren, waren auf Grund des Krieges arm und mittellos. Aus diesem Grund wird auch diese Vorstellung „wie ein Traum vergehn“ (V. 9), was erneut antithetisch zu dem beginn des Verses steht. Das „Spiel der Zeit“ (V. 10) verdeutlicht, dass das Leben im Krieg jeder Zeit zu Ende sein könnte, da jedes Spiel irgendwann einen Gewinner hat und damit endet. Allerdings ist die Zeit unendlich und der Mensch vergänglich, somit ist klar, dass dem menschlichen Leben jederzeit das Ende gesetzt sein kann. Da es sich um eine rhetorische Frage handelt, wird die Resignation des lyrischen Ichs kund gegeben. Weitergehend wird die Resignation in der Interjektion „[a]ch“ (V. 11) fortgeführt. Somit ist „alles dies, was wir für köstlich achten“ (V. 11) von keiner Bedeutung, da sowieso alles vergänglich ist.
Lara
Das vorliegende Gedicht „Es ist alles Eitel“, welches 1637 veröffentlicht und von Andreas Gryphius zur Zeit des Barocks geschrieben wurde, thematisiert die Begrenztheit auf Erden sowie die Bedeutungslosigkeit des irdischen Lebens.
In der ersten Strophe beschreibt Andreas Gryphius die Vernichtung sowie Zerstörung der Städte. In der zweiten Strophe befasst er sich mit dem Ereignis, dass hinzukommend auch das ganze Schöne auf Erden zerstört werde. In der dritten Strophe wird die Frage aufgeworfen wie ein Mensch solch ein Leben überhaupt bewältigen solle. Die vierte und letzte Strophe gibt auf diese Frage Auskunft.
Das Gedicht setzt sich aus vier Strophen zusammen, von denen die ersten beiden aus jeweils vier Versen und die letzten beiden aus jeweils drei Versen bestehen. In dem vorliegenden Gedicht bilden die Verse in den ersten beiden Strophen das Reimschema abba, abba. Damit handelt es sich bei diesen zwei Strophen um einen umarmenden Reim. Die letzten beiden Strophen weisen das Reimschema ccd, eed auf, wobei es sich dabei um einen Schweifreim handelt. Das Metrum des Gedichts ist ein sechshebiger Jambus und es treten abwechselnd männliche sowie weibliche Kadenzen auf.
In der ersten Strophe wird zunächst die These „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V. 1) aufgestellt. Dabei möchte das lyrische Ich den Leser durch die persönliche Ansprache „Du“ (ebd.) darauf aufmerksam machen, dass das ganze irdische Leben vergänglich sei und egal wo man hinschaue, die Vergänglichkeit nicht zu übersehen sei (vgl. V. 1). Somit wird im ersten Vers die Überschrift des Gedichts noch einmal aufgegriffen. In den darauffolgenden Versen wird die eben genannte These mit Beispielen belegt. In Bezug darauf beschreibt das lyrische Ich „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V. 2). Um diese Aussage zu veranschaulichen nennt das lyrische Ich das Beispiel „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3). Diese beiden Verse sind antithetisch aufgebaut und machen deutlich, dass das Schöne auf der Erde nicht lange anhält sondern nach kurzer Zeit zerstört werden kann. In Vers zwei stehen sich die beiden Wörter „heute“ (ebd.) und „morgen“ (ebd.) antithetisch gegenüber und in Vers drei die Nomen „Städte“ (ebd.) und „Wiese“ (ebd.). Durch die Verben „bauen“ und „einreißen“ wird erneut die oben genannte Zerstörung hervorgehoben und eine Verbundenheit mit Krieg hervorgerufen. An das Beispiel im dritten Vers knüpft der vierte Vers nahe liegend an. In diesem Vers ist zum wiederholten male die Rede von der Wiese, „auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden“ (V. 4). In diesem Vers wird durch die Metapher „Schäferskind“ (ebd.) eine friedliche Stimmung und somit eine Assoziierung mit Frieden herbeigeführt. Somit steht dies im Gegensatz zu der eben erwähnten Zerstörung im dritten Vers.
Christine
Das Gedicht „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius, welches im Jahr 1637, in der Epoche des Barocks, verfasst wurde, thematisiert die Vergänglichkeit alles Irdischen und historisch gesehen die Zerstörungen, die aus dem 30- jährigen Krieg resultierten.
Der Titel „Es ist alles eitel“ verweist auf das Thema des Gedichts, dass alles vergänglich ist und irgendwann nicht mehr existieren wird. Das Pronomen „alles“ (ebd.) steht verallgemeinernd dafür, das jedes Lebewesen, jeder Gegenstand, aber auch bestimmte Situationen nicht ewig sind und irgendwann nicht mehr existieren. Das Gedicht besteht aus 14 Versen, welche in insgesamt vier Strophen eingeteilt sind. Die ersten beiden Strophen bestehen jeweils aus vier Versen, werden somit jeweils als Quartett bezeichnet, und die letzten beiden jeweils aus drei Versen und werden somit jeweils als Terzett bezeichnet. Als Versmaß ist durchgängig ein sechshebiger Jambus vorzufinden, was ein Merkmal der literarischen Epoche des Barocks war und als Alexandriner bezeichnet wird. Die erste Strophe beginnt mit dem Personalpronomen „du“ (V.1), was einen Bezug zum Leser herstellt, ihn also direkt anspricht bzw. ihn direkt mit einbezieht. Die Repetitio „siehst“ (V.1) betont, dass die „Eitelkeit auf Erden“ (V.1) nicht zu übersehen ist. Die „Eitelkeit auf Erden“ (ebd.) bezieht sich auf den Titel des Gedichts und deutet auf die Vergänglichkeit des Lebens hin. Die Tatsache, dass die Vergänglichkeit des Lebens, also das Sterben, das Leid und die Tode, nicht zu übersehen ist, bringt gleichzeitig eine Klage über die derzeitigen Ereignisse, den 30- jährigen Krieg, mit sich. Im nächsten Vers ist davon die Rede, dass das, was heute gebaut werde, morgen wieder zerstört sei (vgl. V. 2). Die Adverbien „heute“ (V. 2) und „morgen“ (V. 2)und die Verben bauen (vgl. V. 2) und einreißen (vgl. V. 2) stehen sich antithetisch gegenüber und verdeutlichen, dass der derzeitige Zustand nicht von Dauer ist und am nächsten Tag oder sogar schon in den nächsten Stunden alles anders sein kann. In dem Zusammenhang ist es der Krieg, der für die Zerstörung sorgt. Eine weitere Antithese ist im nächsten Vers zu finden. „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3), verdeutlicht wieder die Zerstörung der Dinge des derzeitigen Zustands und die Veränderung, die im zukünftigen Zustand herrscht. Die „Wiese“ (ebd.), kann man als ein Symbol für Frieden interpretieren, da es in Städten meistens laut und hektisch ist und auf Wiesen bzw. in der Natur eher Ruhe herrscht. Die zweite Strophe setzt zunächst mit einer Antithese „Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V. 5) ein. Das Verb „blühen“ (ebd.) kann man so interpretieren, dass etwas, sei es ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze, gedeiht und lebt. Dadurch, dass es „zertreten [wird]“ (ebd.), wird das Leben beendet. Somit wird metaphorisch die Vergänglichkeit des Lebens dargestellt. Im nächsten Vers wird antithetisch dargestellt, dass „was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein“ (V. 6). Das Verb „pochen“ (ebd.) steht metaphorisch für einen Herzschlag, also für etwas lebendiges. Die Metapher „Asch und Bein“ (ebd.) steht für den Tod. Mittels dieser Antithese wird wieder deutlich gemacht, dass das Leben nicht ewig ist und es „morgen“ (ebd.) vorbei sein könnte. Darauf eingehend ist davon die Rede, dass „Nichts […] ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein“ (V. 7). Die Aufzählung „kein Erz, kein Marmorstein“ (ebd.) betont, dass „nichts“ (ebd.), selbst beständige Gesteine wie Erz und Marmor, für immer existieren werden. Im letzten Vers veranschaulicht die Personifikation 'das lachende Glück' (vgl. V. 8), dass, in diesem Zusammenhang gesehen, die Zeiten vor dem Krieg mit besseren Erinnerungen in Verbindung gebracht werden und man Vorstellungen hat, dass das Leben ohne das Leid, das der Krieg mit sich bringt, bessere wäre. Als Folge würden „bald […] die Beschwerden [donnern]“ (V. 8), was den Unmut und das Verlangen nach Frieden betont. Zum Reimschema der ersten beiden Strophen kann man sagen, dass es sich bei beiden jeweils um einen umarmenden Reim handelt. Die dritte Strophe wird sozusagen mit dem Appell „Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehen“ (V. 9) eingeleitet. Es wird betont, dass Rum nicht das wichtigste im Leben ist, da er schnell wieder vergehen kann. Die darauf folgende rhetorische Frage „Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehen?“ (V. 10) stellt mittels der Metapher „Spiel der Zeit“ (ebd.), was für die Lebenszeit steht, dar, dass diese für den Menschen begrenzt ist. Die Interjektion „Ach“ (V. 11) betont die Zweifel, die beim lyrischen Ich aufkommen. Es fragt anschließend „was ist alles dies, was wir für köstlich achten“ (V. 11). Dadurch wird deutlich, dass nicht die wichtigen Dinge im Leben, wie z.B. der Ruhm, geschätzt werden sollten, da diese ja vergänglich sind und eigentlich keinen Wert haben. Ein Enjambement verbindet schließlich die dritte mit der letzten Strophe, in der weiter auf die Frage eingegangen wird. Hier wird betont, dass das, was man als wichtig erachtet nichts „als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, / als eine Wiesenblum, die man nicht wieder find't“ (V. 12f.) sei. Die „Nichtigkeit“ (ebd.), also die Irrelevanz der Dinge, die man vermeidlich als wichtig empfindet, wird durch die Akkumulation „Schatten, Staub und Wind“ (ebd.) betont. Ein Schatten ist vom Sonnenstand abhängig, Staub kann so klein sein, dass man ihn gar nicht bemerkt und der Wind weht nicht konstant. Auch die Veranschaulichung durch die „Wiesenblum, die man nicht wieder find't“ (ebd.) betont auch die Irrelevanz. Denn eine bestimmte Blume kann man auf einer Wiese mit tausend anderen Blumen nur schwierig wiederfinden. Im letzten Vers beklagt sich das lyrische Ich, dass das, „was ewig ist, kein einig Mensch betrachten [will]“ (V. 14). Die meisten Menschen erkennen also noch nicht, was zu den wichtigen Dingen im Leben gehört und dass an zu vielen unnötigen Dingen, wie z.B. Krieg, festgehalten wird.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass in dem Gedicht durch Antithesen und Metaphern die Vergänglichkeit alles Irdischen verdeutlicht wird. Anschließend wird die Frage gestellt, ob das, was der Mensch als wichtig betrachtet, die Mühe wert ist.