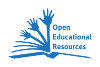Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Gryphius
Es ist alles Eitel
Analyse eines Gedichtes
Vorbereitung: mehrmaliges Lesen und Bearbeiten des Textes (Wichtiges markieren, notieren, gliedern, usw.)
1. Einleitung
• Themasatz: Textart (Natur-, Liebes-, politisches Gedicht, usw.), Titel, Dichter, ev. Entstehungszeit, Epoche; Thema
2. Hauptteil
Inhaltliche, formale und sprachliche Analyse • Gliederung in Sinnabschnitte, deren Funktionen • Darstellung und Deutung exemplarischer Textstellen inhaltlich (Was wird aus-gesagt und was bedeutet das?), sprachlich (Wie wird es ausgesagt und was bedeutet das? - sprachliche Mittel) und formal (Strophen, Reimschema, Metrum, Interpunktion, Enjambement, Wortwahl, usw.) • Wechselbeziehungen zwischen Inhalt, Sprache und Form • eventuell Berücksichtigung des gesellschaftlich-historischen, biografischen, usw. Kontextes, der Position und Perspektive des lyrischen Ich • korrekte Zitierweise • Textintentionen
3. Schluss
• Zusammenfassung der wesentlichen Analyseergebnisse
Anne
Das Sonett "Es ist alles eitel" geschrieben von Andreas Gryphius und veröffentlicht 1637,, zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, thematisiert die Vergänglichkeit alles Irdischen.
Das Gedicht besteht aus vier Strophen, wobei die ersten zwei Strophen vier Verse enthalten und die letzten zwei drei Verse. Die ersten beiden Strophen sind als umarmender Reim aufgebaut und die letzten Beiden beginnen jeweils als Paarreim, wobei der dritte Vers eine Verbindung zur jeweils anderen Strophe schafft. Außerdem enthält das Gedicht einen sechshebigen Jambus.
Das Sonett beginnt im ersten Vers mit einer Art Einleitung, indem das Thema der Vergänglichkeit, hier "Eitelkeit"(V.1) genannt, direkt angesprochen wird und ein Bezug zur Überschrift geschaffen wird. Mit der Repetitio des Wortes "sihst"(V.1) verdeutlicht Gryphius, dass man, egal wohin man sieht, nichts ewiges finden kann. Man findet lediglich "Eitelkeit auf Erden"(V.1). Die Verwendung des Substantivs "Erden"(ebd.) spezifiziert den Raum in dem man nur Vergängliches sieht. Durch diese Spezifizierung macht Gryphius erkennbar, dass es sich nur um Irdisches Handelt. Er impliziert so direkt zu Beginn des Gedichts, dass sich Ewiges im Übernatürlichen bzw. Göttlichen finden lässt. Im Folgenden ist das Gedicht sehr von Antithesen geprägt. In Vers zwei stehen die beiden Verben "reist"(V.2) und "baut"(V.2) direkt hintereinander und sind lediglich von einem Spiegelstrich getrennt. Durch diesen Chiasmus wird die Differenz zwischen dem "heute"(V.2) und "morgen"(V.2) untermauert und somit Gryphius' These, die Erde sei vergänglich, unterstützt. Auch Vers 3, der als Anapher eine Verbindung zu Vers 2 schafft, da sie beide Beispiele für Vergänglichkeit liefern, besteht aus einer Antithese. hier wird aufgezeigt, dass aus "Städten"(V.3), die heute existieren in Zukunft "Wiesen"(V.3) werden können. Das Wort "itzund"(V.3) begegnet einem folgend häufiger und beschreibt immer den Gegenwartszustand. Durch den vierten Vers wird noch einmal der Unterschied zwischen verschieden Zeiten hervorgebracht, indem "ein Schäferskind"(V.4), das "mit den Herden"(V.4) spielt, den "Städten"(ebd.) gegenübergestellt wird.
In dem ersten Vers der zweiten Strophe wird die Vergänglichkeit der Pflanzen angesprochen. Diese blühen noch in der Gegenwart, was wieder von "itzund"(V.5) signalisiert wird. Dass diese zertreten werden "sol[len]"(V.5) zeigt, dass diese in keinem Fall ewig bleiben. Im nächsten Vers wird die Vergänglichkeit des Menschen erläutert. Dies ist an der Metapher "pocht und trotzt"(V.6) erkennbar, da diese zum einen für das pochende Herz des Menschen steht, dem Menschen aber auch die Fähigkeit zuspricht zu trotzen, sodass die Annahme, ein Tier könnte gemeint sein, verworfen werden kann. Mit "Asch vnd Bein"(V.6) ist das, gemeint, was vom Körper nach dem Tod noch übrig bleibt gemeint. Gryphius kommt also zu dem Schluss dass der Mensch ebenso vergänglich ist wie alles andere und sich in der Hinsicht nicht von anderen Lebewesen oder Artefakten unterscheidet. Dass, "Nichts"(V.7) ewig ist, belegt er in Vers drei, indem er sagt das "kein Ertz / kein Marmorstein"(V.7), also nicht mal Gestein, von dem man eigentlich annehmen kann, dass es schwer kaputt geht, ewig sein kann. Gryphius geht in Strophe Zwei klimatisch vor indem er sich von den Pflanzen zum Menschen bis hin zum Gestein immer weiter steigert, und seine Vergänglichkeit erläutert. Er führt dabei, das wovon man eigentlich denkt es sei am standhaftesten, Gestein, als letztes an und das, wovon man denkt es am leichtesten zu entbehren, Pflanzen, an erster Stelle an. So zeigt er auf dass, zwischen den Verschiedenen Beispielen kein Unterschied, bezogen auf die Vergänglichkeit, herrscht. Im letzten Vers bezieht sich Gryphius schlussendlich auf das "Glück"(V.8). Antithetisch dazu verfasst er, dass auf dieses "Beschwerden"(Z.8) folgen. Dies lässt ein recht negatives Menschen - und Weltbild erkenne, da Gryphius annimmt, dass Glück nicht ewig ist und Trauer folgen muss. Auf der anderen Seite lässt sich sagen, dass dies eine recht realistische Einschätzung des Lebens ist, die einen auf Schwierigkeiten vorbereiten könnte.
Carina
Das vorliegende Sonnet „Es ist alles Eitel“ wurde von Andreas Gryphius im Jahre 1637 zu Zeiten des Barocks verfasst. Thematisch befasst sich das Gedicht mit der Vergänglichkeit alles Irdischen.
Das Gedicht besteht aus 14 Versen, welche in vier Strophen aufgeteilt sind. Dabei beinhalten zwei Strophen vier Verse und die letzten beiden Strophen drei Verse. Der Aufbau weist daher auf ein typisches Sonnet hin, da es zwei Quartette sowie zwei Terzette enthält. Das Metrum ist ein sechshebiger Jambus. Die beiden ersten Strophen bestehen aus einem umarmenden Reim (abba, abba) während die beiden letzten einen Schweifreim (ccd,eed) bilden. Reimen sich Vers eins und vier ist deren Kadenz identisch (weiblich) sowie die zweiten und dritten Verse männlich, was die antithetische Struktur des Gedichtes hervorhebt.
Bereits die Überschrift „Es ist alles Eitel“ zeugt von der Verzweiflung des lyrischen Ichs, da nichts auf der Welt von ewigem Bestand ist. Dabei akzentuiert das unbestimmte Numeral „alles“ die prekäre Lage. Die erste Strophe knüpft an die Überschrift an, indem das lyrische Ich den Leser mit direkter Ansprache darauf aufmerksam macht, dass alles Irdische vergänglich ist (vgl. V.1). Das Adverb „nur“ (ebd.) verdeutlicht den hoffnungslosen und klagenden Grundton des lyrischen Ich aufgrund der Allgegenwärtigkeit der Vergänglichkeit. Diese resignative Stimmung lässt sich in Verbindung zu dem 30-jährigen Krieg setzen, welcher zu Zeiten des Gedichtes schon 25 Jahre herrschte und Deutschland komplett zerstört hat. Die darauffolgenden drei Verse beschäftigen sich konkret mit dem Verfall und Zerstörung der Städte. So heißt es „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V.2). Auffällig ist, dass die Gegenwart und Zukunft in antithetischer Verbindung stehen, wodurch untermauert wird, dass das Schöne nur kurzen Bestand hat beziehungsweise später keine Bedeutung mehr erlangt. Ebenso stehen die Verben „bauen“ (ebd.) und „einreißen“ (ebd.) gegensätzlich zueinander. Durch das demolieren der Städte wird konkret auf den Krieg angespielt, wodurch zum Ausdruck kommt, dass das lyrische Ich der Auffassung ist, dass die Menschen selbst für ihre Vergänglichkeit bzw. der ihrer Bauwerke verantwortlich sind. Des Weiteren verdeutlichen die Pronomen „dieser“ (ebd.) und „jener“ (ebd.) die Generalisierung der Ereignisse in Europa. Die Antithetik zwischen Gegenwart und Zukunft wird im dritten Vers fortgesetzt, indem es heißt „Wo itzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V.3), wodurch untermauert wird, dass die Natur ihren Platz zurückerobert. Auffällig ist hier, dass ein Rückschritt beschrieben wird. Die „Wiese“ (ebd.) steht dabei für die Natur und durch ihre grüne Farbe für Hoffnung und symbolisch für das Gedeihen neuen Lebens. Diese Idylle wird in dem darauffolgenden vierten Vers fortgesetzt, indem es heißt „Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden“ (V. 4), was den Wunsch nach Frieden verdeutlicht.
Die zweite Strophe wird von der Antithese „Was itz und prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ (V.5) eingeleitet. Dies hebt die Vergänglichkeit der Natur, mitsamt der blühenden Pflanzen hervor. So heißt es weiter „Was itzt so pocht und trotzt ist Morgen Asch und Bein“ (ebd.). Das „poch[en]“ (ebd.) steht hier metaphorisch für den Herzschlag eines Lebewesens. Die Anapher „Was itz“ (V.5+6) untermauert, dass die Natur und die Lebewesen eine gleiche Gewichtung in der Rolle ihrer Vergänglichkeit haben. Dies wird durch den darauffolgenden Vers unterstützt, in dem mit einer verdoppelten Verneinung nichts als ewig bestehend erklärt wird und soll Klarheit über die Vergänglichkeit alles Irdischen verschaffen (vgl. V. 7). Die Vergänglichkeit wird durch die Akkumulation „kein Erz, kein Mamorstein“ (ebd.) unterstützt, da diese zu Zeiten des 17. Jahrhunderts als unzerstörbar galten. Der letzte Vers der zweiten Strophe wird mit einer Personifikation des Glückes eingeleitet. Antithetisch wird dem Glück eine Synästhesie aus "donnernden Beschwerden" (V.8) gegenübergestellt. Dabei werden zwei unterschiedliche Sinneseindrücke (donnernd = hören, Beschwerden = fühlen) miteinander in Verbindung gesetzt, um das Leid zu verdeutlichen. Des Weiteren bekräftigt diese weitere Personifikation die Assoziation mit dem Krieg, da das Verb „donnern“ mit Waffen in Verbindung gebracht werden kann, welche ebenfalls zur Zerstörung beitragen.
Nach der Betrachtung der beiden ersten Strophen ist deren klimatischer Aufbau auffallend. In der ersten Strophe wird ausschließlich die Vergänglichkeit materieller Güter beschrieben, währenddessen die zweite Strophe die Nichtigkeit der Lebewesen darstellt.
Mit Beginn der dritten Strophe wird der sonnettypische, inhaltliche Bruch eingeleitet, da die ersten beiden Strophen eher aus einer beschreibenden Position stammen und in der dritten und vierten Strophe zu einem bewertenden Standpunkt wechseln, was durch das Fragezeichen in Vers 10 und dem Ausrufezeichen in Vers 13 akzentuiert wird. Inhaltlich befasst sich die erste Terzette mit der Frage was das Leben ist und wie die Menschheit es bewältigt. So heißt es in Vers neun „Der hohe Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn“ (V.9). Dies hebt hervor, dass selbst Reichtum und hochgeschätzte Werte der Vergänglichkeit unterliegen. So wird dem Leser in Vers 10 eine rhetorische Frage gestellt „Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?“ (V.10), um dem Leser zu verdeutlichen, dass ein Kampf gegen die Vergänglichkeit sinnlos erscheint. Der elfte Vers wird durch den Ausruf der Verzweiflung „Ach!“ (V.11) eingeleitet wodurch deutlich wird, dass das lyrische Ich über die Erkenntnis der Vergänglichkeit verzweifelt ist, da der Mensch keine Gewalt über das Leben hat. Auffällig ist hier, dass die dritte Strophe mit der vierten durch ein Enjambement verbunden ist, da die letzte Strophe konkrete Antworten auf die Frage des Lebens gibt.
So wird das Leben akkumulierend „Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind“ (V.12) definiert. Dabei stehen „Schatten, Staub und Wind (ebd.) für kurzlebige Synonyme, welche die Vergänglichkeit des Lebens akzentuieren. Ein weiterer Vergleich stellt Vers 13 dar, in welchem es heißt „Als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfind´t“(V.13). Dabei steht die „Wiesenblum“ (ebd.) metaphorisch für das Leben eines einzelnen Menschen, da auf einer Wiese eine einzelne Blume so unbedeutsam wie das Leben eines Menschen und dessen Vergänglichkeit ist. Der letzte Vers des Sonnets „Noch will was ewig ist kein einig Mensch betrachten!“ (V.14) stellt das Fazit des lyrischen Ichs dar. Dieses ist der Auffassung, dass noch kein Mensch betrachtet hat was für die Ewigkeit besteht. Das Adverb „noch“ (ebd.) gibt jedoch Hoffnung, dass sich in der Zukunft noch ändern und sich der Mensch dem Ewigen zuwenden könnte. Das sogenannte Ewige ist der Glaube an Gott, welchen die Menschen in der Zeit des Barocks durch den 30-jährigen Krieg verloren haben.
Auf der Basis der hier vorliegenden Analyse lässt sich sagen, dass der Text den Leser dazu bringen soll sich auf das Wesentliche, das Leben nach dem Tod, zu konzentrieren. Die Auffassung des lyrischen Ich, dass alles Irdische Vergänglich ist, wird durch zahlreiche Antithesen, Metaphern und Personifikationen geschmückt.
Lorena
Bei dem vorliegenden Text mit dem Titel „Es ist alles eitel“, verfasst von Andreas Gryphius und veröffentlicht im Jahr 1637, handelt es sich um ein Gedicht aus der Zeit des Barock. Thematisiert wird die Vergänglichkeit des Irdischen. Inhaltlich handelt das Gedicht von der Zerstörung des 30-jährigen Krieges und den Folgen der Zerstörung.
Das Gedicht umfasst 14 Strophen und ist in der Form eines Sonettes gegliedert. Als Reimschema liegen in den Quartetten umschließende Reime vor, während die Terzette durch Paarreime gekennzeichnet werden. Als Metrum liegen durchgehend sechs-hebige Jamben vor, die 12 bis 13 Silben beinhalten und durch eine Mittelzäsur geteilt werden. Es liegen sowohl stumpfe als auch klingende Kadenzen vor, die sich dem Reimschema des Gedichtes anpassen.
Der zu analysierende Text setzt mit der Aussage „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“ (V. 1) ein. Die „Eitelkeit“ (ebd.) ist in diesem Fall als veraltetes Synonym für Vergänglichkeit zu verstehen. Das Repetitio der Formulierung „du siehst“ (ebd.) veranschaulicht die allgemeine Gültigkeit der Aussage des Lyrischen Ichs. Generell lässt bereits der erste Vers des Gedichts eine pessimistische Stimmung vermuten. Dies wird ebenfalls durch die antithetische Struktur der nächsten Verse verstärkt. Das Lyrische Ich beschreibt „Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ (V. 2). Auffällig an diesem Vers sind die Pronomen „dieser“ (ebd.) und „jener“ (ebd.), welche auf jede Person zu beziehen sind und die Aussage somit verallgemeinern. Im folgenden Vers veranschaulicht das Lyrische Ich die Aussage durch das Beispiel „Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein“ (V. 3). Das Beispiel verdeutlicht zum einen die Vergänglichkeit, zum anderen aber auch ein Anzeichen für den historischen Hintergrund des Gedichtes. Das Gedicht wurde in der Zeit des 30-jährigen Krieges verfasst, in welchem viele Städte zerstört wurden. An das Beispiel im dritten Vers knüpft der vierte Vers unmittelbar an. Es ist erneut die Rede von der Wiese „[a]uf der ein Schäfers-Kind wird spielen mit den Herden“ (V. 4).