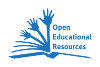Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).H.Loreley
Analyse des Gedichts Loreley von Heine
Nele
Das Gedicht „Loreley“, welches von Heinrich Heine geschrieben und 1824, in der Epoche der Romantik, veröffentlicht wurde, thematisiert die unbeherrschbaren und unerklärlichen Kräfte und Mächte der Natur, welchen der Mensch ausgeliefert ist.
Der Titel „Loreley“ könnte darauf hindeuten, dass es sich in dem Gedicht um eine weibliche Figur handelt, da dies ein weiblicher Name ist. Mehr verrät der Titel noch nicht. Das Gedicht ist in sechs Strophen gegliedert mit jeweils vier Versen. Dies lässt das Gedicht übersichtlich und geordnet erscheinen und verleiht ihm Struktur. In der ersten Strophe (V. 1-4) geht es lediglich um das lyrische Ich und seine Gefühle. Es ist verzweifelt und kann seine Gefühle nicht richtig zuordnen, denn es „weiß nicht, was soll es bedeuten, / Dass {es} {…} so traurig {ist} {…}“ (VV. 1f.). Das Semikolon in dem zweiten Vers verstärkt diese Unsicherheit und Traurigkeit, denn dem lyrischen Ich könnte es schon die Sprache verschlagen. Irgendetwas bedrückt das lyrische Ich und es hat vielleicht Sehnsucht nach etwas, denn ein „Märchen aus uralten Zeiten, / Das kommt {ihm} {…} nicht aus dem Sinn“ (VV. 3f.). Das Märchen könnte bedeuten, dass das lyrische Ich nicht genau weiß, wie es seine Gefühle ausdrücken, oder sie verarbeiten soll und die Ursache der Traurigkeit nur mittels des Märchens vermitteln kann. In der ersten Strophe führt das lyrische Ich einen Monolog, was verstärkend dafür wirken könnte, dass es die Traurigkeit versucht zu erklären und sich mit dieser sehr beschäftigt. Ein einheitliches Metrum ist nicht zu erkennen, was die Verzweiflung und die Unsicherheit des lyrischen Ichs betont.
Von der zweiten bis zur sechsten Strophe erzählt das lyrische Ich dieses angesprochene Märchen. Zunächst beschreibt es in der zweiten Strophe die Natur und die Landschaft. „Die Luft“ (V. 5) beschreibt es als „kühl und dunkel“ (V. 5), was eine Desorientierung bewirken könnte, da es vermutlich die Dämmerung beschreibt. Diese Atmosphäre wirkt gefühllos, kalt und einsam, was eine Gefahr oder Bedrohung bedeuten könnte. Die Einsamkeit wird erneut deutlich, da der Rhein „ruhig fließt“ (V. 6). Dies wirkt allerdings auch beruhigend und harmonisch, was im Kontrast zu der Luft im vorigen Vers steht. Diese harmonische Atmosphäre wird durch den „Im Abendsonnenschein“ (V. 8) funkelnden „Gipfel des Berges“ (V. 7) verstärkt. Hier wird nun klar, warum der Rhein so ruhig fließen könnte (vgl. V. 6), denn es ist Abend und vermutlich fast keiner mehr auf dem Wasser. Die Antithese der nun schönen Landschaft, die im Kontrast zu der kühlen Luft steht, lenkt die Aufmerksamkeit auf den Berggipfel.
Wieso die Aufmerksamkeit auf den Gipfel gelenkt wird, wird in der nächsten Strophe (V. 9-12) deutlich, denn „Dort oben“ (V. 10) sitzt „Die schönste Jungfrau“ (V. 9). Anhand der Beschreibung „Dort oben“ (V. 10) lässt sich vermuten, dass eine andere Person auf dem Wasser, vermutlich mit einem Boot oder Schiff, ist und zu dieser Frau hinauf schaut, aber aus einer weiten Entfernung. Der Superlativ „schönste“ (V. 9) zeigt, wie besonders und schön diese Frau ist und ihre vermutliche Unschuld wird durch die Beschreibung als „Jungfrau“ (V. 9) zum Ausdruck gebracht. Wie besonders und wertvoll die Frau ist, wird deutlich, wenn „Ihr gold’nes Geschmeide blitzet“ (V. 11). Der Schmuck der Frau wird durch die Sonne zum Funkeln gebracht, was die Loreley direkt mit der Sonne in Verbindung bringt. Daher könnte es sein, dass die Loreley nicht wortwörtlich für eine Frau, sondern vielleicht auch für die (Schönheit der) Natur oder Ähnliches stehen könnte. Erneut wird die Frau mit Gold, also etwas Wertvollem in Verbindung gebracht, denn sie „kämmt ihr goldenes Haar“ (V. 12). Gold ist sehr reizvoll und verführerisch, da es selten und somit wertvoll ist.
Es könnte also jemandem Ablenken, was durch die Repetition „Sie kämmt“ (VV. 12,13) verstärkt wird. Denn sie kämmt ihr Haar mit „goldenem Kamme“ (V. 13). Dies könnte ablenken, da sich ein goldener Kamm vermutlich auch wieder in der Sonne spiegelt und funkelt. Der verführerische und ablenkende Aspekt wird weiterhin verstärkt, wenn die Loreley „ein Lied dabei {singt}“ (V. 14). Das Ganze wirkt schon fast magisch und auch das lyrische Ich wird dadurch vermutlich komplett in den Bann gezogen, was an dem Semikolon am Ende des 14. Verses steht. Dieses Lied hat eine „wundersame, /Gewaltige Melodei“ (VV. 15f.). Alles wirkt melodisch und harmonisch, was die abwechselnden männlichen und weiblichen Kadenzen und der durchgehende Kreuzreim verstärken. Das Adjektiv gewaltig (vgl. V. 16), passt nicht in diese sonst so verführerische und harmonische Beschreibung und könnte, ähnlich wie die anfänglich beschriebene Luft, auf eine bevorstehende Gefahr oder Bedrohung, vermutlich durch diese Verführung, hindeuten.
In der fünften Strophe wird nun deutlich, aus welcher Perspektive das lyrische Ich dieses Märchen erzählt, nämlich aus der eines Schiffers. Dieser fährt auf dem „ruhig{…} {…} Rhein“ (V. 6) mit einem „kleinen Schiffe“ (V. 17). Das Adjektiv klein (vgl. V. 17), lässt den Schiffer gegenüber der „oben“ (V. 10) sitzenden Loreley, sehr hilflos und schwach wirken. Diese Hilflosigkeit und Schwachheit wird im nächsten Vers deutlich, denn „Den Schiffer, im kleinen Schiffe, / Ergreift es mit wildem Weh“ (VV. 17f.). Er gerät also vermutlich mit seinem kleinen Schiff in einen Windstoß. Die Alliteration des „wilde{n} Weh{s}“ (V. 18) zeigt, wie stark dieser Windstoß sein muss. Der Schiffer verliert vermutlich die Kontrolle über das Schiff, denn er ist abgelenkt durch die Loreley, was die Anapher „Er schaut“ (V. 19,20) „nicht die Felsenriffe, / {…} {sondern} nur hinauf in die Höh’“ (VV. 19f.), zum Ausdruck gebracht wird. Der Schiffer ist komplett in den Bann der Loreley gezogen worden und begeht den Fehler der Unachtsamkeit.
Dies führt dazu, dass „die Wellen“ (V. 21) „Am Ende Schiffer und Kahn“ (V. 21) verschlingen. Diese Metapher verdeutlicht, dass der Schiffer durch seine Unachtsamkeit letztlich durch die Natur stirbt. Das lyrische Ich schiebt das Ganze auf die Loreley, denn es sagt: „Und das hat mit ihrem Singen / Die Loreley getan“ (VV. 23f.). Hier wird noch einmal deutlich, dass die Loreley nicht unbedingt für eine Frau stehen muss, sondern auch für die Natur stehen kann, der der Mensch hilflos ausgeliefert ist, denn die Wellen und das Wasser, also die unbeherrschbaren Kräfte der Natur, führen zum Tod des Schiffers.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das lyrische Ich versucht, durch das Märchen von der Loreley und dem Schiffer, seine Gefühle und seine Traurigkeit auszudrücken und vielleicht damit versucht, sich diese überhaupt selber zu erklären. Die Verzweiflung des lyrischen Ichs wird durch das uneinheitliche Metrum deutlich. In dem Märchen wird zunächst Harmonie und Verführung des Schiffers durch die Loreley deutlich, was zu den abwechselnden Kadenzen und dem fließenden Kreuzreim passt und diese Stimmung ändert sich zunehmend zum Negativen, bis hin zum Tod des Schiffers. Zudem könnte das Märchen zum Ausdruck bringen, wie machtlos der Mensch gegenüber der Natur ist und wie unbeherrschbar die Kräfte dieser sind. Das Ganze wird durch sprachliche Mittel, wie beispielsweise eine Anapher, verstärkt.
Chiara
Das Gedicht „Loreley“, welches von Heinrich Heine geschrieben und 1824, in der Epoche der Romantik, veröffentlicht wurde, thematisiert die Hilflosigkeit und Ohnmacht des Menschen, gegenüber den mächtigen Kräften der Natur.
Die erste der sechs Strophen des Gedichtes beginnt mit den Worten „Ich weiß nicht“ (V.1), womit schon zu Beginn des Gedichtes eine starke Unsicherheit des lyrischen Ich deutlich gemacht wird. Es weiß nämlich nicht, was es bedeuten soll (vgl. V.1), „Dass [...] [es] so traurig [ist]“ (V.2). Das Semikolon in Vers 2 sorgt für eine Pause im Lesefluss und verstärkt somit die Trauer und Unsicherheit des lyrischen Ich, da es so wirkt, als würde ihm vor lauter Trauer die Stimme versagen. Das Ich erwähnt ein „Märchen“, welches ein typisch romantisches Motiv ist, da es meist die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen widerspiegelt und eine mentale Flucht aus der Realität bietet. Dieses „Märchen [stammt] aus uralten Zeiten“ (V.3), weshalb das Ich es wahrscheinlich immer wieder mal gehört hat. Dies passt zu dem immer wieder kehrenden Kreuzreim, welcher sich durchs gesamte Gedicht zieht, sowie die gleichmäßige Unterteilung des Gedichtes in sechs Strophen mit jeweils vier Versen, welche dem Gedicht eine immer wiederkehrende Struktur gibt. Da das Märchen dem Ich „nicht mehr aus dem Sinn [kommt]“ (V.4), kann man hier erkennen, dass das Ich dem Märchen die Schuld an seiner Trauer gibt und es vielleicht Parallelen von seiner momentanen Lebenssituation und der Geschichte sieht. Die erste Strophe ist, außerdem die einzige der sechs, in der man etwas über das lyrische Ich erfährt.
In der zweiten Strophe beginnt das lyrische Ich das Märchen zu erzählen, indem es seinen Schauplatz beschreibt. Dabei werden zunächst die Wörter „kühl“(V.5) und „dunkelt“ (V.5), welche Gefahr symbolisieren können, da man sie mit etwas Unangenehmen und Orientierungslosigkeit verbindet, genannt. Diese werden mit den Polysyndeta „und“ (V.5 , 6) zusammen mit dem ruhig fließenden Rhein (vgl. V.6) verbunden. Dieser stellt die sogenannte „Ruhe vor dem Sturm“ dar und baut somit Spannung auf. Darauf folgt wieder ein Semikolon, welches diese unangenehmen und bedrückenden Beschreibungen von den sehr wohltuend wirkenden Beschreibungen „funkelt“ (V. 7) und „Abendsonnenschein“ (V. 8) trennt. Diese erscheinen so wohlig, da man mit ihnen Wärme und Licht verbindet. Somit bilden die Verse 5 und 6 zusammen mit 7 und 8 eine Antithese und zeigen schon hier einen großen Widerspruch, der sich durch das ganze Märchen zieht.
In der dritten Strophe wird eine der zwei Hauptfiguren der Schiffe beschrieben, welche „Die schönste Jungfrau“ (V.9) ist. Der Superlativ „schönste“(V.9) verstärkt als Hyperbel die beschriebene Schönheit der Frau und lässt sie somit besonders wirken. Da es sich hier um eine „Jungfrau“ (V.9) handelt, wird zudem die Unschuld der Frau betont. Man kann schon hier vermuten, dass die Person den, im Titel erwähnten, Namen „Loreley“ besitzt, da es sich hierbei um einen Frauennamen handelt. Die Besonderheit der Frau, wird durch die Tatsache, dass die hoch „oben [sitzt]“ (V.10) unterstrichen, da sie somit schwer zu erreichen, wenn nicht sogar unerreichbar ist. In den folgenden zwei Versen wird sie zudem zwei Mal mit dem Adjektiv „golden[...]“ (V. 11, 12) beschrieben, was sie sehr reizvoll und selten, also besonders, erscheinen lässt, jedoch gleichzeitig auch als sehr unnatürlich. Zudem könnte man das Verb „blitzet“ (V.11), welches sehr scharf und aggressiv klingt, als gefährlich interpretieren. Dies könnte schon ein erster Hinweis auf die Gefahr sein, die von dieser Frau ausgeht.
Die vierte Strophe beginnt mit dem zweiten Teil der Anapher „Sie kämmt“ (V. 12, 13). Ihr erster Teil bildet das Ende der dritten Strophe und somit verbindet sie Strophe drei und vier miteinander, da sie die Handlung unmittelbar ineinander überfließen lässt. Auch hier wird erneut das Adjektiv „golden[...]“ (V.13) verwendet, hier, um den Kamm der Loreley zu beschreiben. Somit wird alles, was mit der Frau in Verbindung gesetzt wird, als selten und reizvoll beschrieben und erinnert zugleich den funkelnden „Abendsonnenschein“ (V.8). Die Frau „singt ein Lied“ (V. 14), was sich wieder als Symbol der Romantik erkennen lässt, da man in dieser Epoche neben der Literatur auch in die Musik vor dem Alltag geflüchtet ist. Da die „Melodei“ (V.16) „wundersam[...]“ (V.15) ist, wirkt auch diese, wie die Frau, unnatürlich. Jedoch ist sie auch „Gewaltig[...]“ (V.16) und zeigt, wie sehr sie einen in den Bann ziehen kann, da sie alles übertrifft.
In Strophe fünf findet nun eine starke Wendung der Geschichte statt. Nun kommt die zweite Figur des Märchens zum Vorschein: „Ein Schiffer, im kleinen Schiffe“ (V.17). Dieser wirkt zunächst im Vergleich zu der „Gewaltige[n] Melodei“ (V.16) sehr Hilflos, da er „in kleinen Schiffe [ist]“ (V.17). Die Wirkung dieser Melodei wird hier zudem bestätigt, da es den Schiffer „mit wildem Weh [ergreift]“ (V.18) und er somit in ihren Bann gezogen wird. Das „wilde[...]“ (V.18) widerspricht sich mit dem ruhigen Rhein (vgl. V.6), auf dem das Schiff fährt und zeigt somit die Gefahr, in welcher sich der Schiffer befindet. Darauf folgt erneut ein Semikolon, welches hier wieder den Lesefluss kurz pausiert und somit die Abgelenktheit des Schiffers zeigt. Der Parallelismus „Er schaut nicht […] / Er schaut nur“ (V.19, 20) zeigt hier, dass der Abgelenkte Schiffer nicht auf die Gefahr, nämlich die „Felsenriffe“ (V.19), auf welche er zufährt, sondern nur auf die Loreley achtet. Das lyrische Ich versetzt sich hierbei in den Schiffer, da es die Position der Frau mit „Dort oben“ (V.10) beschrieben hat und der Schiffer „hinauf in die Höh' [schaut]“ (V.20). Somit kann man davon ausgehen, dass das lyrische Ich sich nicht im Besitz seiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten fühlt und es durch die Macht von etwas größerem nun in Gefahr schwebt.
In der sechsten Strophe wird noch einmal die Unsicherheit des Ich aufgegriffen, da es sagt, „Ich glaube“ (V.21). Dies zeigt zudem, dass es sich gar nicht sonderlich für das Ende des Märchens zu interessieren scheint, da es dieses nicht genau zu kennen scheint. Vielleicht möchte es dieses auch einfach nicht wahrhaben, da es für die Figur des Märchens, in die sich das Ich hineinversetzt, tödlich endet. Dies erkennt man daran, dass „die Wellen […] / Am Ende Schiffer und Kahn [verschlingen]“ (V. 22, 23). Die Ergriffenheit des Ich, aufgrund diesem tragischen Ende, lässt sich durch das Semikolon am Ende von Vers 23 erkennen, da es eine kurze Pause bietet, um die negativen Informationen zu verdauen. Die Ursache von diesem Ende, ist hier das Singen der Loreley (vgl. V.23, 24). Die Loreley wird hier als Mörderin dargestellt, da sie den Schiffer „mit ihrem Singen“ (V.23) aktiv in den Tod gelockt hat. Somit erkennt das lyrische Ich in seiner Trauer, welche es in Vers zwei ausspricht, seine eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit gegenüber etwas Größerem.
Letztendlich lässt sich sagen, dass das Gedicht durch viele romantische Symbole, Interpunktion und Antithesen das Thema des Gedichtes darstellt. Die ständige Gefahr wird insbesondere durch Antithesen und einem Parallelismen gezeigt. Hierbei geht die Gefahr von eigentlich als wohltuenden und schönen Dingen aus.